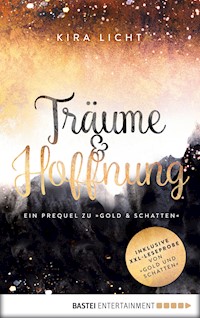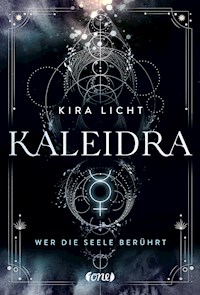
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ONE
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Kaleidra-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Band 2 der Kaleidra-Trilogie von Kira Licht!
Kaleidra verändert dich für immer - wenn du es überlebst
Emilia und Ben wurden verschleppt. Gemeinsam mit dem Feind sollen sie den Bund der Tria eingehen und das Wasser des Lebens herstellen. Doch jemand aus der Vergangenheit scheint andere Pläne zu haben, und die Ereignisse überschlagen sich. Als wäre das noch nicht genug, sind da auch noch diese verdammten Gefühle, die Emilia gar nicht haben dürfte. Schließlich gibt es nur eine Lösung: Zusammen mit Ben muss sie nach Kaleidra reisen - zum Ursprung aller Alchemisten - wohl wissend, dass sie dadurch ihr Leben aufs Spiel setzen wird ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 553
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin:
Über die Autorin:
Titel
Impressum
Widmung
Motto
Playlist
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Glossar
Verzeichnis der Ehrenmitglieder des Silberordens
Weitere Titel der Autorin:
Gold & Schatten – Das erste Buch der Götter
Staub & Flammen – Das zweite Buch der Götter
Kaleidra – Wer das Dunkel ruft
Über die Autorin:
Kira Licht ist in Japan und Deutschland aufgewachsen. In Japan besuchte sie eine internationale Schule, überlebte ein Erdbeben und machte ein deutsches Abitur. Danach studierte sie Biologie und Humanmedizin. Sie lebt, liebt und schreibt in Bochum, reist aber gerne um die Welt und besucht Freunde. Für News zu Büchern, Gewinnspielen und Leserunden folgen Sie der Autorin auf Instagram (@kiralicht) und Facebook.
Originalausgabe
Copyright ® 2021 by Kira Licht
Copyright deutsche Originalausgabe ® 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München
Textredaktion: Annika Grave
Covergestaltung: Sandra Taufer, München unter Verwendung von Motiven von © IChaikova / shutterstock; IChaikova / shutterstock; run4it / shutterstock; Bokeh Blur Background / shutterstock; Phatthanit / shutterstock; elyomys / shutterstock
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)
ISBN 978-3-7517-0144-0
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Alisa.
Für immer ein Teil von Kaleidra.
»Mut ist die Tugend, die für Gerechtigkeit eintritt.«
– Marcus Tullius Cicero
Kapitel 1
Ich schmeckte Blut.
Da war ein hohes Kreischen irgendwo über mir. Metall auf Metall, Nägel auf einer Schultafel, ein scharfkantiges Geräusch, das schrill in meinem Kopf widerhallte. Ich stöhnte. Meine Lider waren verklebt, sodass ich sie nicht öffnen konnte, mein Kiefer schmerzte, und der Rest meines Körpers schien seltsam taub.
»Sie wacht auf.«
Ein monotones Piepen nahm Fahrt auf, als ich mich bewegte. Der Boden unter mir war so hart wie Beton, das spürte ich, als endlich wieder etwas Gefühl in meinen Körper zurückkehrte. Ich hatte mich zusammengekrümmt, die Knie angezogen, die Hände über meinem Kopf. Was war geschehen? Ich schluckte, doch selbst das fühlte sich ungewohnt an. Meine Kehle war trocken, und immer noch war da dieser metallische Geschmack von Blut, der mich unwillkürlich würgen ließ. Mein Magen rebellierte, und ich zog die Knie noch etwas höher. Meine Wange rieb über eine glatte kühle Oberfläche.
»Ihr könnt ihn jetzt holen. Es dauert nicht mehr lange.«
Die Übelkeit verging, als ich tief Luft holte. Langsam entspannten sich meine Glieder wieder.
Ich bewegte mich, drehte mich um, streckte mich vorsichtig, und mit dem Leben, das nun stetig in meine Arme und Beine zurückkehrte, kam auch der Schmerz. Feuer schien durch meine Adern zu toben. Ich stöhnte im gleichen Moment, in dem ich gewaltsam meine Augen aufriss.
Weißes gleißendes Licht. Eine blendende Supernova, so grell, dass ich aufschrie, als meine Pupillen sich vor lauter Helligkeit zusammenzogen.
»Ganz ruhig, Silberling. Das vergeht.« Die Stimme besaß einen harten Akzent und klang irgendwie weit entfernt und seltsam verzerrt.
Ich versuchte zu blinzeln, doch immer noch war ich wie geblendet. Ich presste die Lippen aufeinander, fühlte ihre raue Haut, das Pochen, das stärker wurde, als ich mit den Zähnen darüberfuhr.
Es kostete mich Kraft, mich mit den Armen hochzudrücken, und als ich endlich saß, kroch erneut Übelkeit in mir hoch. Lichtpunkte tanzten vor meinem inneren Auge, als der Schmerz aus meinem Körper floss wie Wasser aus einem Staudamm, dessen Mauern plötzlich zerbrachen. Atmen, Luft holen, Sauerstoff tanken. Das Weiß verschwand, schien zu den Rändern meines Gesichtsfeldes zurückzuweichen. Langsam nahm meine Umgebung Konturen an. Ich sah mich um.
Ich befand mich in einem Raum, der komplett in Weiß gehalten war. Eine Matratze lag auf den Fliesen, daneben stand ein Tablett mit zwei kleinen Wasserflaschen und einer Packung Salzcracker. Hinter einem Paravent machte ich die Umrisse einer Toilettenschüssel aus. Da war ein Waschbecken, ein in die Wand eingelassener Flatscreen – und in jeder Ecke erspähte ich eine Kamera an der Decke. Es sah irgendwie aus wie eine sehr moderne Gefängniszelle? War ich etwa eingesperrt? Sofort überschlug sich mein Puls, und ich sah mich hektisch weiter um. Die Personen, die gesprochen hatten, konnte ich nicht ausmachen. Ich war allein. Ich drehte mich noch weiter, und zum Glück waren die Fliesen so glatt, dass ich nicht viel Kraft brauchte.
Es schien tatsächlich eine Gefängniszelle zu sein, aber statt der typischen Gitterstäbe befand sich eine Art milchige Wand vor mir. Als ich erneut blinzelte, erzitterte sie wie eine Wasseroberfläche im Wind. Oder hatte ich es mir nur eingebildet? Sicher war ich mir nicht. Ich versuchte mich aufzurichten, doch meine Beine gehorchten mir noch immer nicht richtig. Aber ich musste von hier verschwinden! Und zwar so schnell wie möglich.
Die Wand schien nun im Takt meines Herzens zu pulsieren. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Aus was für einem Material bestand sie? Das Piepen wurde schneller und lenkte meine Aufmerksamkeit auf sich. Wieso beschleunigte es, wenn auch mein Puls – Ich hielt inne. Moment mal ... In diesem Moment spürte ich die klebrigen Elektroden auf meinem Oberkörper. Von daher kam das Piepen also! Das Piepen bildete meinen Herzschlag ab! Ich gab ein wütendes Geräusch von mir, als ich in den Ausschnitt meines Shirts greifen und sie –
Oh. Jemand hatte mich meiner Sachen entledigt. Stattdessen trug ich einen ganz in Weiß gehaltenen Overall, der vorne mit einem Reißverschluss geschlossen wurde. Der Stoff war fest und weich zugleich und nicht unbedingt unbequem. Egal. Ich zerrte ihn ein Stückchen auf, und dann sah ich die Elektroden, die halb unter meinem Bustier versteckt waren. Sie schienen ihre Daten drahtlos zu übermitteln, denn ich fand keine Kabel. Ich riss die Elektroden von meiner Haut und warf sie mit einem kraftlosen Schrei ein Stückchen von mir.
»Sie hat Temperament, wie amüsant.« Eine andere Stimme, wieder mit diesem ähnlich harten Akzent. Ich schob mich ein Stückchen über den Boden, und die Haut meiner nackten Füße quietschte auf den Fliesen, während ich meine Nägel in die Fugen grub. Es war mühsam, aber irgendwie kam ich vorwärts. Dann endlich konnte ich den Arm ausstrecken und die milchige Wand berühren. Sofort jagte ein scharfer Schmerz meine Finger hinauf, und ich zuckte keuchend zurück. Es fühlte sich nicht an wie ein Stromschlag, eher wie hunderte feiner Nadelstiche. »Verdammt!« Was war das?
Im nächsten Moment wurde die Wand vor mir komplett durchsichtig. Sie pulsierte immer noch, doch nun schimmerte sie wie eine Seifenblase. Mir blieb fast die Luft weg über die Aussicht, die sich mir bot. Versuchsaufbauten, hochmoderne Maschinen, Arbeitstische, vor denen Hocker standen. Ich befand mich gegenüber einem großzügigen Labor. Im Hintergrund arbeiteten Männer und Frauen in weißen Kitteln. Und überall piepte und blinkte es. Doch mein Blick blieb schließlich an vier Personen hängen, die meine Aufmerksamkeit auf sich lenkten. Sie standen mir fast direkt gegenüber, nur getrennt durch die durchsichtige Wand, und sie alle starrten auf mich herunter.
Quecksilberalchemisten. Ich wusste es, noch bevor mir der typische kühle Schauer die Wirbelsäule hinabjagte. Und dann ging alles ganz schnell. Plötzlich liefen lauter Erinnerungen vor meinem inneren Augen ab. Der Flohmarkt. Matti, der das Quecksilber absorbiert hatte. Unser Kampf, und der Moment, in dem alles schwarz geworden war. Nur mit Mühe schaffte ich es, meinen Blick fokussiert zu halten. Ben. Was war mit Ben geschehen? Hatten sie ihn –
Halt. Atme, Emilia. Verfall jetzt nicht in Panik. Ich musste –
Es war der Mann in der Mitte, dessen Anblick plötzlich sämtliche Luft aus meinen Lungen weichen ließ. Ich kannte ihn, und doch hatte ich ihn noch nie zuvor im Leben gesehen.
Sein helles Haar war bereits mit weißen Strähnen durchzogen, das Kinn etwas kantiger, der Blick aus den grünen Augen grausamer und härter. Und doch ...
Der Schock der Erkenntnis hallte in mir nach. Es waren unverkennbar die Züge meines besten Freundes, die mir entgegenblickten. Bisher hatte ich immer angenommen, dass Matti nach seiner Mutter kam. Jetzt wurde mir klar, dass ich mich all die Jahre, mein ganzes Leben lang, getäuscht hatte. Ich musste würgen.
Matti gehörte zum Quecksilberorden, und er hatte es ein Leben lang vor mir verheimlicht. Doch wie? Ich spürte es normalerweise, wenn ich einem Alchemisten gegenüberstand, genau wie jetzt. Doch bei ihm hatte ich nie etwas bemerkt. Ich hielt mir den Bauch, bis die Übelkeit etwas nachließ.
Die vier Personen starrten mich immer noch völlig emotionslos an. Obwohl es mich alle Kraft kostete, starrte ich zurück.
Der junge Mann ganz links mit dem kastanienbraunen Haar trug eine Art Uniform. In ihrem Tarnmuster mutete sie militärisch an, obwohl sie ganz in Schwarz- und Grautönen gehalten war. Er trug eine dicke Hornbrille, die seine Augen hinter den Gläsern unnatürlich vergrößerten. Die Frau daneben war etwa gleich alt, vielleicht achtzehn oder neunzehn Jahre. Sie trug einen weißen Kittel und hatte ihre wilden roten Locken in einer komplizierte Flechtfrisur gebändigt. Gerade hatte sie den Blick abgewandt und machte sich Notizen auf einem Klemmbrett. Rechts außen stand ein junger Mann, den ich ungefähr auf Olivers Alter geschätzt hätte. Mit seinem rabenschwarzen Haar, den mandelförmigen Augen und der extrem durchtrainierten Figur sah er aus wie ein Schauspieler aus einem Martial-Arts-Film.
Ich wollte den Mund öffnen, etwas sagen, doch aus meiner Kehle kam nur ein krächzender Laut.
Der Mann mit dem hellen Haar, ich schätzte ihn auf Ende fünfzig, trat einen Schritt vor in Richtung meiner Zelle. Und je näher er kam, desto unglaublicher schien die Ähnlichkeit zu Matti.
»Herzlich willkommen in der Quecksilberloge von Washington, Signorina Pandolfini.« Erst da fiel mir auf, dass er Italienisch sprach, genau wie die gesichtslosen Stimmen gerade eben. Es war definitiv nicht seine Muttersprache – was nicht verwunderlich war, wenn wir uns wirklich an der Ostküste der USA befanden.
Wie war ich hierhergekommen? Wie lange war ich ohnmächtig gewesen?
»Mein Name ist Professor Flint Avalanche.« Sein Lächeln war eher ein hinterhältiges Zähneblecken. »Und wie ich dem Schock auf Ihrem Gesicht nach urteile, haben Sie mich erkannt, beziehungsweise ...« Er lachte gekünstelt. »... haben Sie erkannt, mit wem ich verwandt bin. Mein Sohn Matthew hat seinen Auftrag gut erfüllt. Und die Giordanos waren ihm eine gute Familie. Ich habe damals, vor so vielen Jahren, die richtige Entscheidung getroffen, und sie sind fürstlich dafür entlohnt worden.«
Es war also alles wahr. Das hier war kein schrecklicher Traum. Mein Gott. Es schien, als hätte ich alle Gefühle bereits aufgebraucht. Als könne ich so etwas wie Schock oder Trauer gar nicht mehr empfinden. Die Giordanos waren gar nicht Mattis Familie? Sie hatten ihn für diesen Mann aufgezogen? Doch warum?
»Wie geht es Ihnen?« Die Stimme von Professor Avalanche klang, als wolle er ein wenig mit mir plaudern. »Möchten Sie ...«
»Entschuldigen Sie, Sir, aber ...« Ein Wissenschaftler unterbrach ihn auf Englisch. Die Dringlichkeit in seinem Blick war unverkennbar, als er näher trat.
Professor Avalanche holte in der nächsten Sekunde aus und schlug dem Mann mitten ins Gesicht.
Das schmerzhafte Aufeinanderprallen von Haut auf Haut durchschnitt den Raum. Es war ein hässliches Geräusch, das so bedrohlich klang, dass ich unwillkürlich zurückwich.
Der Wissenschaftler keuchte auf und hielt beide Hände über seine Nase.
»Dr. Gemini.« Professor Avalanche klang, als tadele er ein kleines Kind. »Wie unhöflich unserem Gast gegenüber. Sie wissen doch, dass wir die Landessprache unserer Besucher sprechen, aus Respekt ihrer Kultur gegenüber.«
Der Mann ließ die Hände sinken. Blut tropfte aus seiner vermutlich gebrochenen Nase und rann über sein Kinn. Rote Flecken bildeten sich auf seinem blütenweißen Kittel. »Entschuldigen Sie«, sagte er dann in gebrochenem Italienisch. »Das kommt nicht wieder vor.«
Professor Avalanche zog ein Taschentuch hervor und tupfte sich damit über seine Fingerknöchel. Danach stopfte er es zurück in eine seiner Taschen, ohne sein Gegenüber weiter zu beachten. Der Mann verschwand mit gesenktem Kopf, eine Hand wieder vor seine Nase gepresst. Ich hatte das Schauspiel voller Entsetzen mit angesehen. Doch was mich neben der Gewalt am meisten schockierte, war, dass die übrigen drei Personen nicht einmal mit der Wimper gezuckt hatten. Für sie schien es absolut normal, dass Gewalt ein Mittel war, um seine Vorherrschaft durchzusetzen. Und das verabscheute ich zutiefst.
»Entschuldigen Sie den kleinen Zwischenfall, Signorina Pandolfini«, sprach Professor Avalanche weiter. »Sie werden sich fragen, warum wir Sie hier sicher verwahrt haben.«
Mir war völlig egal, was er sich dabei gedacht hatte. »Lassen Sie mich sofort raus hier. Meine Mutter wird durchdrehen vor Sorge und ...«
»Oh, da ist noch jemand, den ich Ihnen gerne vorstellen möchte«, unterbrach er mich.
Ich drehte den Kopf in die Richtung, in die der Professor deutete. Schon wieder jemand, der Matti zum Verwechseln ähnlich sah. Der Mann war älter, vielleicht Mitte zwanzig. Er war ungefähr so groß wie Matti und hatte eine ähnliche Figur. Auch er wirkte wie ein Quarterback, dem die Cheerleader reihenweise zu Füßen liegen würden. Doch das, was in Mattis Gesicht liebenswert und sympathisch wirkte, schien in seinen Zügen völlig zu fehlen. Sein Gesicht war kantiger und der Blick so scharf wie der eines Raubvogels. Die tiefliegenden Brauen unterstrichen diesen Eindruck sogar noch. Da war ein grausamer Zug um seine Lippen, den ich bei Matti noch nie gesehen hatte.
»Mein Sohn, Tyson Avalanche. Mein anderer Sohn«, berichtigte der Professor sich im nächsten Moment.
Tyson verschränkte die Arme vor der Brust und musterte mich von oben bis unten. Dann nickte er mir lediglich zu. Er besaß die gleiche undurchdringliche Fassade wie sein Vater. Selbst das freundliche Nicken schien nichts als eine versteckte Drohung zu sein. Ich grüßte nicht zurück.
Mit aller Kraft stemmte ich mich hoch, um endlich auf die Füße zu kommen. Ich wollte nicht mehr vor ihnen auf dem Boden sitzen wie eine Gefangene. »Lassen Sie mich raus hier.«
»Tut mir leid, Sie müssen noch ein wenig warten«, widersprach er fröhlich, als würden wir zu einem lustigen Abend im Zirkus aufbrechen. »Also, darf ich Ihnen meine Loge vorstellen?« Er verbeugte sich. »Ich bin der Meister der Quecksilberloge von Washington D.C., aber das hatte ich Ihnen ja schon verraten. Mein Sohn Tyson ist meine rechte Hand, also der Sekundant der Loge. Das hübsche Mädchen in dem weißen Kittel ist July Mercury, unsere Scriptorin. Der junge Mann ganz rechts außen ist Alistair Baker, unser Hüter des Protokolls. Mein Fechtmeister ist Kyle Aoki Dennham.« Der Kampfsportprofi neigte einmal kurz den Kopf zur Begrüßung. »Und mit meinem Pionier sind Sie quasi aufgewachsen. Es handelt sich um meinen Sohn Matthew Avalanche, den Sie unter seinem Decknamen ›Matteo Giordano‹ kennengelernt haben.« Während sich mein Magen schon wieder schmerzhaft zusammenzog, machte Professor Avalanche eine ausschweifende Geste mit beiden Händen. In diesem Moment wirkte er wirklich wie ein wahnsinniger Zirkusdirektor, der sich in seinem kleinen Reich wie ein brutaler und unberechenbarer Herrscher aufführte. »Nochmals herzlich willkommen.«
»Es ist mir egal, wer Sie sind und was Sie getan haben. Bitte lassen Sie mich einfach hier raus. Lassen Sie mich frei, und ich werde niemandem davon erzählen.« Ich wiederholte mich, doch es war mir egal.
Professor Avalanche musterte mich interessiert von Kopf bis Fuß, bis er schließlich in mein Gesicht sah. »Glauben Sie wirklich, wir haben Sie dort eingesperrt, nur um auf Ihren Befehl zu warten, damit wir Sie wieder herauslassen?«
Ich schnaubte. »Die anderen Orden werden ...«
Sein Lachen unterbrach mich. Er lachte so laut und so herzhaft, dass die Mitglieder seiner Loge irgendwann anfingen, sich unbehagliche Blicke zuzuwerfen. Schließlich schien Professor Avalanche sich sogar eine Träne aus dem Augenwinkel wischen zu müssen. »Schätzchen, Sie sind noch sehr jung, deshalb ist in Ihrem Falle Naivität beinahe niedlich. Aber mal ernsthaft.« Er verschränkte die Arme, und um seinen Mundwinkel tanzte immer noch ein Lächeln.
»Glauben Sie wirklich, dass wir Angst vor den anderen Orden haben? Der Goldorden beweihräuchert sich hauptsächlich selbst, mit ihren wohltätigen Forschungen und ihrem Dienst an der Menschheit. Sie haben ihre Kraft schon lange nicht mehr in ihre eigene Verteidigung gesteckt, sondern nur noch ihren karitativen Zwecken gewidmet. Sie besitzen überhaupt nicht die Schlagkraft, um auch nur bis hierher zu gelangen. Und der Silberorden, das dürften selbst Sie mittlerweile wissen, ist nur noch ein trauriger Haufen von Idioten, die irgendwie in den Achtzigern hängengeblieben sind. Sie hätten nicht mal die Mittel, um sich die Reise hierher zu finanzieren. Also wer genau sollte Sie retten? Ich meine, wenn Sie da auf einem aktuelleren Stand sind als ich, dann weihen Sie mich ein. Ich lasse mich immer gern überraschen.« Noch mal machte er so eine alberne Geste. »Um ehrlich zu sein, ich liebe Überraschungen. Sollte der Goldorden hier auftauchen, um sich mit uns zu prügeln, dann herzlich gerne. Aber vermutlich werden sie uns eher einen netten handgeschriebenen Brief auf Ökopapier zukommen lassen, indem sie uns freundlich zu Keksen und Matcha-Tee zu einem kleinen Gespräch am Nachmittag einladen. Vielleicht auf einem ihrer Schiffe, mit dem sie Walfänger sabotieren?« Er brach schon wieder in Gelächter aus. Tyson, sein Ebenbild, fiel mit ein. Die anderen verzogen immer noch keine Miene. Mein Blick fiel auf das Blut, das aus der Nase des Angestellten getropft war und nun hell auf den weißen Fliesen schimmerte. Es bestätigte mir, was schon die ganze Zeit in meinem Hinterkopf in Form eines roten Warnlämpchen aufblinkte. Dieser Mann war wahnsinnig. Er war größenwahnsinnig und absolut unzurechnungsfähig. Mit ihm zu diskutieren war, wie mit einem angreifenden Löwen ein Gespräch beginnen zu wollen.
Der Professor wedelte plötzlich mit der Hand, und die durchsichtige Wand, die uns trennte, fiel in sich zusammen. Er winkte mich zu sich. »Kommen Sie, kommen Sie.«
Was hatte er nun vor? Freilassen würde er mich ganz bestimmt nicht. Und er hatte mir auch nicht erzählt, warum er mich gefangen hielt. Wollte er lediglich verhindern, dass Mattis Tarnung aufflog? Zögerlich trat ich aus meiner Zelle. Meine Knie fühlten sich immer noch wackelig an, und hin und wieder verschwamm mir ein wenig die Sicht vor meinen Augen. Karate Kid Kyle, wie ich ihn heimlich getauft hatte, kam mir entgegen und streckte mir einen seiner muskelbepackten Arme hin. Er war genau so groß wie ich, aber ich fürchtete, dass er mich mühelos kleinfalten konnte wie eine Serviette, wenn ich nur mit der Wimper zuckte. Ben hatte bereits angedeutet, dass die Quecksilberalchemisten es mit den Regeln der Orden nicht so genau nahmen. Aber ich schien bereits so sehr eins damit geworden sein, dass ich es komisch fand, dass Kyle mich wie selbstverständlich berührte.
Als habe er es geahnt, fing er mich auf, als mir auf einmal die Beine wegknickten. Ich war zu gut erzogen, sodass ich wie selbstverständlich ein »Dankeschön« murmelte. Er nickte knapp, doch seine Miene blieb weiterhin völlig ausdruckslos. Sein Griff tat mir nicht weh, er hielt mich einfach nur aufrecht. Ich spürte, wie unsere Elemente umeinanderstrichen. Tastend, vorsichtig und nicht so feindselig, wie ich es erwartet hätte.
»Hören Sie«, drängte ich erneut. »Ich muss bitte meiner Mutter eine Nachricht zukommen lassen. Ich ertrage es nicht, wenn sie sich Sorgen um mich macht. Sagen Sie ihr, dass es mir gut geht, lassen Sie sich irgendetwas einfallen, warum ich nicht nach Hause gekommen bin. Lassen Sie mich kurz mit ihr sprechen. Bitte. Ich werde Sie nicht verraten.«
Professor Avalanche schnalzte mit der Zunge und schien meinen Protest überhaupt nicht ernstzunehmen. Ich ließ mich von Kyle vor einen Computerbildschirm schleppen. Mir war immer noch schwindelig. Der Professor schnippte einmal mit dem Finger, und der junge Wissenschaftler, der vor dem Rechner saß, schien zu verstehen. Er tippte einen Befehl in die Tastatur. Zuerst erschien die Karte der Welt auf dem Bildschirm, darüber, und, nicht zu übersehen, ein Datum. Es war noch Sonntag! Gott sei Dank! Dann veränderte sich das Bild auf dem Computer, und die Karte zoomte immer näher, wie das Objektiv einer Kamera. Ich erkannte Italien, Rom, dann den Bahnhof und unser Viertel. Eine Zeitanzeige erschien, die Zahlen änderten sich ständig, schienen sich auf die Ortszeit einzustellen. Es war immer noch Sonntag, aber bereits früher Abend. Und es war definitiv zu spät, um immer noch mit Matti über den Flohmarkt zu schlendern. Mamma musste mittlerweile durchgedreht sein vor Sorge.
Das Bild zoomte noch mehr rein. Da war der Hinterhof und der Garten von Davine. Ich sah Newton im hohen Gras schnüffeln. Auf dem Gartentisch stand eine halbvolle Tasse Kaffee. Auf unserem Balkon machte ich die Gartenstühle mit den nach dem Feuer neu gekauften Auflagen aus. Mamma trat gerade hinaus in die Sonne und hatte eine ihrer geliebten Klatschzeitschriften dabei. Sie hatte mit einer Kollegin getauscht, sodass sie heute nicht arbeiten musste. Wir hatten den Nachmittag zusammen verbringen wollen. Doch sie wirkte nicht ängstlich und verstört. Im Gegenteil. Gerade lachte sie und drehte sich dann zu jemandem um, der sich noch in der Wohnung zu befinden schien. Hatte sie Besuch?
Sie nahm auf einem der Stühle Platz und rief noch etwas nach drinnen. Als ich sah, wer den Balkon betrat, knickten mir erneut die Beine weg. Ich keuchte auf, während Kyles starke Arme mich stützen.
Ich selbst hatte gerade lachend neben meiner Mutter Platz genommen.
Kapitel 2
Ich starrte wie gebannt auf den Bildschirm, während ich gleichzeitig Kyles Arme von mir schob. Das konnte nicht sein. Es musste sich um eine optische Täuschung handeln. Ob das Datum wirklich stimmte? Ob sie diesen Bildschirm irgendwie manipulierten?
Ganz langsam drehte ich den Kopf in Professor Avalanches Richtung. Er deutete auf den Bildschirm, als wolle er sagen: ›Worüber machst du dir Sorgen?‹
»Das ist Fake«, stieß ich trotzdem hervor. »Wann auch immer Sie das aufgenommen haben, es entspricht nicht der Wahrheit. Newton ist öfter in Davines Garten, auch wenn wir zu Hause sind. Das hier kann auch locker aus dem letzten Sommer stammen, und Sie haben es irgendwie manipuliert oder aus mehreren Aufnahmen zusammengeschnitten. Ich will sofort mit meiner Mutter sprechen.«
Professor Avalanches Lächeln wurde noch breiter. Wortlos gab er July ein Zeichen. Sie legte daraufhin das Klemmbrett auf dem Tisch neben dem jungen Wissenschaftler ab und zog ein Telefon hervor. Sie schien die Nummer eingespeichert zu haben, denn sie drückte nur eine Kurzwahltaste. Mir wurde eiskalt, als Mamma auf unserem Balkon die Zeitschrift zur Seite legte und aufstand. Ich konnte nicht sehen, was in der Wohnung geschah, doch plötzlich schien es, als hätten sich alle meine inneren Organe auf Faustgröße zusammengekrallt.
»Hallo Signora Pandolfini, entschuldigen Sie bitte die Störung. Hier ist July, könnte ich bitte Emilia sprechen?«, fragte July in perfektem Italienisch.
Nur einen Moment später kam meine Mutter zurück auf den Balkon. Sie hielt unser Festnetztelefon in der Hand. Julys Blick war eiskalt, als sie auf ihrem Handy einen Knopf drückte. Es raschelte kurz, und ich erkannte, dass sie den Lautsprecher angestellt hatte. Auf dem Bildschirm reichte mir Mamma gerade das Handy.
Als die Stimme – meine Stimme – ein freundliches »Prego?« in den Hörer sagte, knickten mir erneut die Beine weg. Kyle war sofort zur Stelle und stützte mich.
Wortlos klappte July das Telefon zu und zauberte dann aus einer ihrer großen Kitteltaschen ein weiteres Gerät hervor. Sie hielt es mir an den Hals, und nur wenige Sekunden später piepte es zustimmend.
»Ihre Vitalwerte sind noch nicht wieder im Normbereich.« Sie klang so sachlich, als rede sie über eine Maschine und nicht über ein menschliches Wesen. »Sie braucht noch einen Tag.«
»Ich brauche keinen Tag«, zischte ich, obwohl ich noch immer mit Schwindel zu kämpfen hatte. »Ich brauche eine Erklärung.«
»Zeigen Sie mir doch mal Ihr Armband.« Professor Avalanche hatte affektiert alle zehn Fingerspitzen aneinandergelegt. Ich wusste sofort, worauf er anspielte, und schob das Bündchen meines Overalls hoch. Schließlich trug ich schon seit Ewigkeiten nur dieses eine besondere Lederarmband mit dem kleinen blauen Stein.
Doch da war kein Armband mehr. Nur eine verhaltene helle Linie auf meiner Haut, dort, wo die Sonnenbräune vom Leder abgeschirmt worden war. Ich sah ihn wütend an. »Da mir irgendjemand alle meine Klamotten weggenommen hat, nehme ich an, dass man mir das Armband ebenfalls entwendet hat?« Ich schnaubte. »Wissen Sie was, behalten Sie es. Ich will es sowieso nicht mehr.« Matti hatte es mir vor Jahren geschenkt, und ich war mir nicht sicher, ob es ich überhaupt wieder tragen wollen würde.
Professor Avalanche wirkte immer noch amüsiert. »Sehen Sie genau hin.« Er deutete auf den Bildschirm. Der junge Wissenschaftler zoomte freundlicherweise noch weiter in das Bild hinein. Diese Person, die aussah wie ich, trug mein Armband. Ich war noch immer misstrauisch. »Ja, und? Ich trage das Armband jeden Tag.« Das hier konnte niemals echt sein. »Ich erwarte eine Erklärung«, forderte ich. Meine Stimme klang fest, doch innerlich fühlte ich mich, als würde ich zerbrechen. Ich konnte immer noch nicht glauben, was ich dort sah. Es war beängstigend und bedrohlich, und außerdem machte ich mir jetzt noch viel größere Sorgen um meine Mutter.
»Sie sind gerade ans Telefon gegangen.« Professor Avalanche. »Das haben Sie doch gesehen.«
Was hatte das alles zu bedeuten?
»Um genau zu sein, sieht die Person, die Sie dort sehen, nicht nur aus wie Sie, sie ist auch genau wie Sie.«
Mein Magen zog sich vor Übelkeit zusammen. Dieser Mann war doch wahnsinnig! »Sie meinen, Sie haben einen Klon erschaffen? Eine perfekte Kopie von mir?« Ich schnaubte. »Ich weiß, dass sowas nicht funktioniert. Man ist nicht nur die Summe seines Erbguts. Faktoren wie Erlerntes und das soziale Umfeld prägen einen Charakter ebenso. Sie können keinen Klon bauen, der meine Mutter und meine Freunde täuschen könnte.«
»Sie gucken zu viele Hollywood-Filme«, erwiderte Professor Avalanche. »Dort wird vermittelt, dass die Möglichkeiten, eine 1 a-Kopie eines Menschen und seiner Persönlichkeit herzustellen, begrenzt sind. Wir jedoch forschen schon sehr lange und gut versteckt vor den Augen der Öffentlichkeit. Wir besitzen Wissen, das über viertausend Jahre alt ist. Wir besitzen Fähigkeiten, die unsere hochkomplizierte Forschung bis zur Perfektion ergänzen.« Er neigte sich ein wenig näher zu mir. »Wir erschaffen Dinge, von denen Sie noch nicht mal zu träumen gewagt haben. Und wir sind den anderen beiden Orden meilenweit voraus. Dieses Armband hat ihr Leben lang Informationen gesammelt.«
Er klang so überzeugt, so selbstbewusst, so sicher. Ich glaubte ihm immer noch kein Wort, aber jetzt drängte sich mir eine andere Frage auf. »Was wollen Sie von mir?« Meine Stimme war nur noch ein Flüstern. »Ich bin nicht im Orden aufgewachsen. Ich habe kaum praktische Erfahrung. Ich kenne keine internen Geheimnisse, ich weiß eigentlich überhaupt nichts.« Dann kam mir noch eine andere Idee. »Oder halten Sie mich hier fest, weil Sie hoffen, den Klon in den Silberorden einzuschleusen und dort an vertrauliche Informationen zu gelangen?«
Professor Avalanche lachte überheblich. »Glauben Sie mir, so großartig sind die Geheimnisse des Silberordens gar nicht. Sie.« Er deutete auf mich. »Sind alles, was wir brauchen. Sind Sie wirklich so dumm, eins und eins nicht zusammenzählen zu können? Matthew hat Ihnen doch erzählt, dass wir die Pläne des Goldordens durschaut haben, noch bevor Sie zu Ihrem lächerlichen Kreuzzug aufgebrochen sind.« Wieder rahmte er seine Worte in imaginäre Anführungszeichen.
Ich schluckte. Es ging hier nicht vorrangig um die Geheimnisse der Orden, und es ging auch gar nicht wirklich um mich. Ich erinnerte mich, wie der Goldorden immer wieder darüber gesprochen hatte. Larkin, Murphy, Oliver, Annmary und ... »Ben«, stieß ich hervor. Der Quecksilberorden wollte an die Geheimnisse des Voynich-Manuskripts gelangen. Mein Gott. Und Ben war allein auf einer Radtour gewesen, weit draußen vor der Stadtgrenze Roms. Er war geschwächt gewesen. Von der Statue der Helena unter dem Petersdom – und von unserem leidenschaftlichen Kuss in der Abstellkammer. Er war bestimmt eine leichte Beute gewesen, und er war ganz sicher nicht so leicht einzuschüchtern wie ich. Oh, bitte ...
»Wo ist Ben Hastings?« Wenn sie irgendetwas mit dem Voynich-Manuskript anfangen wollten, brauchten sie auch Ben. Uns fehlte noch eine Mission. Ein letzter Baustein. Sie brauchten ihn und mich. Trotzdem schnürte die Angst um ihn mir auf einmal die Kehle zu.
July, die Scriptorin, neigte sich zu Professor Avalanche und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Der nickte. »Benedict Hastings hält sich tapfer. Wir befragen ihn gerade.« Und wieder unterstrich Professor Avalanche seine Worte mit Anführungszeichen – es schien eine ekelhafte Marotte von ihm zu sein, und mir wurde eiskalt vor Angst.
Befragen? So nannte er das also?
»Lassen Sie ihn in Ruhe.« Meine Stimme überschlug sich fast. »Er hat niemandem etwas getan.«
»Das mag sein.« Wieder klang Professor Avalanche, als würden wir bei Kaffee und Keksen ein wenig plaudern. »Aber wir wollen ein paar Antworten von ihm, und bisher hat er sich als ...« Er lachte. »...nun ja ... nennen wir es mal etwas stur erwiesen. Wir haben ihn freundlich gefragt, und er hat nicht geantwortet. Dann haben wir weniger freundlich gefragt, und er hat wieder nicht geantwortet. Wissen Sie, es gibt etwas, das wir ›Gläsernen Pakt‹ nennen. Die Orden sind untereinander zum Informationsaustausch verpflichtet. Der Junge schuldet uns Antworten. Das gebietet nicht nur die Höflichkeit, sondern auch besagter Pakt.«
»Besagt dieser Pakt auch, dass Mitglieder anderer Orden entführt und gefoltert werden dürfen?«
Ein weiteres, furchteinflößendes Lächeln malte sich auf Professor Avalanches Gesicht, dann legte er den Kopf schief. »Sie wissen aber schon, dass das nur Spekulationen sind, Signorina Pandolfini? Ich habe nur gesagt, dass wir ihn befragen.«
Ja, klar. Natürlich glaubte ich ihm kein Wort. Sie bedrohten Ben – oder Schlimmeres – und nannten es eine »Befragung«. »Ich will sofort zu ihm. Ich will ihn sehen, ich will mich vergewissern, dass es ihm gut geht.«
»Sie sind überhaupt nicht in der Position, irgendetwas zu fordern. Das sollte Ihnen klar sein, meine Liebe.«
»Wieso? Werden Sie mich zur Strafe sonst auch ›befragen‹?« Ich rahmte das Wort, genau wie er, in imaginäre Anführungszeichen.
Dann ging alles ganz schnell. Professor Avalanche warf seinem Sohn Tyson nur einen knappen Blick zu.
Im nächsten Moment hatte dieser mich aus Kyles Arm gerissen, der mich immer noch gestützt hatte. Er packte mich am Kinn und hob mich ein kleines Stückchen in die Luft. Tysons Finger bohrten sich schmerzhaft in meinen Unterkiefer, und seine Handfläche drückte vor meinen Kehlkopf. Ich wollte schreien, doch ich konnte nicht. Meine Füße baumelten hilflos über dem Boden.
»Hören Sie mir gut zu, Signorina Pandolfini. Wir sind keine Wilden. Wir behandeln die, die mit uns kooperieren, gut. Sie bekommen von uns genug zu essen, genug zu trinken und die medizinische Versorgung, die Sie benötigen. Sie haben Ihre eigene hübsche Zelle, Sie bekommen genug Schlaf, und Sie haben einen Bildschirm, auf dem Sie hunderte Fernsehprogramme ansehen können, sollten Sie sich langweilen. Es liegt uns fern, Sie auf irgendeine Art und Weise körperlich oder seelisch zu misshandeln. Vorausgesetzt, Sie benutzen Ihr hübsches Köpfchen und entscheiden sich dafür, unseren Anweisungen Folge zu leisten.« Aus Professor Avalanches Stimme war jegliche Emotion gewichen.
Ich wollte schlucken, doch es funktionierte nicht. Tysons Griff um mein Kinn wurde noch fester, als ich hilflos zu zappeln begann. Ich hätte nie gedacht, dass es möglich wäre, jemanden auf diese Art und Weise hochzuheben. Irgendwann, zwischen Keuchen und Strampeln, fiel mir ein, dass ich auch Hände besaß, um mich zu wehren. Doch Tyson durschaute mich sofort. Ich wollte gerade zum Schlag ausholen, als er mich scheinbar mühelos noch ein Stückchen höher hielt. Ich traf seinen Arm, und kurz rutschte sein Daumen ab, glitt nun aber in Richtung meiner Kehle. Ich hustete und würgte.
»Das reicht.«
Tyson gehorchte, ließ mich aber betont langsam runter. Seine grünen Augen durchbohrten mich. Sie glichen denen von Matti, was allen Schmerz nur noch verdreifachte. Seine Finger lagen nun um mein Kinn, als ich endlich wieder sicher stand. »Und das hier war nur ein freundliches Hallo«, flüsterte er nah an meinem Mund. »Mein Vater verbringt viel Zeit mit seinen Politikerfreunden. Irgendwann sind wir beide sicher mal ganz allein und dann ...«
»Tyson.« Professor Avalanches Stimme klang scharf. Sofort wich Tyson zurück und stellte sich in die Riege zurück neben seinen Vater. Als ich ihn immer noch entsetzt ansah, zwinkerte er mir verschwörerisch zu. Professor Avalanches Blick schoss zu seinem Sohn, doch er bekam diese Geste nicht mit. Kyle war erneut neben mich getreten, doch dieses Mal schaffte ich es, mich selbst aufrecht zu halten.
»Was wollen Sie von mir?«
»Eins nach dem anderen, eins nach dem anderen.« Professor Avalanche wertete meine leise formulierte Frage wohl als eine Art Zustimmung, denn sein Blick wurde wieder freundlicher. »Zuerst beenden wir unseren kleinen Rundgang. Das Quecksilber in Ihren Adern sollte bald auf ein Niveau herabgesunken sein, mit dem Sie beschwerdefrei sind. Bewegung kurbelt die Blutzirkulation an und sollte dazu beitragen. Da wird ein kleiner Spaziergang nicht schaden, zumal meine Leute noch mit Mr Hastings beschäftigt sind.« Er kicherte dunkel. »Wir müssen uns ein wenig beeilen, aber ich möchte Ihnen trotzdem noch ganz kurz etwas zeigen.«
Wut wallte in mir hoch, als er über Ben sprach, als wäre das alles ein großer Spaß. »Zeigen Sie mir sofort, wo Sie Ben untergebracht haben.« Ich schluckte, als ich an den vermeintlichen Klon dachte. Das würde ich erst glauben, wenn ich mir selbst live gegenüberstand. Als ich meinen scharfen Tonfall bemerkte, fügte ich noch ein verbindliches »Bitte, Meister« hinzu und senkte den Blick.
Mein Verhalten schien Professor Avalanche sehr zu gefallen. Er tätschelte mir freundlich den Kopf. »Eins nach dem anderen.«
Ich wäre am liebsten zurückgewichen und hätte mich geschüttelt, doch ich blieb eisern, wo ich war. Stattdessen befühlte ich unauffällig meinen Unterkiefer, dort, wo Tysons Finger schmerzende Druckstellen hinterlassen hatten. Tyson lächelte, als ich kurz zu ihm herübersah. Doch es war keineswegs eine freundliche Geste, sondern vielmehr ein boshaftes Grinsen, das Genugtuung ausstrahlte. In meinem Kopf rasten die Gedanken. Sie hatten einen Klon von mir gebaut. Wann war das geschehen? Würde ich für immer eine Gefangene bleiben? Würde das hier meine Zukunft sein? Ich dachte an Ben. Ich musste wissen, wie es ihm ging. Ich musste sehen, dass es ihm gut ging. Die Sorge um ihn schien allgegenwärtig.
Der Professor ging voraus, blieb dann aber stehen, drehte sich zu uns anderen um und musterte mich argwöhnisch. »Jemand soll ihr Schuhe holen.«
July gab Alistair ihr Klemmbrett und flitzte in meine Zelle. Kurz darauf kam sie mit einem Paar weißer Ledersneakers zurück. Sie hielt sie mir mit spitzen Fingern hin.
»Anziehen.«
Ich zuckte hilflos mit den Schultern und stellte mich absichtlich sehr schwächlich. July schnaufte und hielt mir die Schuhe noch etwas mehr vors Gesicht. »Anziehen, sofort.«
»Muss ich dir helfen?«, knurrte Tyson und fixierte mich mit seinen Tieraugen.
Der Professor seufzte genervt, sah dem Schauspiel aber interessiert zu.
»Ihr ist noch schwindelig«, erklärte Kyle. Er ging vor mir in die Hocke, legte meine Hand aber vorsorglich auf seine Schulter, damit ich mich weiter an ihm abstützen konnte. »Wart ihr schon mal so zugedröhnt?«
Julys Haltung änderte sich sofort. Sie zog sogar die Schnürbänder auf, damit Kyle es einfach hatte, mir die Schuhe anzuziehen. Sie passten perfekt.
»Danke«, sagte ich leise zu beiden. Es war nicht mal gelogen. Mir war wirklich noch schwindelig.
»Dann los.« Professor Avalanche dreht sich wieder zum Ausgang und setzte sich in Bewegung.
Kyle legte mir eine Hand an den Rücken, um mich zum Gehen zu bringen. Sie schienen sich wirklich kein bisschen um die »nicht anfassen«-Politik der Orden zu kümmern. Waren sie wirklich so viel stärker, dass ihnen dieser Kräfteverlust nichts ausmachte?
Wir durchquerten das Labor, doch ich erhaschte nur schemenhafte Blicke auf die vielen wissenschaftlichen Apparate. Dutzende Menschen schienen hier zu arbeiten.
»Warum haben Sie mir meine Sachen ausgezogen?«, fragte ich und dachte schaudernd daran, wer es wohl übernommen hatte. Hoffentlich nicht dieser Widerling Tyson. »Ich will meine eigenen Sachen zurückhaben.« Es war lächerlich, aber ich fühlte mich so verwundbar.
»Wir brauchten Ihre Kleidung, um Ihren Geruch zu analysieren.«
In mir krampfte sich schon wieder alles zusammen. Ernsthaft? »Wie bitte?«
»Ihr Geruch«, erklärte Professor Avalanche immer noch freundlich, drehte sich aber im Gehen nicht zu mir um. »Außerdem mussten wir ein paar Hautzellen von Ihnen bekommen, deshalb haben wir Sie Ihrer Kleidung entledigt. Keine Angst, das ist eine völlig schmerzfreie Prozedur, und man merkt es im Normalfall nicht. Der menschliche Körper verliert den ganzen Tag über abgestorbene Zellen. Wir haben sie mit einem kleinen Spatel abgetragen und die Duftmoleküle analysiert, ebenso wie den klassischen Geruch Ihrer Kleidung. Sie wissen ja, dass sich verschiedene Duftstoffe zu einem einzigartigen Körpergeruch mischen. Das Sekret Ihrer Schweißdrüsen, der Talg auf Ihrem Kopf und der natürliche Fettfilm Ihrer Haut.«
Ich hätte mir gerne vor Scham die Hand vor die Augen gehalten, weil er so unglaublich schmerzfrei über so ein sensibles Thema sprach und zu allem Überfluss ich der Mittelpunkt all dieser Erzählungen war.
»Wofür?«, stieß ich hervor.
»Ihr Ebenbild musste hundertprozentig perfekt sein. Es musste sogar riechen wie Sie. Nicht nur mittels Parfüm, sondern auch mittels der Millionen kleinster Duftmoleküle. Es ist im Grunde genauso wie bei Tieren. Tiermütter erkennen ihre Jungen am Geruch, und obwohl dieses Können in der menschlichen Rasse weitestgehend verloren gegangen ist, so besitzen wir doch sensible Zellen in unserer Nase, die Gerüche sehr genau unterscheiden können. Ganz besonders die Gerüche der Menschen, die uns nahestehen. Wir wollen ja nicht, dass Ihre Mutter misstrauisch wird. Dass sie anfängt zu suchen, obwohl sie gar keinen richtigen Grund hat. Wir wollten jedes Risiko von Beginn an ausschließen.«
Dann hatten sie wirklich einen Klon erschaffen, der jetzt mein Leben lebte? Würde er die anderen Alchemisten auch täuschen können? Mir wurde eiskalt vor Schock, und ich bekam nur flüchtig mit, wie wir das Labor verließen.
Tyson und Alistair schlossen schwere Feuerschutztüren hinter uns. Der Gang, den wir nun betraten, war eine Mischung aus Geschichte und Moderne. Antike Steintafeln, grob behauene Obelisken und Marmor, der in allen Facetten des Lichts schimmerte, war in Alkoven in den Wänden platziert. Dazwischen befanden sich immer wieder Türen, die zu weiteren Räumen oder Treppenhäusern führen mussten. Der Boden bestand aus schimmernden weißen Kacheln, die entfernt an Mondstein erinnerten. Die Fußleisten glänzten silbern, doch natürlich nahm ich an, dass hier in Wahrheit Quecksilber verbaut war. Die Logen schützten sich gegen Eindringlinge mit ihrem eigenen Element, damit Besucher geschwächt würden. Auch ich fühlte mich immer noch sehr wacklig. Ich hatte keine Ahnung, wie sie es geschafft hatten, das bei Raumtemperatur flüssige Element zu einem Feststoff zu wandeln, aber vermutlich war das eine der Fähigkeiten, die sie über die Jahrhunderte hinweg entwickelt hatten. Professor Avalanche ging immer noch voraus, zu seiner Rechten sein Sohn Tyson, zu seiner Linken July Mercury. Alistair trat an meine freie Seite, während Kyle offensichtlich meine Betreuung zugeteilt worden war. Er ließ es zu, dass ich mich umsah und mich sogar umdrehte, aber vermutlich befand ich mich in so einem erbärmlichen Zustand, dass ich sowieso keine Bedrohung darstellte. Wir bogen durch eine breite Tür ab und liefen nun einen Gang entlang, der mich stark an die Loge in Italien erinnerte. Geschäftsmäßig nüchterne Wände, ein schlichter dunkler Bodenbelag, Türen, die nicht beschriftet waren. Wieder schweiften meine Gedanken zu Ben. Ob ich ihn jetzt sehen würde? Würde ich jetzt endlich Gewissheit bekommen, dass es ihm gut ging?
Irgendwann mündete der Gang in eine Halle, die ähnlich imposant gestaltet war wie die Eingangshalle der Loge in Rom. Wie automatisch glitt mein Blick nach oben in Richtung der Kuppel. Doch hier bestand sie nicht komplett aus Glas, nur einige große Deckenfenster waren in den Beton eingelassen. Die Platten dazwischen waren mit Streben versehen und glänzten in einem matten Grau. Ich fragte mich, wo sie das Abbild der Schlange versteckten, die einen Teil des Steins der Weisen bildete. Doch dann endlich setzten sich die Fragmente vor meinen Augen zusammen. Ich musste wirklich sehr geschwächt sein, denn normalerweise erkannte ich Muster im Bruchteil von Sekunden. Hier waren es die Kacheln an der Wand. Sah man genau hin, setzten sie sich zu dem typischen Schuppenmuster einer Schlange zusammen. Sie schienen in allen Regenbogenfarben zu schillern, wenn das Licht darauffiel. Karate Kid Kyle ließ es zu, dass ich mich so weit in seinem Griff drehte, dass ich mich zur großen Eingangstür wenden konnte. Über den breiten Doppelschwingen prangte der Schlangenkopf, ebenfalls komplett aus Kacheln bestehend. Die Tür war riesig breit und bestimmt über vier Meter hoch. Alchemisten schienen echt ein Faible für hohe Räume zu besitzen. Ich hatte mal wieder das Gefühl, mich eher in einer Kathedrale zu befinden als in einem Raum, in dem Menschen lebten und arbeiteten. Professor Avalanche warf einen kurzen, sehr zufriedenen Blick auf mein Gesicht, das sicherlich Staunen und Bewunderung zugleich ausdrückte. Auch von dieser Halle gingen verschiedene Gänge ab, sodass sie vermutlich auch als Treffpunkt für Zusammenkünfte genutzt wurde. Ich hielt nach den antiken Gerätschaften Ausschau, die die zweite Hälfte des Steins der Weisen bildeten. Und richtig, ich entdeckte sie links von Professor Avalanche, gerade als wir unter einer Galerie entlanggingen.
»Das alles hier dürfte Ihnen ja vertraut sein.« Der Professor sprach wieder, ohne sich zu mir umzudrehen. »Sie waren schließlich oft genug in der Goldloge in Rom zu Besuch.« Die Verachtung, mit der er das Wort »Gold« aussprach, ließ sofort wieder die Wut in mir hochkriechen. Wir durchquerten die Halle, während ich mich weiter unauffällig umsah. Auch sie besaßen eine Sitzgruppe, die etwas versteckt im Schatten lag. Ob sie sich hier genauso gern trafen wie die Goldalchemisten? Verbrachten die Quecks ebenso gern Zeit nahe ihres Steins der Weisen? Eine hochmoderne Sicherheitstür glitt lautlos auf, als wir uns näherten.
Meine Neugier siegte schließlich. »Bitte. Wo gehen wir hin? Warum darf ich das nicht wissen? Ich finde das echt sehr unhöflich.«
Ich bekam keine Antwort.
Kyle schob mich erneut sanft vorwärts und wich meinem Blick geschickt aus. In diesem Gang roch es nach Desinfektionsmittel, und etwas Scharfes ließ meine Augen beinahe brennen. Eine toxische Mischung aus Chlor, Alkohol und beißenden Tensiden.
Ich kannte den Geruch nicht, aber etwas in mir schrie protestierend auf. Geh nicht weiter. Egal was er sagt, geh einfach nicht weiter. Ich stockte, machte wie automatisch kleinere Schritte, und Kyle und ich fielen etwas zurück. Unauffällig warf ich einen Blick auf die Türen, die rechts und links von dem ganz in weiß gehaltenen Flur abgingen. Sie waren nicht beschriftet. Was wohl dahinter verborgen lag?
Dann endlich. Auf einer einzigen Tür prangte ein Schild. Doch noch waren wir zu weit weg, um die kleine Schrift lesen zu können. Ich beschleunigte meine Schritte, und wieder passte sich Kyle meinem Tempo an. Noch ein Schritt ... noch ein Schritt ... ich neigte den Kopf. Eine Summenformel!
CH2O.
Formaldehyd? Was hatte das zu bedeuten? Es war eine der meisthergestellten organischen Chemikalien weltweit. Es wurde als Desinfektionsmittel benutzt – aber wofür noch? Warum wollte mir jetzt nicht mehr dazu einfallen? Mein Verstand schien nur noch auf Halbmast zu arbeiten. Ich hatte sogar Schwierigkeiten, die richtigen Worte zu finden. Lag es an dem Quecksilber? Hatte es wirklich einen so großen Einfluss auf mich?
Wir passierten auch diesen Raum und machten schließlich vor einer großen Doppelschwingtür halt. Zwei runde kleine Fenster, ähnlich wie Bullaugen auf einem Schiff, waren darin eingelassen. Doch bevor ich einen Blick hindurchwerfen konnte, stieß der Professor die beiden Türen auch schon schwungvoll auf. Was vermutlich auch besser war, denn nach einem ersten Blick ins Innere hätte ich diesen Raum nie betreten. Metallene, auf Hochglanz polierte Tische. Höhenverstellbare Arbeitsplatten, an denen es sogar Wasseranschlüsse gab und die mit kleinen Abflüssen bestückt waren. Neben manchen war eine Waage platziert oder Werkzeuge, die mich entfernt an OP-Besteck erinnerten. Ich holte vor Entsetzen scharf Luft und wandte den Kopf suchend nach rechts und links. Die Wände bestanden von oben bis unten nur aus schmalen quadratischen Eisentüren. Sie sahen aus wie Dutzende Fächer, in denen man ...
»O Gott.« Eigentlich hatte ich diesen Ausruf nur gedacht, aber dann war er mir wohl doch über die Lippen gekommen. Das hier war kein Labor. Es war eine Leichenhalle.
*
Professor Avalanche schien sich über meine Reaktion zu amüsieren. Er machte sogar eine Verbeugung. July und sein Sohn Tyson standen mit ausdruckslosen Mienen daneben, Alistairs Kiefer wirkte angespannt, und er fixierte einen Punkt auf seinen schweren Stiefeln.
»Ein kleiner Willkommensgruß von mir, verehrte Signorina Pandolfini. Und gleichzeitig ein kleiner Hinweis, wie wir mit denen umgehen, die sich uns in den Weg stellen.« Ohne hinzusehen, griff Flint Avalanche nach einem der Fächer. Der Riegel schnappte auf, und eine Bahre rollte hinaus. Der Körper darauf war komplett in ein weißes Laken gehüllt. Doch Professor Avalanche hatte so schwungvoll an der Bahre gezogen, dass der Körper darunter einen Stoß bekam. Plötzlich blitzte eine zierliche Hand unter dem Stoff hervor.
Weich geschwungene Symbole auf dunkler Haut.
Mein Herz setzte einen Schlag aus. Bitte mach, dass meine Augen sich täuschen.
Doch mein Gehirn ließ sich nicht bremsen.
Ich erkannte die Henna-Tattoos von Sanjena sofort. Es gab keinen Zweifel. Ich gab einen Laut von mir, der wie ein verwundetes Tier klang. Was hatte Sanjena mit alldem zutun? Was machte sie hier überhaupt?
Professor Avalanche griff nach der Hand, tätschelte sie auf makabere Weise und schob sie dann zurück unter das Laken. Ich hätte mich am liebsten übergeben.
»Sie haben sie umgebracht?«, stieß ich hervor, immer noch fassungslos und völlig schockiert von dem Anblick. »Warum?«
Professor Avalanche zuckte die Schultern. »Wir mussten an das Voynich-Manuskript und die Bausteine kommen, nachdem wir Sie und Ben etwas außerplanmäßig gefangen genommen haben. Sanjena war zufällig auf dem Vorplatz der Loge, und da kam mir spontan eine kleine Idee. Menschen, die lieben, sind so leicht zu erpressen. Man droht ihren ahnungslosen Eltern im fernen London, und schon tat sie alles, was ich von ihr wollte. Damit sie nicht alles verraten kann, haben wir Sanjena mitgenommen. Natürlich nur so lange, bis alles vorbei ist. Danach hätte sie ihrer Wege gehen können.« Der Professor seufzte gespielt betrübt. »Aber sie wollte fliehen, und dann gab es diesen kleinen unerfreulichen Zwischenfall ...« Er beendete den Satz nicht.
»Sie sind ja völlig wahnsinnig!«
»Vorsicht.« Professor Avalanche hob einen Zeigefinger und wedelte damit vor meiner Nase herum. »Sie wissen um Ihre Lage, Signorina Pandolfini. Noch sind Sie für uns von Nutzen. Noch ist Ihr Leben etwas wert. Das kann sich schnell ändern.«
»Glauben Sie wirklich, ich helfe Ihnen, wenn ich dann genauso enden werde wie Sanjena?«
»Glauben Sie, wir lassen Ihnen eine Wahl?«
»Ich verlange Antworten. Ich diskutiere nicht weiter mit Ihnen.«
Er gab der Bahre mit der Hüfte einen Schubs, und sie rollte zurück in ihr Fach. Dann warf er lässig die Tür zu und kam im nächsten Moment in meine Richtung spaziert. »Und ich diskutiere nicht mit Ihnen. Ich zwinge Sie. Das ist etwas ganz anderes.« Er zwinkerte mir zu, bevor er an mir vorbeiging und mich nicht weiter beachtete.
Ich schwang herum. »Womit wollen Sie mich erpressen?«
Professor Avalanche drehte sich nicht um. »Oh, bitte. Sie sind so ein Füllhorn an Gefühlen, was Ihre Familie und Ihre Freunde angeht. Jemanden wie Sie zu erpressen ist etwas für Anfänger. Leben Sie sich gut ein, Signorina Pandolfini. Wir sehen uns bald wieder.«
Der Luftzug der Doppeltüren wehte mir die Haare ins Gesicht. Der Professor und seine Entourage, bestehend aus seinem Sohn und seiner Scriptorin July, verschwanden aus meinem Blickfeld. Hinter mir räusperte sich Alistair, dann schoss er mit gesenktem Kopf und zackigem Schritt an uns vorbei, und nochmals schwangen die Doppeltüren auf, als auch er verschwand. Nur Kyle und ich blieben zurück.
Verstohlen sah ich mich erneut in dem nun menschenleeren Raum um. Die sterilen weißen Wände, die metallenen Tische, diese Fächer an den Wänden ... mein Magen rebellierte erneut. Meine Hände fühlten sich eiskalt an. Meine Sicht verschwamm, und mein Herz raste. Ich stand kurz vor einer Panikattacke. Ich war in einer verdammten Leichenhalle!
»Bring mich endlich weg von hier.« Meine Stimme klang gehetzt und überschlug sich beinahe.
»Natürlich«, murmelte Kyle. »Natürlich.«
In seiner Stimme hörte ich sowas wie Verständnis. Fühlte er sich hier etwa genauso unwohl wie ich? Wahrscheinlich musste ich froh sein, dass sie mir den einen Kerl zugeteilt hatten, der noch irgendwie zu Emotionen fähig schien.
»Ich will alleine laufen.«
Kyle seufzte. »Das wird nichts.«
Ich machte mich trotzdem von ihm los, ging drei Schritte, und schon wieder spürte ich die toxische Wirkung des Quecksilbers in meinem Blutkreislauf. Ich war mir inzwischen sicher, dass es nicht nur überall verbaut war, sondern dass sie es auch in die Luft gaben, genau wie es der Goldorden in ihrer Loge in Rom tat. Noch einen Schritt, noch einen Schritt ... Ich stieß mit den Händen gegen die Türen, doch das war anscheinend zu viel Kraftaufwand für meinen Körper, denn mir wurde schwindelig. Vermutlich wären mir beide Schwingtüren direkt vor den Kopf geknallt, hätte Kyle mich nicht gepackt und aus der Schusslinie gezogen. Er hob mich hoch und schien sich dabei nicht besonders anzustrengen. Mein Kopf knickte erst nach hinten und rollte dann mit der Schläfe gegen seine Schulter. Er roch nach Kardamom und frischem Ingwer. In jeder anderen Situation hätte ihn gefragt, mit was er sich so parfümierte, aber da er zu den Leuten gehörte, die mich entführt und eingesperrt hatten und sehr vermutlich bald töten würden, interessierte es mich nicht mehr.
»Du kannst nicht alleine laufen.« Er trug mich den langen, weißen Gang entlang, und ich blickte nach oben zur Decke, in der sich die Neonröhren wie ein immer wiederkehrendes Muster erstreckten. Ich klammerte mich mit meinen Blicken an ihnen fest und fokussierte mich auf ihre Regelmäßigkeit, die mich davon abhielt, vollständig das Bewusstsein zu verlieren.
»Ist es Absicht?« Ich hatte Mühe, die Worte zu formulieren. Ich wollte noch hinzufügen »das mit dem Quecksilber«, aber das funktionierte gerade irgendwie nicht.
»Natürlich«, erwiderte Kyle und klang irgendwie müde.
»Warum?«
»Die anderen Logen machen es genauso.«
Ich lachte auf, und mein Hals kratzte. »Du springst doch nicht von einer Brücke, bloß weil die anderen es machen?«
»Natürlich springe ich von einer Brücke, wenn meine Loge das auch macht.«
Wieder rollte mein Kopf gegen seine Schulter. »Freak.«
Das darauffolgende Geräusch hätte mich nicht mehr wundern können.
Kyle lachte. Es war ein leises, raues Lachen, aber es klang echt und wirklich amüsiert.
»Ich glaube, ich sollte dich wieder absetzen, bevor du noch frecher wirst.«
»Mach doch«, murmelte ich. »Ich kann prima alleine laufen.«
Noch mal so ein leises Lachen.
Meine Augen waren inzwischen halb geschlossen, doch auf einmal bemerkte ich etwas an der Deckenbeleuchtung. Neben den Neonröhren waren kleine Filter eingebaut. Doch sie schienen die Luft nicht zu reinigen – im Gegenteil – mir wehte jedes Mal ein feiner Luftzug ins Gesicht, wenn wir sie passierten. Daher kam also das Quecksilber! Deshalb war mir in diesem Gang so schlecht. Sie schienen einige Gänge besser als die anderen zu sichern, und hier pusteten sie das Zeug von der Decke aus in hoher Konzentration in die Luft.
»Na, dann wollen wir mal«, sagte Kyle, und ich rutschte von seinem Arm. Die Neonröhren verschwanden aus meinem Blickfeld, und dann war da eine Tür. Plötzlich befand ich mich wieder in der großen Eingangshalle mit der gekachelten Schlange, die den Raum mit ihrem Leib umspannte, als wollte sie sein Inneres mit ihrem Leben bewachen.
Endlich bekam ich wieder besser Luft.
Ich rieb mir über die Augen. »Gott, ist mir schlecht.«
»Ich bringe dich zurück in deine Zelle.« Kyle legte mir eine Hand auf die Schulter. Obwohl ich praktisch ständig an seinem Arm hing, wich ich manchmal noch intuitiv zurück, wenn er mich so selbstverständlich berührte.
Kyle deutete mein Zucken falsch. »Die Quecksilberkonzentration ist dort am geringsten.«
»Ich hätte so gerne einen Tee«, murmelte ich. Meine Mutter und ich tranken oft zusammen Tee. Mamma war ganz verrückt nach exotischen Sorten und den seltsamsten Kombinationen. Bratapfel mit Zimtstange, Orangenblüte mit Sternaniszucker. Ich hingegen konnte mich für die einfachen Sorten begeistern. Kamille, Pfefferminz, Earl Grey. Meine Gedanken drifteten von Sanjena, deren Schicksal mich so tief erschüttert hatte, zu Oliver, der der Experte für Tee in der Goldloge gewesen war. Die Goldloge ... Ben ... was machten sie nur mit ihm?
Ich sah Kyle direkt ins Gesicht. »Bitte. Bekomme ich einen Tee?«, flüstere ich. »Bitte?« Ich sehnte mich nach meiner Mutter, nach dem Gefühl von Zuhause und Geborgenheit.
Kyle hatte seine Mandelaugen zu Schlitzen zusammengezogen und den Kopf leicht schief gelegt. »Du weißt wirklich, wie man bekommt, was man will.«
Ich war zu benebelt, um den Charme in seiner Stimme zu erkennen. Also wiederholte ich meine Bitte. »Ich hätte bitte gerne einen Tee, wenn es denn keine Umstände machen würde, hochwohlgeborener Fechtmeister.«
Schon wieder sein leises Lachen. »Ich bin nicht adlig, obwohl meine Familie zu den ältesten Alchemistenfamilien der Erde gehört. Aber der Titel gefällt mir trotzdem.« Er sah mich noch mal prüfend an, als wolle er sichergehen, dass ich auf meinen eigenen zwei Beinen stehen konnte. »Ich kann dir nichts versprechen, aber ich werde sehen, was ich tun kann.«
Ich nickte. »Ich danke dir, Kyle.«
Es war das erste Mal, dass ich ihn beim Namen nannte. Kyle erwiderte zunächst nichts. Auch er schien die Veränderung zu spüren, die dies mit sich brachte. »Kein Problem, Emilia.« Er reichte mir den Arm. »Sollen wir?«
Wir wollten uns gerade umdrehen, da schwang die breite Eingangstür der Halle auf.
Blonde Haare, gebändigt in einem Man Bun, breite Schultern, ein umwerfendes Lächeln.
Sie waren zu dritt, aber ich sah nur ihn. Irgendetwas in mir zerbrach ein zweites Mal.
Meine Stimme war nur noch ein heiseres Flüstern. »Matti.«
Kapitel 3
Wir starrten einander an. Reflexartig machte ich mich von Kyles Arm los. Um mich herum schienen alle anderen Geräusche zu verblassen. In meinem Sichtfeld gab es nur noch ihn. Meinen besten Freund seit Kindertagen und doch jemand, den ich niemals wirklich gekannt hatte. Er war die größte Lüge meines Lebens.
Und es tat so verdammt weh.
Die zwei Jungs, die ihn flankierten, wirkten für einen Moment irritiert. Erschreckenderweise schienen sie Matti sehr gut zu kennen. Der eine klopfte ihm sogar auf die Schulter. Ich konnte mich nicht erinnern, dass Matti jemals von einem Ausflug in die USA erzählt hatte. Aber vermutlich war er, wie alle Alchemisten, mit dem Stein der Weisen gereist. Die Quecksilberloge von Rom besaß gewiss auch einen. Kein Flugzeug, keine stundenlange Anreise, keinerlei Kosten. Er hätte mir sagen können, dass er beim Rudertraining war, und gleichzeitig hier den Superbowl oder die Oscarverleihungen für einen Abend besuchen können. Das alles fühlte sich immer noch so surreal an. All diese scheinbar unmöglichen Dinge hatte mein Verstand noch gar nicht wirklich verarbeitet.
Aus Mattis Gesicht war alle Farbe gewichen. Sein Blick wanderte einmal an mir hinab und dann wieder hinauf. Ich wusste, wie ich aussehen musste. Leichenblass, mit ungekämmtem wirren Haar und in einem Anzug, in dem ich vermutlich wie ein Versuchskaninchen aussah.
Die Blässe auf seinen Wangen verschwand, stattdessen erschienen nervöse rote Flecken auf seinem Gesicht. Im nächsten Moment wirbelte er herum und war durch die große Hallentür verschwunden. Seine beiden Freunde sahen ihm etwas überrumpelt nach, dann stürzten sie hinterher.
Er hatte mich einfach stehen lassen.
»Gehen wir.« Kyle legte auffordernd eine Hand um meinen Oberarm, als fürchte er, ich würde Matti nachlaufen.
Zuerst war ich sprachlos, doch dann verwandelte sich all dieses Gefühl in Wut. »Matteo Giordano«, brüllte ich trotz anhaltendem Schwindel und Übelkeit. »Komm sofort wieder her.«
Kyles Griff um meinen Oberarm verstärkte sich, doch er murmelte ein paar beruhigende Worte, ohne dass er mir wehtat. Er sah zwar aus, als könne er Telefonbücher durchreißen, doch er schien seine Bärenkräfte gut unter Kontrolle zu haben.
»Sei vorsichtig mit dem, was du sagst«, murmelte er.
Aber ich war nicht mehr zu bremsen. Es sei denn, Kyle würde mir den Mund zuhalten. »Matteo Giordano«, rief ich erneut in Richtung der Tür. »Du kommst jetzt sofort wieder her. Weißt du noch, wer ich bin? Und hast du eine Ahnung, was ich mit dir mache, wenn du nicht sofort wieder umdrehst? Ich bin's, Emilia, deine beste Freundin. Wir haben uns in der Grundschule kennengelernt, und seitdem sind wir unzertrennlich. Und aus genau diesem Grund verlange ich jetzt, dass du mir erzählst, was zur Hölle hier los ist!« Meine Stimme war kontinuierlich höher geworden, sodass die letzten Worte fast klangen wie ein hysterischer Schrei.
»Du solltest dir gut überlegen, welch hohe Wellen du hier so lautstark schlagen willst«, sagte Kyle. »Du lebst länger, wenn du kooperierst.«
»Länger«, wiederholte ich, als ich mich ihm zuwandte. »Na, das sind ja tolle Aussichten.« Ich riss mich wieder von seinem Arm los. Die falsche Fürsorge konnte er sich auch sparen. Sie würden mich also nicht wieder gehen lassen. Sie würden mich genau wie Sanjena ausschalten, sobald sie meine Hilfe nicht mehr brauchten. Warum sollte ich ihnen diesen Gefallen tun? Es war ein fataler Gedanke, aber warum sollte ich nicht einen von ihnen so weit provozieren, dass er mir das Ende zukommen ließ, das mir sowieso blühte? Tyson hätte mich doch vorhin schon gerne erwürgt.
»Ich werde euch nicht helfen.«
Kyle sah mich nicht an, stattdessen glitt sein Blick an mir vorbei durch die Halle. »Du bist kein dummes Mädchen, Emilia. Also doch, du wirst uns helfen.«
»Nein.«
Kyle atmete tief durch, und dann hatte seine Stimme fast jegliche Farbe verloren, als er mir wieder direkt ins Gesicht sah. »Ich hätte dich für klüger gehalten.«
»Ich möchte endlich Ben Hastings sehen«, zischte ich.
»Warum? Er gehört nicht mal zu deinem Orden.«
»Weil ...« Was sollte ich ihm sagen? Weil ich mir Sorgen um ihn machte? Weil er mir wichtig war und ich Gefühle für ihn entwickelt hatte? Weil ich wahnsinnige Angst um ihn hatte?
»Du gehörst zum Silberorden. Du hast keinerlei Grund, dich um einen Alchemisten des Goldordens zu sorgen. Ihr habt nicht den Bund einer Tria Principia schließen können. Euch verbindet nicht dasselbe Blut, ihr habt nicht ein Stückchen eurer Kräfte geteilt. Er ist kein Teil deiner Seele geworden.«
»Aber ich ...« Ausweichend sah ich auf meine Sneakers. Wie sollte ich ihm das erklären?
»Du machst dich angreifbar, denn man kann jedes deiner Gefühle auf deinem Gesicht lesen wie in einem Buch.« Kyles Stimme war plötzlich weich geworden, und dann umgriff er sanft mein Kinn und hob es an, damit ich ihm wieder in die Augen sah. Ich war so überrascht, dass ich es geschehen ließ, ohne mich zu wehren. Da war ein bitterer Zug um seinen Mund, fast, als würde er dieses Gefühl kennen. Sehnsucht, die verboten war. Eine Liebe, die niemals erfüllt werden würde. Seine Verletzlichkeit verschwand und machte einer nichtssagenden Miene Platz. »Und wie gesagt, ich hätte dich für klüger gehalten.«
»Ihr werdet mich doch sowieso töten«, murmelte ich. »Ihr werdet mich umbringen, und ihr werdet Ben umbringen. Und ja, ich bin klug genug, um das schon herausgefunden zu haben. Oder willst du mir jetzt sagen, dass es nicht mit unserem Tod enden wird?«
Einen Moment lang sah Kyle mich völlig unbewegt an. Das tiefe Braun seiner Iriden schien mit seinen Pupillen zu verschmelzen, als sich ein irisierender Schimmer von rechts und links über die Hornhaut seiner Augen schob. »Glaub mir, Silberling, hier gibt es weitaus furchterregendere Alternativen als den Tod.«
*
Das Trampeln schwerer Sohlen erklang rechts und links von uns in der Halle. Kyle neben mir versteifte sich. Es waren Wachen, keine Frage, die dort auf uns zueilten. Sie hatten sogar Waffen dabei. Was zur Hölle stellten sie in dieser Loge her, das mit Feuerkraft beschützt werden musste?
Ein Typ mittleren Alters kam vor uns zum Stehen und salutierte dann kurz in Kyles Richtung. »Sie hat ein Logenmitglied bedroht. Wir sollen sie sofort in ihre Zelle eskortieren.«
Er sah mich nicht mal an.
»Das ist nicht nötig.« Kyle schien sofort zu verstehen. Er wirkte distanziert und kühl. »Ich übernehme das.«
Der Mann schluckte. Obwohl er doppelt so alt war wie Kyle, schien er nun nicht mehr ganz so forsch und autoritär – trotz seiner Tarnuniform. »Befehl des Meisters.«
»Verstehe.« Kyle seufzte.
Ich kam nicht mehr mit. Wen hatte ich bitte bedroht?
»Mitkommen.« Der Soldat schnippte, und sofort war ich von Männern in Tarnanzügen umringt.
»Ich habe niemanden beleidigt.« Mein Blick glitt fragend zu Kyle. Der schüttelte einfach nur den Kopf, als wolle er mir suggerieren, jetzt nicht mehr zu reden.
»Mitkommen.« Jemand stieß mich von hinten grob gegen den Rücken.
Ich war noch so voller Wut über Mattis feige Reaktion, dass ich mich umdrehte und blind zurückschubste. »Fass mich nicht an!«
Ein fataler Fehler, wie sich herausstellte. Kyle rief noch etwas, doch die Soldaten fackelten nicht lange. Das hochkonzentrierte Quecksilber drang blitzschnell in jede Pore. Ich hatte Mattis Gesicht vor meinem inneren Auge, als alles schwarz wurde.
Matti.
Er war die Enttäuschung meines Lebens.
Matti war ...
*