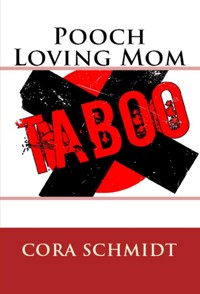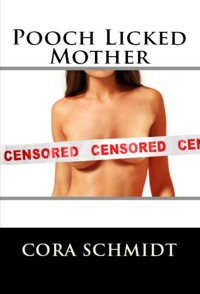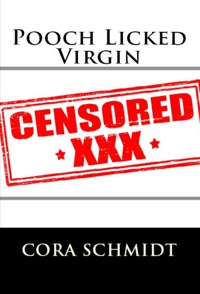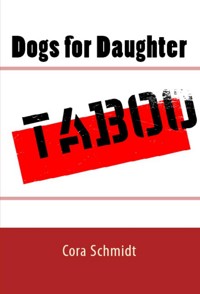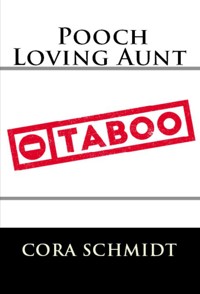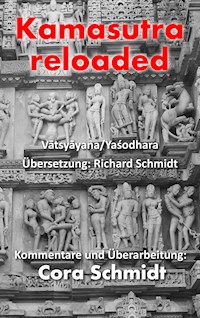
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Das Kamasutra ist neben Homers Versen das bekannteste antike Buch, und jeder hat eine Vorstellung von seinem Inhalt. Doch wer hat es gelesen? Hier ist die Chance, das ganze Buch in seiner wahren Bedeutung kennenzulernen, wie es der Indologe und Haller Hochschullehrer Richard Schmidt im späten 19. Jahrhundert erstmalig ins Deutsche übersetzt hat. Das Original gibt einen Einblick in Kultur und Lebensart Indiens vor vielen Jahrhunderten und würde heute als Kulturratgeber bezeichnet werden. Die Beschreibungen sind emotionslos übertragen - ganz in der Prüderie des deutschen Kaiserreichs. Der ursprüngliche Text ist zur leichteren Lesbarkeit mit Kommentaren* versehen, die erklärend, manchmal auch ironisch oder provokant sind. Einzelne Grafiken und Illustrationen tragen darüber hinaus zur Veranschaulichung und zu einem höheren Lesevergnügen bei. *da Fußnoten in einem eBook nicht praktikabel sind und je nach Reader unterschiedlich dargestellt werden. Für erwachsene Leser. Bis zum 14. Februar zum günstigen Sonderpreis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Kamasutra reloaded
Einleitung
1. Allgemeiner Teil
Kapitel 1
§ 1. Übersicht über das Buch.
Kapitel 2
§ 2. Die Erreichung der drei Lebensziele.
Kapitel 3
§ 3. Die Darlegung des Wissens.
Kapitel 4
§ 4. Das Leben der Elegants.
Kapitel 5
§ 5. Erörterung über die Freunde und die Befugnisse der Boten des Liebhabers.
2. Teil - Über den Liebesgenuss
Kapitel 1
§ 6. Darstellung des Liebesgenusses nach Maß, Zeit und Temperament.
§ 7. Die Arten der Liebe.
Kapitel 2
§ 8. Die Untersuchung über die Umarmungen.
Kapitel 3
§ 9. Die Mannigfaltigkeit der Küsse.
Kapitel 4
§ 10. Die Arten der Nägelwunden.
Kapitel 5
§ 11. Die Regeln für das Beißen mit den Zähnen.
§ 12. Die Gebräuche in den einzelnen Ländern.
Kapitel 6
§ 13. Stellungen beim Verkehr.
§ 14. Besondere Vereinigungen.
Kapitel 7
§ 15. Die Anwendung von Schlägen und
§ 16. Die Ausführung des dabei gebräuchlichen sīt-Machens.
Kapitel 8
§ 17. Vertauschter Verkehr (Rollentausch)
§ 18. Gewohnheiten des Mannes beim Verkehr.
Kapitel 9
§ 19. Über den Mundverkehr.
Kapitel 10
§ 20. Anfang und Ende des Liebesgenusses.
§ 21. Die verschiedenen Arten der geschlechtlichen Liebe.
§ 22. Liebesstreit.
3. Teil - Über den Verkehr mit Mädchen
Kapitel 1
§ 23. Die Regeln für das Freien.
§ 24. Die Prüfung der Verbindungen.
Kapitel 2
§ 25. Das Gewinnen des Vertrauens des Mädchens.
Kapitel 3
§ 26. Das Herangehen an ein Mädchen.
§ 27. Erklärung der Gebärden und des Äußeren.
Kapitel 4
§ 28. Die Bemühungen eines einzelnen Mannes.
§ 29. Das Aufsuchen des zu gewinnenden Mannes.
§ 30. Erlangung des Mädchens infolge der Annäherung.
Kapitel 5
§ 31. Die Hochzeitsfeier.
4. Teil Über die verheirateten Frauen
Kapitel 1
§ 32. Das Benehmen der einzigen Gattin.
§ 33. Der Wandel während der Reise des Mannes.
Kapitel 2
§ 34. Das Benehmen der ältesten Gattin gegenüber den Nebenfrauen.
§ 35. Das Benehmen der jüngsten Gattin.
§ 36. Das Benehmen der Witwe, die wieder geheiratet hat.
§ 37. Das Benehmen der zurückgesetzten Frau.
§ 38. Das Leben im Harem.
§ 39. Des Mannes Umgang mit mehreren Frauen.
5. Teil Über die fremden Frauen
Kapitel 1
§ 40. Darstellung des Charakters von Mann und Frau.
§ 41. Die bei den Frauen vom Glücke begünstigten Männer.
§ 42. Die mühelos zu gewinnenden Frauen.
Kapitel 2
§ 43. Das Anknüpfen der Bekanntschaft.
§ 44. Die Annäherungen.
Kapitel 3
§ 45. Die Prüfung des Wesens.
Kapitel 4
§ 46. Die Taten der Botin.
Kapitel 5
§ 47. Das Liebesleben der Herren.
Kapitel 6
§ 48. Das Treiben der Frauen im Harem.
§ 49. Das Beschützen der Frauen.
6. Teil - Über die Hetären
Kapitel 1
§ 50. Untersuchung über die Freunde, die Besucher, die nicht zu Besuchenden und die Gründe des Besuches.
§ 51. Das Gewinnen der Besucher.
Kapitel 2
§ 52. Die Hingebung an den Geliebten.
Kapitel 3
§ 53. Die Mittel für den Erwerb von Vermögen.
§ 54. Das Erkennen der Gleichgültigkeit.
§ 55. Das Verfahren bei dem Fortjagen.
Kapitel 4
§ 56. Die Wiederaufnahme eines ruinierten Liebhabers.
Kapitel 5
§ 57. Die verschiedenen Arten des Gewinnes.
Kapitel 6
§ 58. Prüfung der Folgen und des Risikos bei Gewinn und Verlust.
Anhang.
7. Teil - Die Upanisad (Geheimlehre)
Kapitel 1
§ 59. Das Bezaubern der Frauen.
§ 60. Das Gewinnen.
§ 61. Die Stimulantien.
Kapitel 2
§ 62. Wiedererweckung der erstorbenen Leidenschaft.
§ 63. Die Mittel, den Penis zu vergrößern.
§ 64. Besondere Praktiken.
Impressum neobooks
Kamasutra reloaded
Vātsyāyana (Autor 3. Jh.)
mit angefügten Kapiteln von Yaśodhara (13. Jh.)
Kommentare und Überarbeitung von Cora Schmidt
auf Basis der Übersetzung von Richard Schmidt (5. Auflage 1912)
Über die Abbildungen: Public Domain
'Creative Commons' - No Copyright This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighboring rights.
You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission.
Gemeinfreie Abbildungen: nach Maßgabe der 'Creative Commons'-Vereinbarung wurde festgestellt, dass die Inhalte frei jeglicher Beschränkungen des gesetzlichen Urheberrechts sind, einschließlich ähnlicher oder vergleichbarer Rechte und Gesetze (außer Marken- oder Patentrechte).
Die Abbildungen können - auch zu kommerziellen Zwecken - frei kopiert, verbreitet und verarbeitet werden.
Cover (Umschlagmotiv): Wandverzierungen aus dem Kandariya Mahadev Tempel in Khajuraho (Madhya Pradesh, Indien) aus dem 9. Jh.
Im folgenden findet der geneigte Leser das Kamasutram des Vātsyāyana über den Umgang im Damenverkehr, wie es der werte Herr J. W. Richard Schmidt im vorvergangenen Jahrhunderte übersetzte.
Es finden sich zahlreiche Anmerkungen, die dem Leser gestatten mögen, die Sprache der verblassten Zeit eines fernen Landes zu würdigen.
Richard Schmidt hat die Übersetzung mithilfe seines Wissens des indischen Subkontinents und seiner Geschichte und über die Davanagrischrift, allerdings auch unter dem Eindruck der Prüderie seines Jahrhunderts, übersetzt. Diese kursiven Textstellen weisen in moderner Ausdrucksweise auf möglicherweise unklare Formulierungen hin (zu Beginn mehr, später weniger). Im Hinblick auf den hohen Unterhaltungswert damaliger Ansichten und Ausdrucksweisen soll die ursprüngliche Übersetzung aber beibehalten werden.
Im Text wird an einigen Stellen, vor allem für Namen und spezielle Bezeichnungen, die diakritische Umschreibung verwendet. Es wird davon ausgegangen, dass eBook-Reader das fehlerfrei darstellen können. Ebenso finden sich vereinzelt Worte in Davanagri.
1. Allgemeiner Teil
§ 1. Übersicht über das Buch.
Dem Dharma, Artha und Kāma Verneigung!
Weil sie in dem Lehrbuche immer wiederkehren.
Ja, so machte man das. Das ursprüngliche Manuskript wird dem dritten Jahrhundert unserer Zeitrechnung zugeordnet (Analyse von Schriftproben). Heute findet man solche Danksagungen noch im muslimischen Gebet oder auch der Thanksgiving-Tradition.
Dharma ist also keine Figur einer TV-Serie, sondern das hinduistisches Lebensziel Geistlichkeit, Artha ist das Weltliche (Erwerb) und Kama (nicht Karma) die körperliche Erfüllung und Lust, deshalb heißt das Buch Kama Sutra,
In den Kommentaren von Yaśodhara, der das Manuskript im 13. Jahrhundert bearbeitet hat, wies er (sich ebenfalls vor dem Allwissenden verneigend) darauf hin, da es so viele Gottheiten gibt, dass diese drei (Lebensziele) wegen ihrer Wichtigkeit für das Buch herausgehoben wurden.
Verneigung auch den Lehrern, die das Wesen derselben zur Erkenntnis gebracht haben (avabodhaka).
Wegen der Verbindung damit.
Hier bezieht sich der Autor auf seine Quellen, obwohl es Urheberrechte damals wirklich nicht gab, und konkretisiert es im weiteren:
Prajāpati nämlich trug, nachdem er die Geschöpfe erschaffen hatte, vor ihnen die Satzungen der drei Lebensziele, als die Grundbedingung ihrer Erhaltung, in hunderttausend Kapiteln vor.
Davon sonderte Manu Svāyaṃbhuva einen Teil ab, der den Dharma betraf.
Bṛhaspati den Teil, der den Artha betraf.
Und des Mahādeva Diener Nandin lehrte gesondert in tausend Kapiteln das Lehrbuch der Liebe.
Dasselbe aber verkürzte auf fünfhundert Kapitel Auddālaki Svetaketu.
Dasselbe aber verkürzte wiederum auf anderthalbhundert Kapitel Bābhravya Pāñcāla in sieben Abschnitten, einem allgemeinen, einem über den Liebesgenuß, einem über den Verkehr mit Mädchen, einem über die verheirateten Frauen, einem über fremde Weiber, einem über die Hetären und einer Upaniṣad (Geheimlehre).
Davon behandelte Dattaka auf eine Aufforderung der Hetären von Pāṭaliputra hin den sechsten Abschnitt, den »über die Hetären«, gesondert.
Liest sich wie das alte Testament, aber es ist gleich vorbei.
Im Zusammenhang damit behandelte Cārāyaṇa den allgemeinen Teil besonders; Suvarṇanābha den Abschnitt über den Liebesgenuß; Ghoṭakamukha den Abschnitt über den Verkehr mit Mädchen; Go nardīya den Abschnitt über die verheirateten Frauen, Goṇikāputra den Abschnitt über fremde Weiber, Kucumāra die Upanisad. So ward dieses Lehrbuch von vielen Meistern stückweise abgefaßt und sein Zusammenhang unterbrochen.
Naja, das mit dem Zusammenhang ist auch so eine Sache, es geht ja nicht nur ums Poppen - das der rote Faden wäre -, sondern um die Lebensziele Dharma, Artha und Kama, das sind schon drei auch noch ineinander verwobene Fäden.
Weil nun dort die von Dattaka usw. verfaßten Abschnitte des Lehrbuches nur Bruchstücke sind, das des Bābhravya aber wegen seines Umfanges schwer zu studieren ist, wurde der ganze Stoff (von Vātsyāyana) zu einem kleinen Texte zusammengefaßt und so dieses Kāmasūtram geschrieben.
Aha, jetzt wissen wirs. Die Brüder Grimm waren nicht so ausführlich, wie und wo sie ihre Märchen zusammengetragen haben (auch weil es noch deutlich komplizierter gewesen wäre).
Es folgt das Inhaltsverzeichnis, wie es 1912 in (der fünften Ausgabe) der deutschen Übersetzung aussah:
Hier die Darlegung seiner Abschnitte und Paragraphen:
Übersicht über das Buch;
Erreichung der drei Lebensziele;
Darlegung des Wissens;
Leben des Elegants;
Erörterung über die Freunde und die Befugnisse der Botin des Liebhabers.
- So weit der erste, allgemeine Teil: fünf Paragraphen.
Darstellung des Koitus nach Maß, Zeit und Temperament;
Arten der Liebe;
Untersuchung über die Umarmungen;
Mannigfaltigkeit der Küsse;
die Arten der Nägelwunden;
Regeln für das Beißen mit den Zähnen;
Gebräuche in den einzelnen Ländern;
Arten der Lagerung während des Beischlafes;
absonderliche Weisen des Koitus;
Anwendung von Schlägen und die dabei gebräuchlichen Ausführungen des sīt-Machens;
der umgekehrte Liebesgenuß;
Stellungen des Mannes beim Liebesgenuß;
das Auparistakam;
Anfang und Ende des Liebesgenusses;
verschiedene Arten der geschlechtlichen Liebe;
Liebesstreit.
- So weit der zweite Abschnitt, über den Liebesgenuß: siebzehn Paragraphen.
Regeln für das Freien;
Prüfung der Verbindungen;
Gewinnen des Vertrauens des Mädchens;
das Herangehen an ein Mädchen;
Erklärung des Äußeren und der Gebärden;
die Bemühungen eines einzelnen Mannes;
das Aufsuchen des zu gewinnenden Mannes;
Erlangung des Mädchens infolge der Annäherung;
Hochzeitsfeier.
- So weit der dritte Abschnitt, über den Verkehr mit Mädchen: neun Paragraphen.
Benehmen der einzigen Gattin;
Wandel während der Reise des Mannes;
Benehmen der ältesten Gattin gegenüber den Nebenfrauen;
Benehmen der jüngsten Gattin;
Benehmen der Witwe, die wieder geheiratet hat;
Benehmen der Zurückgesetzten;
Leben im Harem;
des Mannes Umgang mit vielen Gattinnen.
- So weit der vierte Abschnitt, über die verheirateten Frauen: acht Paragraphen.
Darstellung des Charakters von Mann und Frau (und die) Gründe der Zurückhaltung;
die bei den Frauen vom Glück begünstigten Männer;
die mühelos zu gewinnenden Frauen;
das Anknüpfen der Bekanntschaft;
die Annäherungen;
die Prüfung des Wesens;
die Taten der Botin;
das Liebesleben großer Herren;
das Treiben der Frauen im Harem;
die Bewachung der Frauen.
- So weit der fünfte Abschnitt, über die fremden Weiber: zehn Paragraphen.
Musterung der Besucher;
Gründe des Besuchens;
Zurückweisen der Besucher;
Hingebung an den Geliebten;
Mittel für den Erwerb von Vermögen;
Kennzeichen eines Gleichgültigen;
Erkennen der Gleichgültigkeit;
Verfahren bei dem Fortjagen;
Wiederannahme eines Ruinierten;
Arten des Gewinnes;
Prüfung der Aussichten auf Gewinn und Verlust und des Risikos;
Arten der Hetären.
So weit der sechste Abschnitt, über die Hetären: zwölf Paragraphen.
Bezaubern der Frauen;
Gefügigmachen;
Stimulantien;
Wiedererweckung der erstorbenen Leidenschaft;
Mittel, den Penis zu vergrößern;
besondere Praktiken.
- So weit der siebente Abschnitt, die Upanisad: sechs Paragraphen.
Das letzte Kapitel, die Upanisad oder Geheimschrift, stammt nicht von Vātsyāyana, sondern wurde von Jaśodhara im 13. Jahrhundert angefügt.
So ergeben sich sechsunddreißig Kapitel, vierundsechzig Paragraphen und sieben Abschnitte (Teile). Tausend Sloken nebst einem Viertel.
Das ist die Übersicht über das Buch.
Nachdem diese kurze Übersicht desselben gegeben worden ist, wird nun die ausführliche Darstellung folgen: denn erwünscht ist den Wissenden hienieden eine gedrängte und (zugleich) eine breite Darstellung.
Dass das Inhaltsverzeichnis eher eine fließende Zusammenfassung des Buches (es ist durch die Zeilenumbrüche schon deutlich lesbarer gemacht) und seine Reihenfolge, wie wir sie heute erwarten, umgekehrt ist, liegt in der Schreibweise des Manuskripts begründet. Das ist nämlich ohne 'Punkt und Komma':
Abbildung aus dem Digitalarchiv (open source) der Chunilal Gandhi
Vidyabhavan (College), Surat (Gujarat, Indien)
Die Anmerkungen sind zu Anfang recht umfangreich, da die Zusammenhänge und (damalige) Gepflogenheiten der indischen Kultur erklärt werden, werden aber später kürzer, weil diese dann ja bekannt sind.
§ 2. Die Erreichung der drei Lebensziele.
Der Mann, dessen Lebensdauer hundert Jahre beträgt, teile seine Zeit und beschäftige sich mit der Dreizahl der Lebensziele, eins an das andere anknüpfend, ohne daß sie sich dabei untereinander beeinträchtigen.
Man kann sich denken, dass diese Angabe eine Wunschvorstellung war, doch ist zu überlegen, dass sich das Buch an die männlichen Mitglieder der obersten Kaste, den Brahmanen, richtet, und da war die medizinische Versorgung und Lebenserwartung (Klima, keine Industrie) bereits vor 2000 Jahren höher als in der westlichen Hemisphäre im vorletzten Jahrhundert (Degeneration, Industrialisierung). Die drei Lebensziele sind bereits benannt, und bitteschön eins nach dem anderen:
In der Kindheit (beschäftige man sich) mit der Erlangung des Wissens und ähnlichen Gegenständen des Artha.
Und in der Jugend mit der Liebe.
Im reifen Alter mit Dharma und Erlösung.
Die Reihenfolge ändert sich aber je nach Situation:
Oder man beschäftige sich mit ihnen, wegen der Unbeständigkeit des Lebens, wie es sich gerade trifft.
Genau, deshalb bieten heute Versicherungen und Kreditinstitute variable Konditionen an - als hätten sie das Kamasutra gelesen.
Man bleibt aber Brahmanenschüler bis zur Erlangung des Wissens.
In jeder Kaste gab es gemäß der Kommentare vier Stufen: den Brahmanenschüler, den Hausherrn, den Einsiedler und den Bettler. Heute ist diese Aufteilung der Jatis (Unterkasten) überholt, auch wenn das Kastenwesen noch existiert. Jaśodhara gibt eine verbindende Reihenfolge für die drei Lebensziele an: 'und zwar ist dabei nach der Meinung der Liebeskundigen die Liebe (Kama) als Ergebnis von Frömmigkeit (Dharma) und Erwerb (Artha) das erhabenste Ziel und die Krone des Ganzen.'
Dharma ist das lehrbuchsmäßige Anbefehlen von Opfern und ähnlichen Handlungen, die (aber) unterbleiben, weil sie nicht dieser Welt angehören und man (darum) keinen Erfolg sieht; sowie das lehrbuchsmäßige Abhalten vom Fleischgenuß und ähnlichen Handlungen, die (aber) geschehen, weil sie dieser Welt angehören und man den Erfolg sieht.
Was für eine Umschreibung für Sex, Drugs and Rock'n'Roll - weil sie dieser Welt angehören. Es stellt also Dharma dem Kama gegenüber - weil man bei Askese und Zölibat nicht weltlich belohnt wird, darüber sollte man sich aber vorher klar sein. Vātsyāyana lebte, wie er selbst am Ende des Buches angibt, in Keuschheit.
Diesen gewinne man aus der heiligen Überlieferung und dem Verkehr mit Rechtskundigen.
Erwerb von Wissen, Land, edlem Metall, Vieh, Getreide, Geschirrvorrat, Freunden usw. und Mehrung des Erworbenen ist Artha.
Diesen erwerbe man von dem Auftreten der Aufseher, den Kennern der Satzungen der Überlieferung und den Kaufleuten.
Das in der gehörigen Ordnung und je auf ihrem Gebiete stattfindende Wirken der in dem zur Seele gehörenden Empfinden zusammengefaßten (Sinne): Gehör, Gefühl, Gesicht, Geschmack und Geruch ist Kāma.
Die fünf großen G - an dieser Stelle mag man nicht glauben, wie es später noch abgeht, was man alles mit den fünf G des Kama anfangen kann.
Das erfolgreiche, infolge der besonderen Berührungen von der Wonne des Selbstbewußtseins begleitete richtige Empfinden derselben aber ist hauptsächlich Kāma.
Diesen lerne man aus dem Lehrbuche der Liebe und aus der Verbindung mit der Lebewelt.
Bei einer Kollision derselben ist immer der Vorangehende der Wichtigere.
Jaja, als wenn man einen Schritt zurückginge, wenn was schiefläuft. Das 'Lehrbuche der Liebe' ist das Kamasutra und die 'Verbindung mit der Lebewelt' die Erlaubnis 'probieren geht über studieren'.
Für den König der Artha, weil darin der Gang der Welt wurzelt; und ebenso für die Hetäre. – Soweit die Erreichung der drei Lebensziele.
Es soll so sein, dass die Oberbonzen und die Edelhuren sich angesprochen fühlen, für die die Erreichung der drei Lebensziele gilt, weil die anderen es gar nicht schaffen können.
Für den Dharma, der ja nicht dieser Welt angehört, ist ein Lehrbuch, welches darüber handelt, angebracht (und ebenso für den Artha), da er nur unter Beobachtung gewisser Regeln glücklich zustande gebracht wird. Die Regeln (aber) ersieht man aus dem Lehrbuche.
Es gibt also kein Dharma- oder Artha-Sutra. Als Hinweis meint Vātsyāyana vorzuschlagen, es genauso zu machen wie er.
Da jedoch sogar bei den Tieren der Kāma von selbst geübt wird und angeboren ist, so ist mit einem Lehrbuche (darüber) nichts anzufangen, sagen die Lehrer.
Also braucht es keinen Sexratgeber für Tiere …
Da (der Kāma) in der fleischlichen Vereinigung von Mann und Frau besteht, verlangt er ein Hilfsmittel.
… aber für Menschen, weil die sonst nicht wissen, wie es geht.
Und die Kenntnis dieser Hilfsmittel schöpft man aus dem Lehrbuche der Liebe, sagt Vātsyāyana.
Bei den Tieren dagegen findet die Ausübung (der geschlechtlichen Funktionen) ohne Hilfsmittel statt, da die Weibchen nicht versteckt gehalten werden, der Geschlechtstrieb während der Brunstzeit bis zur Befriedigung gebracht wird und (der Akt) von keiner Überlegung begleitet ist.
Na sowas, Tiere verstecken ihre Weibchen nicht und denken nicht über Sex nach, sondern haben ihn einfach. Also verschleiern sich muslimische Frauen und verlassen das Haus nicht, damit sie nicht wie Tiere auf offener Straße von den wilden Männchen bestiegen werden.
Man vollbringe keine Taten des Dharma, da der Lohn dafür erst künftig kommen soll und wegen der Zweifelhaftigkeit.
Denn welcher Nichtkindische würde wohl das in der Hand Befindliche einem andern einhändigen?
Besser heute eine Taube als morgen ein Pfau.
Besser als ein zweifelhafter Brustgoldschmuck ist ein unzweifelhaftes Goldstück - Das sind die Ansichten der Materialisten.
Das ist doch mal was anderes. Warum hat sich hier bloß dieser blöde 'Lieber ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach'-Vergleich durchgesetzt? Vermutlich, weil bei den wenigsten Leuten Pfauen im Garten spazieren und sie sich nicht mit Goldschmuck behängen - es war wie erwähnt ein Lehrbuch für die damalige High Society.
Da das Lehrbuch zum Mißtrauen keine Veranlassung geben kann; da man sieht, daß Behexung und Beschwörung bisweilen Erfolg hat; da man sieht, daß die Mondhäuser, der Mond, die Sonne und der Kreis der Planeten gleichsam mit Überlegung für die Welt wirken;
Später wird die besondere Bedeutung des Mondes noch benannt.
da das Treiben der Welt durch das Leben nach den Satzungen der Kasten und Stadien gekennzeichnet wird, und da man sieht, daß man den in der Hand befindlichen Samen um des künftigen Getreides willen auswirft, so vollbringe man die Handlungen des Dharma. So lehrt Vātsyāyana.
Ist das sowas wie 'Simon befiehlt'? Wenn er es nicht schreibt, gilt es nicht?
Man vollbringe keine Taten des Artha: denn selbst mit Mühe erstrebt werden Gelder (bisweilen) niemals erlangt; sogar ohne daß man danach strebt, kommen sie ganz von selbst.
Das alles wird vom Schicksal bewirkt.
Das Schicksal nämlich bringt die Menschen zu Reichtum und Armut, Sieg und Niederlage, Glück und Unglück.
Wenn man Artha nur als weltlichen Wohlstand betrachtet, ergibt es keinen Sinn, dass man nicht aktiv Einfluss nehmen kann, aber gemeint ist die innere Genugtuung als spirituelle Erfahrung seines äußerlichen Reichtums. Aber zwei Absätze tiefer nennt er den Ausweg.
Vom Schicksal wurde Bali zu Indra gemacht, vom Schicksal wurde er gestürzt; eben das Schicksal wird ihn auch wieder erhöhen. - Das ist die Meinung der Fatalisten.
Die Grundlage aller Betätigungen sind die Hilfsmittel, da sie von der menschlichen Wirksamkeit abhängen.
Auch ein notwendig erfolgendes Vermögen ist durch Hilfsmittel bedingt: ein Untätiger hat kein Glück. – So lehrt Vātsyāyana.
Man vollbringe keine Taten des Kāma, wegen ihrer Rivalität mit den beiden Hauptsachen Dharma und Artha und anderen trefflichen Menschen. Sie bewirken bei dem Menschen Verkehr mit Niedrigen, schlechte Unternehmungen, Unreinlichkeit und Vernichtung der Zukunft.
Ferner Nachlässigkeit, Leichtsinn, Mißtrauen (bei Anderen) und Meidung (seitens der Mitmenschen).
Man hört von vielen der Liebe Ergebenen, die sogar samt ihrer Begleitung untergegangen sind.
So ging der Bhoja namens Dāṇḍakya, welcher die Tochter eines Brahmanen beschlafen hatte, infolge der Liebe samt Sippe und Reich unter.
Der Götterkönig, der die Ahalyā; der übermächtige Kīcaka, der die Draupadī, und Rāvaṇa, der die Sītā (entehrte) und noch viele andere, die später lebten, sieht man, der Liebe ergeben, untergehen, - So ist die Meinung der Opportunisten.
Die Taten des Kāma stehen auf gleicher Stufe mit dem Essen, da sie das Gedeihen des Leibes bedingen; und sind die Frucht von Dharma und Artha.
Wie an den Nachteilen muß man lernen. Denn man unterläßt die Bereitung der Topfspeisen nicht, weil es Bettler gibt (die sie wegessen könnten); man unterläßt die Aussaat des Getreides nicht, weil es Gazellen gibt (die es abweiden könnten). - So lehrt Vātsyāyana.
Hier folgen einige Sloken:
Der Mann, der so dem Artha, dem Kāma und dem Dharma obliegt, der erlangt hier wie dort dornenloses, unendliches Glück.
Bei einer Tat, wo die Befürchtung nicht entsteht, was anderswo geschehen mag, und wo ein Glück erlangt wird, welches den Artha nicht tötet, bleiben die Edlen stehen.
Was die drei Lebensziele erreichen hilft, zwei oder auch nur eines, die Tat vollbringe man, aber nicht eine, die die beiden anderen schädigt.
Puh, wir haben also die Meinung der Materialisten, der Fatalisten, der Opportunisten und dazwischen ein paar Lehrsätze von Vātsyāyana. Man suche sich aus, was einem am nächsten ist.
§ 3. Die Darlegung des Wissens.
Der Mann soll das Lehrbuch der Liebe und dessen Nebenzweige studieren, ohne die richtigen Zeitpunkte für die Wissenschaften des Dharma und Artha, sowie deren Nebenzweige zu verpassen.
Die Frau vor der Jugendzeit, und, wenn hingegeben, nach der Meinung des Gatten. - Da die Frauen ein Lehrbuch nicht erfassen können, ist auch der Unterricht der Frauen in diesem Lehrbuche hier unnütz, sagen die Lehrer.
Starker Tobak, aber die Einschätzung, dass Frauen sowieso zum Lesen zu blöd sind, wird später wenigstens noch im Bezug auf die Hetären relativiert. Doch man sollte dem Verfasser zugestehen, dass er natürlich nur in dem Maße formulieren konnte, wie es seine Umgebung und Philosophie ihm vorgab, und das patriarchische System betrachtet Frauen der jeweiligen Kaste als unterwürfig. Aber es kommen noch 'bessere' Sprüche als das.
Immerhin fügt er an, dass es nicht seine Meinung, sondern die der Lehrer ist. Und dass es Vātsyāyana die Schamesröte ins Gesicht getrieben hat, so etwas zu behaupten, korrigiert er daraufhin, ohne die Aussage zu revidieren:
Aber die Praxis können sie erfassen; die Praxis aber beruht auf dem Lehrbuche. - So lehrt Vātsyāyana.
Das geschieht nicht nur hier: denn überall in der Welt gibt es nur wenige, die das Lehrbuch kennen; die Praxis aber gehört allen Menschen.
Nicht jeder konnte lesen und sich noch weniger Manuskripte leisten oder sich ihnen in Bibliotheken widmen, aber wie es mit dem Kama geht, wissen ja praktisch alle von den Tieren (§2).
Auch ist für die Praxis selbst ein fernstehendes Lehrbuch noch die Ursache.
Es gibt Grammatik: dabei wenden die Kenner des Opfers, die doch keine Grammatiker sind, bei den Opferhandlungen den ūha an.
Es gibt Astrologie: und doch vollbringen an den geeigneten Tagen (auch Nichtastrologen) ihre Werke.
Ebenso verstehen Rosse- und Elefantenlenker, die doch die Lehrbücher darüber nicht studiert haben, mit Pferden und Elefanten umzugehen.
Ebenso gibt es Könige: aber selbst weit entfernte Völker überschreiten die Schranken nicht: das ist ebenso.
Das erinnert an eingespielte Straßeninterviews in Nachrichtensendungen: damit wir erfahren, dass die ganz normalen Leute auch eine Meinung zu den Themen des Tages haben.
Es gibt freilich auch Frauen, deren Geist von dem Lehrbuche getroffen wird: die gaṇikā(-Hetären), die Töchter von Königen und die Töchter von hohen Beamten.
Von einer solchen Vertrauensperson lerne die Frau heimlich die Praxis, das Lehrbuch oder nur einen Teil.
Man gestatte zumindest diesen ausgewählten Frauen, an dem dritten Lebensziel zu kosten. Gaṇikā werden als besondere Hetären später noch in diesem und weiteren Paragraphen behandelt.
Als Mädchen lerne sie die zu den vierundsechzig Künsten in Beziehung stehenden und wiederholt anzuwendenden Werke in der Einsamkeit und allein.
Langsam wird’s knackig. Die 64 Künste kommen übrigens gleich. Hier erhalten die Mädchen erstmal einen Freibrief zur Erforschung ihrer eigenen Lust, von Selbstbefriedigung - aber nur im stillen Kämmerlein - ist aber noch keine Rede.
Die Lehrer aber der Mädchen sind: die zusammen aufgewachsene Milchschwester, die sich bereits mit einem Manne fleischlich vermischt hat; oder eine ebensolche Freundin, mit der man gefahrlos reden kann und eine gleichaltrige Tante; an deren Stelle eine vertraute alte Dienerin oder eine von früher her bekannte Bettelnonne und eine Schwester, wenn man ihr trauen kann.
Wie freundlich den Mädchen, die das Buch ja selbst gar nicht lesen können, mitzuteilen, wie sie erfragen dürfen, was das Kāma betrifft.
Gesang, Instrumentalmusik, Tanz, Zeichnen, das Einritzen von Zeichen, Verfertigen mannigfacher Linien aus Reis und Blumen, (kunstgerechtes) Blumenstreuen, Zähne und Gewänder zu färben, Auslegen des Bodens mit Juwelen, Herstellung des Lagers, Wassermusik, das Schlagen mit Wasser, wunderbare Kniffe, die verschiedenen Arten Kränze zu winden, die Anordnung von Diademen und Kronen, Toilettenkünste, die verschiedenen Arten die Ohren zu schmücken, das Mischen von Wohlgerüchen, das Anlegen von Schmucksachen, Zauberei, die Kniffe des Kucumāra, Geschicklichkeit der Hände, die Verfertigung der verschiedenen Arten von Gemüse, Brühen und Speisen, die Herstellung von Getränken, Fruchtsäften, Würzen und Likören, die Arbeiten des Webens mit der Nadel, das Fadenspiel, das Musizieren auf der Laute und der Trommel, Rätselspiel, Versespiel, das Hersagen schwerer Worte, das Vorlesen von Büchern, Kenntnis des Schauspieles und der kleinen Erzählungen, Ergänzung eines gegebenen Verses eines Gedichtes, die verschiedenen Arten, Zeug und Rohr zu flechten, Drechslerarbeiten, Behauen, Baukunst, Prüfen von Silber und Edelsteinen, Metallurgie, Kenntnis des Färbens und der Herkunft der Juwelen, Anwendung der Lehre von der Pflege der Bäume, Einrichtung der Kämpfe von Widdern, Hähnen und Wachteln, Sprechenlehren der Papageien und Predigerskrähen, Erfahrung im Frottieren, Massieren und Frisieren des Haares, das Erzählen vermittelst der Fingersprache, die verschiedenen Arten verabredeter Sprachen, Kenntnis der Dialekte, die Kunst der Blumenwagen, Kenntnis der Vorzeichen, Alphabet der Diagramme, Kenntnis des Abc der Gedächtniskunst, Zusammendeklamieren, Geistspiel, Anfertigung von Gedichten, Kenntnis des Lexikons, Kenntnis der Metrik, Kenntnis der literarischen Arbeit, Vortrag von Liedern unter Gestikulationen, das Verstecken in Kleidern, die verschiedenen Glücksspiele, das Würfelspiel, die Spiele der Kinder, und die Kenntnis der Wissenschaft des guten Tones, der Strategie und der körperlichen Übungen: das sind die vierundsechzig einzelnen Nebenzweige des Lehrbuches der Liebe.
Toll, oder? Es ist beruhigend zu wissen, dass das Schminken und Frisieren, Gedichteschreiben, Kenntnis der Dialekte, Musizieren, Metallurgie (wohl eher, um zu erkennen, ob Schmuck echt ist) und Blumenstreuen schon vor 60 Generationen zu den Künsten gehörte, mit denen Männer verführt werden. Und an 'Liebe geht durch den Magen' hat sich auch nichts geändert. Dass ein gutes Gedächtnis, Gestikulieren und Veranstalten von Tierkämpfen auch dazu gehört, ist heute wohl eher als exotische Nebenerscheinung zu sehen.
Die Vierundsechzig nach Pāñcāla sind anders. Deren Anwendungen werden wir in dem Abschnitte über den Liebesgenuß besprechen, indem wir ihnen nachgehen; denn die Liebe besteht ihrem Wesen nach aus ihnen.
Wir sind schon sehr gespannt.
Eine Hetäre, die sich durch diese auszeichnet und mit Charakter, Schönheit und Vorzügen begabt ist, bekommt den Titel gaṇikā und eine hohe Stellung im Kreise der Leute.
Geehrt ist sie stets bei dem Könige und bei den Trefflichen gepriesen; begehrenswert ist sie, des Besuchens würdig und ein Vorbild.
Der Berufsstand der Hetären war schon erwähnt. Es erschließt sich daraus, dass eine gut ausgebildete Konkubine ein hohes Ansehen genoss. Die beschriebenen freiberuflich Tätigen in Indien waren mit Kurtisanen vergleichbar und hatten nicht das Image, wie es Prostituierte pauschaliert heute haben. Vielleicht ist es besser verständlich, den Vergleich mit Geishas in Japan heranzuziehen. Die Maikos (Geisha-Schülerinnen) werden fünf Jahre lang in traditionellen Künsten ausgebildet, Zeremonien, Tanz, Gesang, Instrumente - wie bei den 64 Künsten. Gaṇikās waren meist an der Seite von Königen (derer es viele gab, daher würde 'Fürsten' zu unserer Vorstellung Adeliger besser passen) in deren Harems.
Die Tochter eines Königs und ebenso eines hohen Beamten, die sich auf (jene) Praktiken versteht, macht den Gatten sich geneigt, auch wenn er tausend Frauen im Harem hat.
Hört, hört. Merket auf, liebe Frauen, macht euch die 64 Künste zueigen, um Erfüllung für euch und euren Gatten zu erlangen.
Ebenso kann eine Frau während der Trennung von dem Gatten und wenn sie in schweres Mißgeschick geraten ist, sogar im fremden Lande von (diesen) Wissenschaften bequem leben.
Ein Mann, der in den Künsten erfahren, gesprächig und Schmeichler ist, findet das Herz der Frauen schnell, auch wenn er nicht bekannt ist.
Wenn man fremd ist, öffnen sich einem damit also Tür und Tor.
Infolge der Erlernung der Künste eben entsteht das Glück; je nach Ort und Zeit aber soll ihre Anwendung stattfinden oder nicht.
Aufdrängen soll man sich deshalb aber nicht.
§ 4. Das Leben der Elegants.
Nach Erlangung des Wissens und nach Gründung des Hausstandes für die Gelder, die man durch Geschenke, Siege, Handel oder Bezahlung erworben oder ererbt hat oder auch für beide, führe man das Leben eines Elegants.
Auch wenn es nach 'Bonze' und 'Neureicher' klingen mag (mal abgesehen davon, dass niemand mehr Land durch Kriegsführung gewinnt), gilt zu bedenken, dass das Buch sich an die Kaste der Brahmanen richtet, der Gelehrte und Priester, in moderner Auffassung auch Ärzte und Ingenieure, angehören
In einer Großstadt, einer Hauptstadt, einem Flecken oder einem großen (Orte) kann er leben, wo es treffliche Menschen gibt, oder (sonst wo) unter Berücksichtigung des Lebensunterhaltes.
Dort lasse er, mit Wasser in der Nähe, eine Wohnung mit einem Baumgarten, einem geräumigen Hofe für die Arbeiten und zwei Schlafgemächern bauen.
Erstmal die Grundvoraussetzungen …