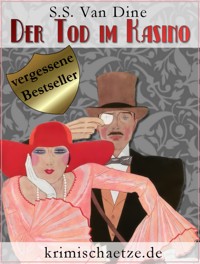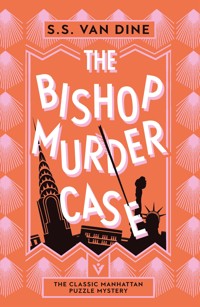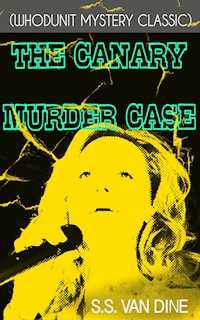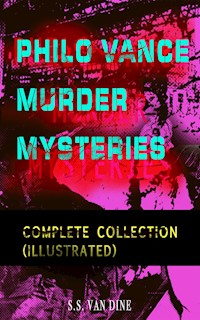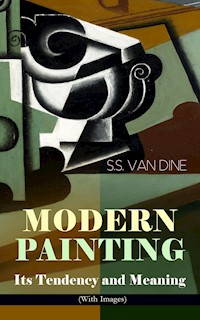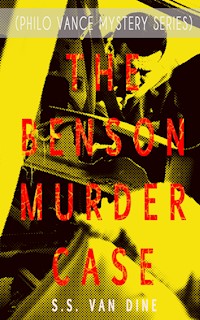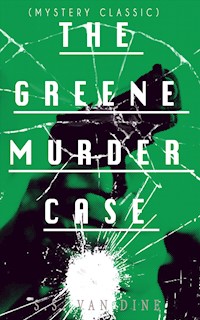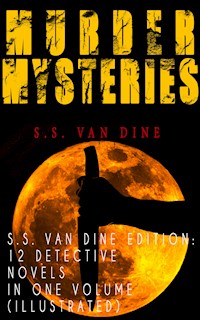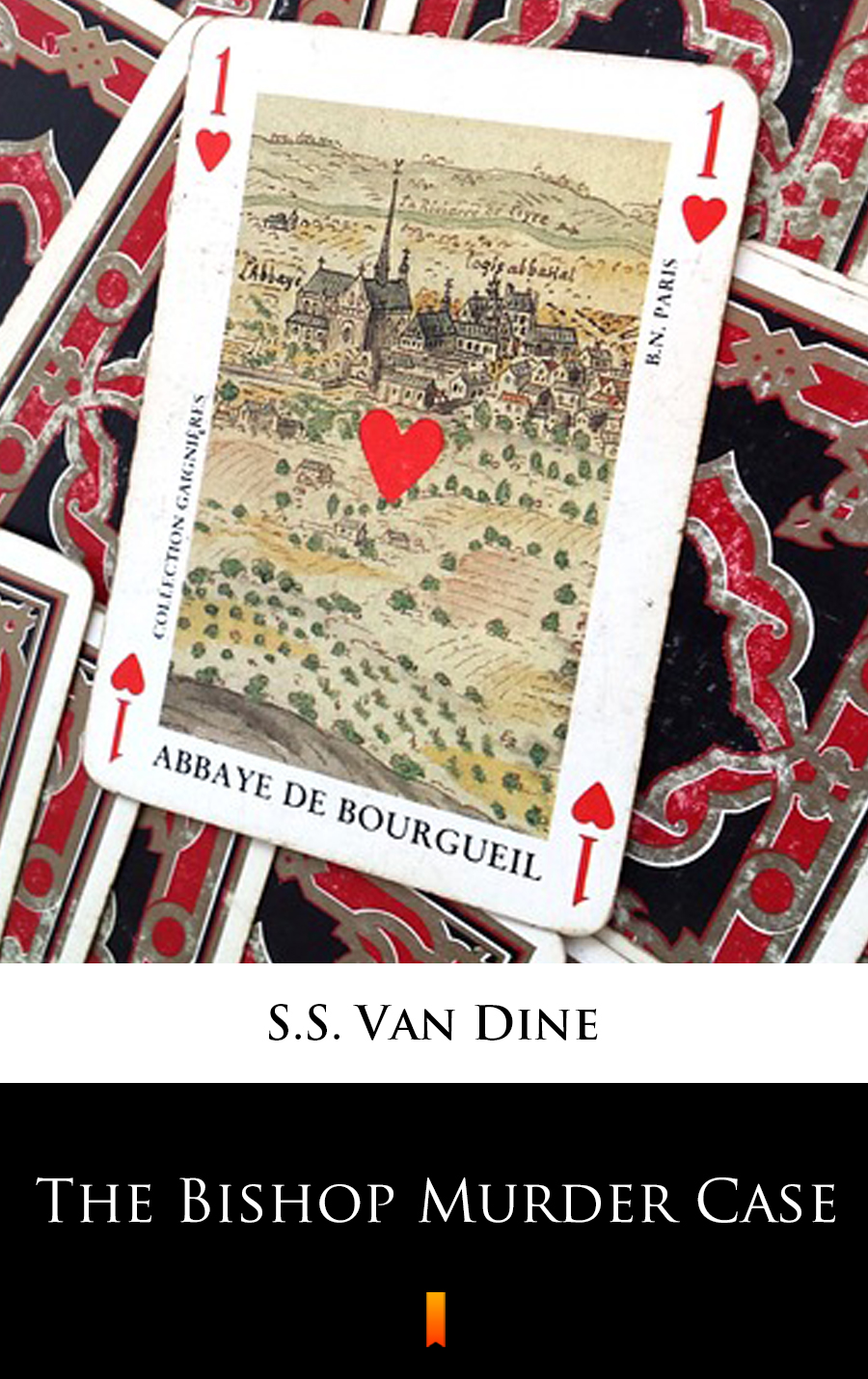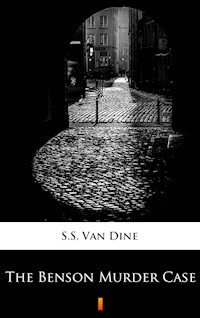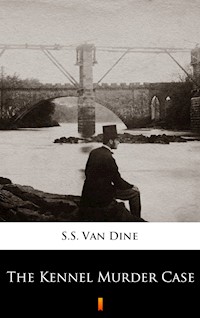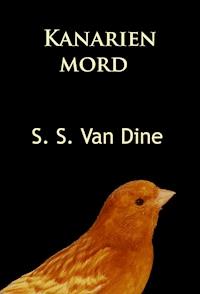
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: idb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der klassische Krimi ... Im Sekretariat der Kriminalabteilung der New Yorker Polizei, im dritten Stock des Polizeipräsidiums, befindet sich eine große Kartothek mit Stahlfächern. Dort, unter tausenden ihresgleichen, wird eine kleine grüne Karte aufbewahrt, auf der in Maschinenschrift steht: Odell, Margaret. 184 West – 71. Straße, 10. Sept. Mord: Gegen elf Uhr abends erwürgt. Wohnung durchstöbert. Juwelen gestohlen. Leiche von Amy Gibson, Bedienerin, entdeckt. Dies ist in ein paar dürren Worten die sachliche Feststellung eines der erstaunlichsten Fälle in der Kriminalgeschichte der Vereinigten Staaten, eines einzigartigen, widerspruchsvollen, genial ausgeführten Verbrechens, das viele Tage lang die besten Kräfte der Detektivabteilung und des Polizeipräsidiums völlig ratlos ließ. Jede Fährte, die die Untersuchung aufnahm, bewies anscheinend nur, daß niemand Margaret Odell ermordet haben konnte; aber die Leiche, die zusammengekrümmt auf dem großen, seidenbespannten Sofa in ihrer Wohnung lag, strafte diese groteske Mutmaßung Lügen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
S. S. Van Dine
Kanarienmord - Der Fall der Margaret Odell
Kriminalroman
idb
ISBN 9783961509218
Aus dem Amerikanischen »The Canary Murder Case«
Übersetzt von Hans Schiebelhuth
Der Kanarienvogel
Im Sekretariat der Kriminalabteilung der New Yorker Polizei, im dritten Stock des Polizeipräsidiums, befindet sich eine große Kartothek mit Stahlfächern. Dort, unter tausenden ihresgleichen, wird eine kleine grüne Karte aufbewahrt, auf der in Maschinenschrift steht: Odell, Margaret. 184 West – 71. Straße, 10. Sept. Mord: Gegen elf Uhr abends erwürgt. Wohnung durchstöbert. Juwelen gestohlen. Leiche von Amy Gibson, Bedienerin, entdeckt.
Dies ist in ein paar dürren Worten die sachliche Feststellung eines der erstaunlichsten Fälle in der Kriminalgeschichte der Vereinigten Staaten, eines einzigartigen, widerspruchsvollen, genial ausgeführten Verbrechens, das viele Tage lang die besten Kräfte der Detektivabteilung und des Polizeipräsidiums völlig ratlos ließ. Jede Fährte, die die Untersuchung aufnahm, bewies anscheinend nur, daß niemand Margaret Odell ermordet haben konnte; aber die Leiche, die zusammengekrümmt auf dem großen, seidenbespannten Sofa in ihrer Wohnung lag, strafte diese groteske Mutmaßung Lügen.
Margaret Odell gehörte zur Halbwelt-Boheme des Broadway. Die beiden letzten Jahre vor ihrem Tod war sie die auffälligste, in einem gewissen Sinn populärste Erscheinung im Nachtleben der Stadt. Ihre Berühmtheit rührte zum Teil von Gerüchten über Liebesaffären in Europa mit einer oder zwei unbekannten Fürstlichkeiten her. Nach ihrem ersten Erfolg in dem Singspiel »Das Mädchen aus der Bretagne«, durch den sie überraschend schnell zum Star aufgestiegen war, hatte sie zwei Jahre auf Reisen verbracht. Ihr Presseagent beutete, wie man sich denken kann, diese Abwesenheit in vollem Umfange aus, um phantastische Berichte über ihre Eroberungen in Umlauf zu setzen.
Die Erscheinung der Odell trug viel dazu bei, ihren etwas zweifelhaften Ruf glaubhaft zu machen. Ich erinnere mich, daß ich sie einmal im Autler-Klub, dem bekannten nachmitternächtlichen Treffpunkt der Vergnügungssüchtigen, tanzen sah. Sie erschien mir damals als ein Wesen von ganz ungewöhnlichem Reiz, trotz ihres berechnenden und gierigen Ausdrucks. Sie war mittelgroß, schlank, graziös wie ein Panther, ihre Manieren erschienen mir etwas hochmütig, was sich vielleicht auf jene, gerüchtweisen Beziehungen zu europäischen Fürstlichkeiten zurückführen ließ. Sie hatte das typische Gesicht einer Kokotte, geschminkte Lippen, lange schmale Augen – wollüstig und voll dunkler Geheimnisse –, eines jener Gesichter, die die Gefühlswelt des Mannes beherrschen, sein Denken unterjochen und ihn zu verzweifelten Taten treiben können.
Margaret Odell erhielt den Spitznamen »Der Kanarienvogel« nach einer Rolle, die sie in einem Ballett gespielt hatte, in dem die Tänzerinnen als Vögel auftraten. Ihr war die Partie des Kanarienvogels zugefallen; ihr Kostüm aus weißem und gelbem Satin, ihr üppiges, leuchtend goldnes Haar, ihr rosig weißer Teint verliehen ihr in den Augen des Publikums einen außergewöhnlichen Reiz. Ehe noch vierzehn Tage vergingen – so überschwenglich war das Lob der Zeitungen, und so einwandfrei galt der Applaus des Publikums vor allem ihr – wurde das »Vogelballett« in ein »Kanarienballett« verwandelt, und Miß Odell war erste Solotänzerin. Die Einlage eines Walzers für sie und eines Songs gaben ihr dann weitere Gelegenheit, ihre Reize und ihr Talent spielen zu lassen.
Am Ende der Spielzeit hatte sie die »Follies« verlassen. In ihrer folgenden glänzenden Laufbahn in den Nachtlokalen am Broadway wurde sie allgemein »Der Kanarienvogel« genannt. So kam es, daß, nachdem man sie von brutaler Hand erwürgt in ihrer Wohnung gefunden hatte, das Verbrechen sofort bekannt und »der Mord an dem Kanarienvogel« genannt wurde.
Meine persönliche Teilnahme an der Untersuchung dieses Falles – oder, genauer gesagt, meine Rolle als Zuschauer – gehört zu den denkwürdigsten Begebenheiten meines Lebens. Zur Zeit des Mordes an Margaret Odell war John F. Markham Polizeichef in New York. Dort war damals gerade, als unmittelbare Folge des Alkoholverbots, eine gefährliche und höchst unerwünschte Art Nachtleben aufgekommen. Eine Menge wohlfinanzierter Kabaretts, die sich »Nachtklubs« nannten, waren am Broadway und in dessen Seitenstraßen eröffnet worden, und eine beängstigende Anzahl schwerer Verbrechen, für deren Brutplätze man diese übelbeleumdeten Zufluchtstätten hielt, lag vor.
Markham war wochenlang in den regierungsfeindlichen Zeitungen aufs schärfste angegriffen worden, weil das Polizeipräsidium mangels ausreichender Beweise außerstande war, gewisse Verbrecher aus der Atmosphäre dieser Unterwelt zu überführen. So hatte er – ungeachtet seiner übrigen Amtsgeschäfte – beschlossen, seine persönliche Arbeitskraft den unerträglichen Kriminalverhältnissen zu widmen, und er zeichnete sich durch seinen geradezu unheimlichen Erfolg bei den Untersuchungen aus. Die Anerkennung jedoch, die ihm hierfür ausgesprochen wurde, war ihm im höchsten Grade peinlich. Denn als Mann vor ausgeprägtem Ehrgefühl schrak er davor zurück, der Kredit für Leistungen anzunehmen, die nicht voll und ganz seine eigenen waren. Tatsache ist nämlich, daß Markham lediglich die Rolle eines Mitarbeiters in den meisten seiner berühmten Kriminalfälle spielte. Das Lob für deren Lösung gebührte einem der nächsten Freunde Markhams Dieser aber verbat sich ausdrücklich, öffentlich genannt zu werden.
Dieser Mann war ein junger Aristokrat, für den ich aus Gründen der Anonymität den Namen Philo Vance gewählt habe. Vance war ein Mensch von erstaunlichen Fähigkeiten. Er war Kunstmaler in kleinem Stil, begabter Pianist und gründlich bewandert in allen Fragen der Ästhetik und Psychologie. Er war Amerikaner, hatte jedoch eine sorgfältige Erziehung in Europa genossen. Er verfügte über ein recht beträchtliches Einkommen und verbrachte viel Zeit mit der Erledigung seiner gesellschaftlichen Pflichten. Er war damals noch nicht fünfunddreißig und sah sehr gut aus. Leute, die ihn nur flüchtig kannten, hielten ihn für einen Snob. Ich aber stand ihm sehr nahe, und so war ich leicht imstande, den wirklichen Menschen in ihm zu schätzen. Ich wußte, daß sein Zynismus und seine Distanziertheit nicht Pose waren, sondern einer sensitiven und einsamen Natur entsprangen.
Im allgemeinen hielt sich Vance von den Angelegenheiten der Welt absichtlich fern. Er betrachtete das Leben wie sich ein leidenschaftsloser, aber innerlich amüsierter Zuschauer eine Theatervorstellung ansieht. Seine lebhafte intellektuelle Neugier trieb ihn, sich an Markhams Kriminaluntersuchungen zwar aktiv, jedoch inoffiziell, gewissermaßen als »amicus curiae«, zu beteiligen.
Fußspuren im Schnee
Sonntag, den 9. September
Der Stuyvesant Club wurde ganz in der Art eines renommierten Hotels betrieben. Seine zahlreiche Mitgliedschaft setzte sich aus politischen, juristischen und Finanzkreisen zusammen. Wir drei, Markham, Vance und ich, waren Mitglieder und trafen uns dort oft in einer verschwiegenen Ecke der großen Halle, um zu plaudern.
»Es ist schlimm«, bemerkte Markham an diesem Abend, »daß die halbe Stadt das Amt des Polizeichefs für eine Art oberste Sammelstelle hält. Ich hätte sonst wirklich nicht nötig, Detektiv zu spielen, bloß weil mir die Beamten keine zulänglichen Indizien liefern, um eine Überführung des Täters zu sichern.«
Vance blickte Markham spöttisch an. Über sein schmales, sehr bewegliches Gesicht huschte ein Lächeln.
»Die Schwierigkeit«, entgegnete er lässig, »liegt wohl darin, daß die Polizei in den Spitzfindigkeiten des juristischen Verfahrens nicht bewandert ist. Sie glaubt, daß Schuldbeweise, wie sie einen Durchschnittsmenschen überzeugen, auch einen Gerichtshof überzeugen müßten. So was ist natürlich albern. Ein Polizist denkt viel zu gerade, als daß er je den umständlichen Forderungen der Juristen gerecht werden könnte.«
»Ganz so schlimm ist es doch wohl nicht«, beschwichtigte Markham. »Gäbe es nicht Regeln zur Aufnahme einwandfreier Tatbestände, dann müßte mancher Unschuldige büßen. Selbst ein Verbrecher kann Schutz vor einer ungerechten Verurteilung verlangen.«
Vance gähnte gelangweilt. »Markham, du hättest Schullehrer werden sollen. Es ist erstaunlich, wie du eine Kritik mit Gemeinplätzen totschlägst. Ich bin keineswegs deiner Meinung. Entsinnst du dich jener Erbschaftssache in Wisconsin? Ein paar Interessenten hatten dafür gesorgt, daß ein gewisser Mann rechtzeitig von der Bildfläche verschwand. Die Gerichte erklärten den Verschollenen für tot. Eines Tages erschien er jedoch wieder und lebte gesund und munter unter seinen früheren Nachbarn. Sein Zustand als offizieller Toter konnte aber gesetzlich nicht geändert werden. Die offenbare Tatsache, daß er am Leben war, wurde von den Juristen für unwichtig gehalten ... Verlangst du wirklich, daß ein Laie das versteht?«
»Wozu diese akademische Dissertation?« fragte Markham ein wenig gereizt.
»Sie legt die Axt an die Wurzel des Übels«, erwiderte Vance gleichmütig. »Einzig die Tatsache, daß die Polizei juristisch ungebildet ist, hat deine gegenwärtigen Scherereien verursacht. Warum bringst du keinen Gesetzvorschlag ein, daß alle Kriminalschutzleute eine Rechtshochschule besuchen müssen?«
»Na, du bist mir ein schöner Gehilfe!« gab Markham zurück.
Vance zog die Augenbrauen leicht in die Höhe. »Die Anregung ist gar nicht zu übel. Ein Nichtjurist klammert sich an Tatsachen. Ein Gerichtshof aber hört sich freilich eine Masse wertloser Zeugenaussagen an und fällt dann seine Entscheidung nicht nach der wirklichen Sachlage, sondern nach pedantischen Vorschriften. Das Ergebnis: das Gericht läßt oft den Schuldigen laufen, und mancher Richter hat schon zum Angeklagten gesagt: Ich weiß, und das Gericht weiß es, daß du das Verbrechen begangen hast, aber mit Rücksicht auf die Beweise, die das Gesetz fordert, erkläre ich dich für unschuldig. Geh und sündige wieder!«
Markham brummte: »Ich würde mich kaum beliebt machen, wenn ich die Anwürfe gegen mich damit beantwortete, daß ich juristische Kurse für die Polizei vorschlüge.«
»Dann verrate mir wenigstens«, sagte Vance, »wie du den vernünftigen Befund der Polizei mit dem, was man feinsinnig die Korrektheit des juristischen Verfahrens nennt, in Einklang bringen willst.«
»Ich hatte gestern eine Konferenz mit meinen Bezirksvorstehern«, unterrichtete ihn Markham. »In Zukunft werde ich die Untersuchung in den wichtigsten Kriminalfällen der Nachtklubs selbst in die Hand nehmen. Ich werde mit allen Mitteln versuchen, Schuldbeweise, die ich zu Verurteilungen brauche, in die Hände zu bekommen.«
Vance nahm langsam eine Zigarette aus seinem Etui und tippte sie auf seine Stuhllehne.
»Aha! Du gedenkst also den Freispruch des Schuldigen durch die Aburteilung des Unschuldigen zu ersetzen?«
Markham fuhr ärgerlich herum und blickte Vance stirnrunzelnd an.
»Ich will nicht behaupten, daß ich diese Bemerkung mißverstehe«, sagte er bitter. »Du bist einmal wieder hinter deinem Lieblingsthema, der Unzulänglichkeit des Indizienbeweises, her.«
»Stimmt!« sagte Vance ruhig. »Dein kindlich reines Vertrauen in den Indizienbeweis macht mich tatsächlich wehrlos. Ich zittre schon für die schuldlosen Opfer, die du in deinen gesetzlichen Netzen fangen wirst. Schließlich wird es so weit kommen, daß der bloße Besuch eines Kabaretts zum Wagnis wird.«
Markham schwieg eine Zeitlang und rauchte. Die Bitterkeit, die gelegentlich in den Gesprächen der beiden aufkam, hatte keinen Einfluß auf ihre Stellung zueinander. Sie waren alte Freunde, und trotz der Verschiedenheit ihrer Temperamente und Standpunkte hatten sie im Grunde tiefe Achtung voreinander.
»Warum eigentlich verwirfst du den Indizienbeweis so restlos?« begann Markham wieder. »Zugegeben, daß er zuweilen in die Irre führt, aber er ist und bleibt die stärkste Handhabe, die wir Kriminaljuristen haben. Es liegt in der Natur des Verbrechens, daß unmittelbare Schuldbeweise beinah nie zu beschaffen sind. Wären die Gerichte auf sie angewiesen, dann befände sich die Mehrzahl aller Verbrecher auf freiem Fuß.«
»Ich habe den Eindruck, daß diese kostbare Mehrzahl sich ohnehin stets ihrer uneingeschränkten Freiheit erfreut.«
Markham überhörte diese Unterbrechung.
»Nimm ein Beispiel: ein Dutzend Erwachsene sehen einen Vogel durch den Schnee laufen. Sie bezeugen: es war ein Huhn. Ein Kind aber erklärt, es war eine Ente. Die Spuren im Schnee werden untersucht, die schwimmfüßige Fährte einer Ente wird festgestellt. Ist es dann nicht klar, daß der Vogel eine Ente und nicht ein Huhn war, trotz der überwiegenden direkten Zeugenangaben?«
»Na, ich schenke dir die Ente!« pflichtete Vance bei.
»Dein Geschenk wird dankbar angenommen. Nun ein Folgerungsbeispiel: ein Dutzend Erwachsene sehen eine menschliche Gestalt durch den Schnee fliehen. Sie beschwören, es war eine Frau. Ein Kind aber besteht darauf, es sei ein Mann gewesen. Nun, willst du nicht zugeben, daß also die Stapfen von Männerschuhen im Schnee den Beweis liefern, die Gestalt war tatsächlich ein Mann und nicht eine Frau?«
»Nie und nimmer, lieber Justinian«, erwiderte Vance und streckte behaglich seine Beine aus, »es sei denn, daß du beweisen kannst, daß der Mensch kein besseres Gehirn besitzt als die Ente.«
»Was haben denn Gehirne damit zu tun?« fragte Markham ungeduldig. »Gehirne beeinflussen doch Fußabdrücke nicht.«
»Entengehirne gewiß nicht. Aber Menschengehirne könnten es sehr wohl, und ohne Zweifel tun sie es sogar oft.«
»Hältst du mir da eine Vorlesung über Anthropologie oder spekulative Metaphysik?«
»Ganz und gar nicht«, versicherte Vance. »Ich rede von einer simplen, oft beobachteten Tatsache.«
»Schön! Würden also diese Männerfußtapfen nach deinem mit Scharfsinn entwickelten Denkprozeß einen Mann oder eine Frau beweisen?«
»Zwangsläufig keins von beiden«, antwortete Vance; »oder richtiger: die Möglichkeit von beiden. Dein Beispiel auf Menschen angewandt, das heißt auf Geschöpfe mit logischem Verstand, würde nur besagen: die Gestalt, die über den Schnee floh, war entweder ein Mann in seinen eigenen Schuhen oder eine Frau in Männerschuhen oder vielleicht sogar ein langbeiniges Kind, kurz: die Spuren stammen von irgendeinem Nachkommen des Pithecanthropus erectus, unbekannten Alters und Geschlechts, der Männerschuhe trug. Bei den Fährten der Ente aber würde ich dem Augenschein Glauben schenken.«
»Erfreulich«, entgegnete Markham, »daß du wenigstens die Möglichkeit ausschließt, die Ente könnte sich die Schuhe des Gärtners angezogen haben.«
Vance schwieg eine Weile, dann begann er wieder.
»Ihr modernen Solone versucht ständig, die Menschennatur auf eine Formel zu bringen. Tatsächlich aber ist der Mensch genau so wie das Leben unendlich kompliziert. Er ist gerissen und spitzfindig, seit Jahrhunderten in allen Teufelsschikanen geschult. Er lügt neunundneunzigmal, bevor er einmal die Wahrheit sagt. Eine Ente dagegen hat nicht die himmelstürmenden Vorteile der Zivilisation genossen, sie ist ein geradedenkender und ungemein ehrlicher Vogel.«
»Wie aber«, fragte Markham, »willst du ohne die üblichen Handhaben zu einer Feststellung über das Geschlecht und die Art der Person, von der die Männerspuren im Schnee stammen, gelangen?«
Vance blies einen Rauchring gegen die Zimmerdecke. »Zunächst würde ich mir alle Zeugenaussagen der zwölf kurzsichtigen Erwachsenen und des einen scharfsichtigen Kindes schenken. Dann würde ich die Fußtapfen im Schnee überhaupt nicht beachten. Und dann erst würde ich, ungetrübt vom Vorurteil zweifelhafter Zeugenaussagen, unbeeinflußt durch materielle Fingerzeige, die psychologische Natur des Verbrechens bestimmen, das die fliehende Person beging. Nach einer gründlichen Analyse könnte ich dir nicht nur sagen, ob der Täter ein Mann oder eine Frau war, sondern dir auch seine Gewohnheiten, seinen Charakter und seine Persönlichkeit beschreiben.«
Markham konnte ein Lächeln nicht unterdrücken. »Ich fürchte, du wärst noch schlimmer als die Polizei, wenn es darauf ankäme, mir brauchbare Tatbeweise zu beschaffen.«
»Jedenfalls würde ich nicht Indizien gegen eine harmlose Person beibringen, deren Stiefel sich der wirkliche Täter angeeignet hätte«, wandte Vance ein. »Denn solange du dich auf Fußtapfen verläßt, wirst du unausweichlich immer gerade die Leute verfolgen, die die Verbrecher von dir verhaftet sehen möchten und die nichts mit dem Verbrechen zu tun haben.« Er wurde plötzlich sehr ernst. »Glaube aber deshalb nicht, daß ich einen Heller für diese Theorie gebe, daß sich zur Zeit in den Nachtklubs eine Bande von Halsabschneidern zusammengerottet hat. Verbrechen entspringt nicht aus Masseninstinkten. Verbrechen ist ein persönliches, ein individuelles Geschäft. Man setzt sich nicht zu einem Mord zusammen wie zu einer Partie Bridge ... Und außerdem läßt heutzutage kein Verbrecher auch nur eine Fußspur zurück für deine Zollstöcke und Meßzirkel.« Er seufzte und sah Markham mit spöttischem Mitleid an. »Hast du überhaupt bedacht, daß dein nächster Fall einer ohne jegliche Fußspuren im Schnee sein könnte? He? Wie willst du ihn dann anpacken?«
»Ganz einfach«, schlug Markham ironisch vor, »ich würde dich mit auf die Untersuchung nehmen. Wie wär's damit, mein Lieber?«
»Ich bin begeistert von dem Gedanken«, sagte Vance.
Zwei Tage später brachten die Zeitungen der Metropole auf der ersten Seite in riesengroßen Überschriften die Nachricht vom Mord an Margaret Odell.
Der Mord
Dienstag, 11. Sept., 8½ Uhr vormittags
Es war knapp nach halb neun an jenem denkwürdigen Morgen des 11. September, als Currie, Vances Kammerdiener, mir meldete, daß Markham im Wohnzimmer sei. Ich lebte damals mit Vance zusammen in seiner Wohnung in East 38. Straße, zwei obere Stockwerke eines stattlichen Wohnhauses. An diesem Morgen war ich sehr früh aufgestanden und arbeitete bereits in der Bibliothek. Vance, der sich selten vor zwölf Uhr mittags erhob und jede Störung seines Morgenschlummers haßte, mußte erst geweckt werden.
Ich fand Markham erregt im Zimmer auf und ab gehend. Er war groß, breitschultrig und sehr muskulös, grauhaarig und glattrasiert: eine sehr vornehme Erscheinung. Seine Manieren waren zuvorkommend und liebenswürdig, verbargen jedoch die straffe, energische Strenge seines Wesens kaum. Er hatte mich gerade mit knappen Worten von dem Mord an dem »Kanarienvogel« unterrichtet, als Vance in einem reichgestickten Seidenkimono und Sandalen in der Tür erschien.
»Nanu?« begrüßte er uns erstaunt und sah auf die Uhr. »Seid ihr denn noch nicht im Bett?«
Er ging zum Kamin und zündete sich eine Zigarette an. Markhams Augen wurden schmaler. Er war zu Späßen nicht aufgelegt.
»Der Kanarienvogel ist ermordet worden«, platzte ich heraus.
»Wessen Kanarienvogel?« fragte Vance.
»Margaret Odell ist heute morgen erdrosselt aufgefunden worden«, verbesserte Markham brüsk. »Sogar du in deinem verführerischen Talar dürftest von ihr gehört haben. Du kannst dir die Sensation vorstellen. Ich bin unterwegs, um selber an Ort und Stelle nach meinen beliebten Fußspuren im Schnee zu suchen. Wenn du mitkommen willst, wie du mir letzte Nacht angedeutet hast, dann mußt du dich beeilen.«
Vance drückte seine Zigarette aus.
»Margaret Odell? Broadways blonde Aspasia? ... oder war es Phryne, die eine ›coiffure d'or‹ hatte.« Sein Interesse war erwacht. »Verdammt rücksichtslos von diesen Herren Verbrechern! Entschuldige mich, ich werfe mich in ein angemessenes Kostüm für diese Angelegenheit.« Er verschwand in sein Schlafzimmer.
Markham begann energisch eine lange Zigarre zu rauchen, während ich zu meinen Büchern zurückkehrte. Zehn Minuten später erschien Vance im Straßenanzug. »Voilà, mein Alter!« Der Diener reichte ihm Hut, Handschuhe und Spazierstock. »Allons!«
Margaret Odells Wohnung lag Haus Nr. 184 in der 71. Straße, ganz nahe beim Broadway. Als wir vor dem Haus hielten, mußte uns der dort postierte Schutzmann einen Weg durch die Menge bahnen, die seit der Ankunft der Polizei die Tür belagerte.
Feathergill, Markhams Assistent, wartete im Hausflur auf die Ankunft seines Chefs.
»Es ist ein Elend«, klagte er, »eine ganz verruchte Geschichte ... und gerade jetzt ...« Entmutigt zuckte er die Achseln.
»Kann ja sein, daß sich der Fall rasch aufhellt«, sagte Markham und schüttelte ihm die Hand. »Wie steht die Sache bisher? Sergeant Heath rief kurz nach Ihnen an und sagte, die Angelegenheit sähe auf den ersten Blick ziemlich verzwickt aus.«
»Verzwickt?« erwiderte Feathergill trübselig. »Sie ist völlig undurchdringlich. Heath ist angedreht wie eine Turbine. Inspektor Moran kam vor zehn Minuten und gab ihm den amtlichen Auftrag.«
»Na, Heath ist ja eine erste Kraft«, erklärte Markham. »Wir werden es schon schaffen. Welches ist die Wohnung?«
Feathergill zeigte auf eine Tür am Ende des Hausflurs. »Hier. Ich mache mich jetzt davon. Brauche Schlaf. Viel Glück!« – Und fort war er.
Eine kurze Beschreibung des Hauses und seiner Wohnungen wird hier notwendig sein. Es war ein vierstöckiger Backsteinbau älteren Datums, der offenbar umgebaut worden war, um den Ansprüchen an moderne Kleinwohnungen gerecht zu werden. In jedem Stock gab es drei bis vier getrennte Wohnungen. Der Tatort lag im Erdgeschoß, dort befanden sich drei Wohnungen und die Ordinationsräume eines Dentisten.
West 71. Strasse
Von der Straße trat man durch die Haupttür in einen langgestreckten Hausflur. An seinem entgegengesetzten Ende war die Tür zur Wohnung der Odell, die die Nummer drei trug. Rechts, ungefähr in der Mitte des Flurs, kam die Treppe zu den oberen Stockwerken. Ein Fahrstuhl war nicht im Haus. Hinter der Treppe, ebenfalls rechts, lag ein kleiner Empfangsraum mit offenem Türbogen. Linker Hand, der Treppe gegenüber, stand der Telefontisch mit der Schalttafel in einer kleinen Wandnische. Am Ende des Hausflurs führte ein schmaler Korridor nach rechts zu einem Nebeneingang, dessen Tür auf einen kleinen Hof an der Westseite des Hauses hinausging. Dieser kleine Hof war mit der Straße durch einen anderthalb Meter breiten Gang zwischen den Brandmauern verbunden.
In der Grundrißzeichnung kann die Anlage leicht eingesehen werden. Ich lege es dem Leser nahe, sie sich einzuprägen, denn ich bezweifle, daß je ein so einfacher und übersichtlicher Hausplan eine so wichtige Rolle in einem Kriminalrätsel gespielt hat.
Als Markham in die Wohnung der Odell trat, kam ihm Sergeant Heath mit ausgestreckter Hand entgegen. Ein Zug der Erleichterung ging über das breite, rauflustige Gesicht des Detektivs. »Bin froh, daß Sie kommen«, sagte er, und es bestand kein Zweifel, daß er es aufrichtig meinte. Mit einem herzhaften Lachen wandte er sich zu Vance, den er von einer früheren Unternehmung her kannte und schätzte, und hielt ihm die Hand hin. »Und die Amateurspürnase hält es auch wieder mal mit uns!«
»Sicher«, murmelte Vance. »Und wie arbeitet Ihre Induktionswalze an diesem schönen Septembermorgen, Sergeant?«
»Es wurmt mich, es Ihnen zu gestehen.« Heaths Gesicht wurde plötzlich sehr ernst. »Eine klotzige Kiste«, wandte er sich zu Markham. »Warum haben sich die Kerle grade den Kanarienvogel zum Abmurksen ausgesucht! Hol's der Geier! Am Broadway gibt's doch Singvögel genug, die sensationslos hätten verschwinden können!«
Während er weiterschimpfte, trat William M. Moran, der leitende Beamte der Kriminalabteilung, zu uns auf den Vorplatz und vollzog die übliche Zeremonie des Händeschüttelns. Obschon er Vance und mich nur einmal flüchtig getroffen hatte, erinnerte er sich an uns und sprach uns höflich mit Namen an.
»Sehr gut, daß Sie gekommen sind!« sagte er zu Markham. »Sergeant Heath wird Sie über die bisherigen Ergebnisse unterrichten. Ich selbst tappe noch ganz im Dunkeln ... bin eben erst gekommen.«
»Na, ich weiß ja selber noch nichts«, grollte Heath, während er uns ins Wohnzimmer geleitete.
Margaret Odells Wohnung bestand im wesentlichen aus zwei geräumigen Zimmern, die durch einen weiten, mit schweren Damastportieren drapierten Bogen verbunden waren. Durch die Eingangstür trat man zuerst in einen kleinen, anderthalb Meter breiten, drei Meter langen Vorraum, von dem eine breite Flügeltür mit venezianischem Glaseinsatz ins Wohnzimmer führte. Ein zweiter Eingang zu der Wohnung bestand nicht, und das Schlafzimmer konnte nur durch das Wohnzimmer erreicht werden.
Ein großes, mit Seidenbrokat bespanntes Sofa stand vor dem offenen Kamin, der in die linke Wand des Wohnzimmers eingebaut war. Die Rückseite des Sofas nahm ein langer Tisch aus eingelegtem Rosenholz ein. An der gegenüberliegenden Wand zwischen der Vorplatztür und dem Verbindungsbogen zum Schlafzimmer hing ein dreiteiliger sogenannter Marie-Antoinette-Spiegel über einem Klapptisch aus Mahagoni. Im Erker links vom Schlafzimmereingang stand ein kleiner Flügel. Die Ecke rechts neben dem Kamin nahm ein sehr eleganter Rokokoschreibtisch ein, neben dem sich ein viereckiger, handgemalter Papierkorb aus Pergament befand. Links vom Kamin stand einer der schönsten Bouleschränke, die ich je gesehen habe. Verschiedene ausgezeichnete Reproduktionen nach Bildern von Watteau, Boucher und Fragonard hingen an den Wänden. Das Schlafzimmer war mit Bett, Kommode, Toilettentisch und vergoldeten Polsterstühlen eingerichtet. Die ganze Wohnung trug den Stempel der zarten und zerbrechlichen Persönlichkeit des Kanarienvogels.
Einzige Tür zum Wohnzimmer der Odell
Als wir das Wohnzimmer betraten, stutzten wir einen Augenblick. Ein Schauplatz der Verwüstung lag vor uns. Die Wohnung war offenbar von irgend jemand in Hast durchstöbert worden.
»Nicht grade, was man peinlich saubere Arbeit nennt«, bemerkte Inspektor Moran.
»Na, wir dürfen noch froh sein, daß sie nicht die ganze Bude mit Dynamit in die Luft gesprengt haben«, gab Heath bissig zurück.
Aber die Unordnung interessierte uns vorläufig wenig. Starr blickten wir auf die Leiche der Odell. Sie lag in der uns zugekehrten Ecke des Sofas. Der Kopf hing, wie mit Gewalt zurückgerissen, über der Rücklehne. Das Haar fiel gelöst über ihre entblößte Schulter wie ein Katarakt flüssigen Goldes. Der Hals wies an beiden Seiten dunkle Druckstellen auf. Die Tote trug ein dünnes Abendkleid aus schwarzer Chantillyspitze auf cremefarbenem Chiffon. Über der Armlehne des Sofas hing ein Abendcape aus Goldbrokat mit Hermelinbesatz.
Margaret Odell hatte sich augenscheinlich erfolglos gegen ihren Mörder gewehrt. Die Haare waren zerrauft, ein Achselträger ihres Kleides war gerutscht, das feine Spitzengewebe zeigte einen langen Querriß über der Brust. Ein kleines Bukett von künstlichen Orchideen war abgerissen und lag zerknittert in ihrem Schoß. Einer ihrer Satinschuhe war vom Fuß geglitten. Die Finger waren noch gekrümmt, wie sie es im Augenblick des eintretenden Todes gewesen waren, als sie den Halt an den Handgelenken des Mörders verloren.
Der Schauder, der uns überlief, wurde durch Heaths sachlichen Ton unterbrochen. »Sie sehen, Mr. Markham, das Mädchen saß in der Sofaecke, als sie plötzlich von hinten angepackt wurde.«
Markham nickte. »Es muß ein ziemlich starker Bursche gewesen sein, daß er sie so leicht abwürgen konnte.«
»Das will ich meinen!« Heath deutete auf die Finger der Toten, die an verschiedenen Stellen Schürfungen zeigten. »Sie haben ihr ziemlich unsanft die Ringe abgezogen.« Er deutete auf das Stück einer dünnen, perlenbesetzten Platinkette, das auf der Schulter hing. »Da haben sie etwas gegrapst, was an ihrem Halse hing, und die Kette dabei zerrissen. Sie haben keine Zeit bei der Arbeit verloren, aber auch nichts übersehen. Gute Männerarbeit. Raffiniert und gründlich.«
Markham fragte nach dem Kriminalarzt.
»Wird gleich kommen«, meldete Heath. »Doktor Doremus geht nirgends ohne Frühstück hin.«
Wir wandten uns von dem niederdrückenden Anblick der Leiche ab und gingen nach der Mitte des Zimmers. Es hätte kaum schlimmer aussehen können, wenn ein Zyklon es verwüstet hätte.
»Geben Sie acht, daß Sie nichts anrühren«, warnte Heath. »Ich habe nach den Spezialisten für Fingerabdrücke geschickt; sie müssen jede Minute eintreffen.«
Vance sah mit spöttischem Erstaunen auf.
»Fingerabdrücke? Was Sie nicht sagen! Köstlich! Glauben Sie, daß in unsern aufgeklärten Tagen ein Mörder Fingerabdrücke zurückläßt, damit ausgerechnet Sie ihn finden?«
»Nicht alle Gauner sind klug«, erklärte Heath streitlustig.
»Gewiß nicht, sonst würde man keinen ertappen. Aber Fingerabdrücke beweisen doch keine Schuld; sie besagen nur, daß irgendwer irgendwo, irgendwann einmal herumgefingert hat.«
»Mag stimmen«, erwiderte der Sergeant unentwegt, »aber wenn ich ein paar blitzsaubere, kreuzbrave Fingerabdrücke aus diesem Wirrwarr hier kriege, dann kann sich ihr Eigentümer auf etwas gefaßt machen!«
Vance fuhr erschrocken zurück. »Sie machen mir ja angst und bange! In Zukunft werde ich Handschuhe tragen, wenn ich irgendwo Besuch mache. Wissen Sie, ich habe nämlich die Angewohnheit, immerfort Möbel und Teetassen und andern Krimskrams anzufassen.«
Markham schnitt die Erörterung ab und schlug vor, eine genaue Besichtigung vorzunehmen, bis der medizinische Sachverständige käme.
»Sie sind nach dem üblichen Schema verfahren«, knurrte Heath. »Erst das Mädchen kaltgemacht, dann die Siebensachen durchstöbert.«
Die Wohnung sah wirklich wüst aus. Kleider und andere Gegenstände lagen am Boden herum. Die Türen zu den beiden Garderobenräumen (es gab einen bei jedem Zimmer) standen offen; das Kleidergelaß im Schlafzimmer war ein wahres Chaos, das Beigemach des Wohnzimmers allerdings, das nur selten benutzt zu werden schien, war wohl übersehen worden. Die Schubladen des Toilettentischs und der Kommode waren auf den Boden ausgeleert; das Bettzeug war vom Bett gerissen und die Matratze umgekehrt worden. Zwei Stühle und ein kleiner Tisch waren umgeworfen. Verschiedene Vasen waren zerbrochen und machten den Eindruck, als hätte man etwas in ihnen vermutet und sie dann im Ärger über die Enttäuschung hingeschmissen. Der dreiteilige Spiegel im Wohnzimmer war zerbrochen. Der Schreibtisch stand offen, der Inhalt der Fächer war in einem wirren Haufen auf die Schreibunterlage entleert. Die Türen des Bouleschranks waren weit aufgerissen, inwendig sah es ebenso unordentlich aus wie im Schreibtisch. Eine Porzellanlampe mit schwerem Bronzefuß, die am Rande des Büchertisches stand, war umgekippt; ihr Seidenschirm hatte an der Stelle, wo er auf die scharfe Ecke einer großen silbernen Bonbonniere aufgeschlagen war, ein Loch.
In dem allgemeinen Durcheinander waren es besonders zwei Gegenstände, die meine Aufmerksamkeit anzogen: eine Dokumentenkassette aus Blech, wie man sie in jedem Schreibwarengeschäft kaufen kann, und ein großer Juwelenkasten aus Dünnstahl mit eingesetztem Sicherheitsschloß. Dieser Stahlkasten spielte eine seltsame Rolle in der künftigen Untersuchung.
Die entleerte Dokumentenkassette war auf den Büchertisch neben die umgekippte Lampe gestellt worden, der Deckel war zurückgeschlagen, der Schlüssel steckte noch im Schloß. Sie allein zeugte in dem ganzen Durcheinander dafür, daß die Wohnung nicht sinnlos, sondern planmäßig durchsucht worden war.
Der Juwelenkasten jedoch war mit Gewalt aufgebrochen worden. Er stand verbeult und zerkratzt auf dem Toilettentisch im Schlafzimmer, daneben lag ein gußeiserner Schürhaken mit einem Messinggriff, der offenbar vom Kamin des Wohnzimmers stammte.
Vance hatte sich nur oberflächlich umgesehen. Vor dem Toilettentisch aber hielt er plötzlich inne. Er zog sein Monokel heraus, setzte es sorgfältig ein und beugte sich über den aufgebrochenen Juwelenkasten.
»Ganz erstaunlich!« murmelte er und tippte mit seinem Goldbleistift auf den Deckel des Kastens. »Was sagen Sie dazu, Sergeant?«
Heath hatte Vance mit zusammengekniffenen Augen beobachtet. »Was denken Sie, Mr. Vance?«
»Sicher mehr, als Sie erraten können! Aber in diesem Moment spiele ich nur mit der Idee, daß dieser Stahlkasten nie und nimmer mit diesem Gußeisen aufgeknackt worden sein kann, was?«
Heath nickte zustimmend. »So ... das haben Sie also auch schon bemerkt. ... Verdammt recht haben Sie. Dieser Schürhaken kann bestenfalls den Deckel ein bißchen verbogen haben, aber das Schloß ist mit ihm bestimmt nicht aufgesprengt worden.«
Er wandte sich an Inspektor Moran: »Das ist das kleine Rätsel, weswegen ich nach Professor Brenner schickte. Das Knacken von diesem Sicherheitsschloß scheint mir erstklassige Berufsarbeit zu sein. Das war kein Anfänger, der das fertigbrachte.«
Vance studierte noch eine Weile die Kassette und wandte sich dann stirnrunzelnd ab. »Eine verteufelt verwickelte Sache muß sich letzte Nacht hier abgespielt haben!«
»Na, verwickelt wohl nicht!« bemerkte Heath. »Gründliche Berufsarbeit, aber das finde ich nicht so geheimnisvoll!«
Vance polierte sein Monokel, dann steckte er es weg.
»Wenn Sie auf dieser Grundlage weiterarbeiten, werden Sie Schiffbruch erleiden, Sergeant«, entgegnete er liebenswürdig.
Der Abdruck einer Hand
Dienstag, 11. Sept., 9½ Uhr vormittags
Wenige Minuten später traf Doktor Doremus, der medizinische Sachverständige, ein und gleichzeitig mit ihm drei andere Kriminalbeamte, von denen einer eine große fotografische Kamera und ein Stativ trug. Es waren Captain Dubois und Detektiv Bellamy, Sachverständige für Fingerabdrücke, und Peter Quakenbush, der amtliche Fotograf.
»Schau, schau!« rief Doktor Doremus aus. »Hier ist ja die ganze Sippschaft versammelt. Ihre geschätzten Freunde, Herr Inspektor, könnten sich auch eine vernünftigere Zeit zum Austrag ihrer Meinungsverschiedenheiten aussuchen ... Dieses Frühaufstehen bekommt meiner Leber nicht.« Er schüttelte jedem lebhaft die Hand. »Na, und wo liegt die Leiche?« Sein Blick fiel aufs Sofa. »Aha, eine Dame!«
Rasch untersuchte er die Leiche, indem er ihr Arme und Kopf, Hals und Finger bewegte, um die gewaltsame Todesursache festzustellen. Dann streckte er sie flach auf dem Sofa aus und begann eine gründliche Untersuchung.
Wir andern gingen derweil ins Schlafzimmer. Heath winkte den Fingerabdruckspezialisten.
»Gehen Sie gut über die ganze Bude und schenken Sie besonders diesem Juwelenkasten und dem Griff dieses Schürhakens Ihr Augenmerk. Dann muß auch die Dokumentenkassette im Wohnzimmer eingehend besichtigt werden.«
»Schon recht«, sagte Dubois. »Bellamy und ich fangen hier an, während der Doktor nebenan zu tun hat.«
Unser Interesse galt natürlich der Arbeit des Captains. Geschlagene fünf Minuten beobachteten wir, wie er die verbogenen Seiten des Stahlkastens und den Griff des Schürhakens inspizierte. Er setzte eine Uhrmacherlupe vor sein Auge und beleuchtete vorsichtig jeden Quadratzentimeter der Gegenstände mit einer kleinen Taschenlampe.
»Nicht die Spur von einem Abdruck«, meldete er. »Ganz blank gewischt.«
»Hätt' ich mir denken können«, brummte Heath. »Gute Berufsarbeit!« Er wandte sich an den andern Spezialisten ... »Irgend was gefunden, Bellamy?«
»Ein paar alte, verstaubte Schmierpfoten ... wertlos.«
»Sieht nach Pleite aus«, bemerkte Heath ärgerlich. »Na – hoffentlich finden wir nebenan was.«
In diesem Augenblick trat Doktor Doremus ins Schlafzimmer, nahm ein Bettlaken, ging ins Wohnzimmer zurück und bedeckte die Leiche. Dann klappte er seinen Instrumentenkasten zusammen, setzte seinen Hut auf und trat zu uns mit der Miene eines Mannes, der es äußerst eilig hat, fortzukommen.
»Ganz einfacher Fall«, erklärte er schnell. »Strangulation von hinten. Fingerquetschungen an der Kehle; Daumenquetschungen zwischen Nacken und Hinterkopf. Angriff war unerwartet. Schnelle, zuverlässige Arbeit, obwohl sich das Mädchen ein bißchen gewehrt hat.«
»Wie erklären Sie es, Doktor, daß das Kleid zerrissen ist?« fragte Vance.
»Ah! ... Kann ich nicht sagen ... Sie hat es wohl selber getan ... Instinktbewegung beim Ringen nach Luft.«
»Nicht sehr wahrscheinlich, wie?«
»Weshalb nicht? Das Kleid war zerrissen, das Bukett los ... Der Würger aber hatte beide Hände an ihrer Gurgel ... Sie muß es also selbst getan haben.«
Vance zuckte die Achseln und zündete sich eine Zigarette an.
Heath, etwas verärgert, stellte die nächste Frage: »Diese Schrammen an den Fingern bedeuten doch, daß ihr die Ringe abgezogen wurden?«
»Möglich ... sind frische Schürfungen ... da sind auch 'n paar Schrunden am linken Handgelenk, und der Handrücken ist leicht geschwollen, da ist wohl ein Armband abgezogen worden.«
»Paßt prima!« stellte Heath mit Befriedigung fest. »Und man hat ihr einen Halsanhänger abgerissen.«
»Wahrscheinlich«, bestätigte Doremus unbeteiligt. »Ein Stück der Kette hat sie hinter der rechten Schulter leicht ins Fleisch geschnitten.«
»Und wann fand der Mord statt?«
»Vor neun oder zehn Stunden ... Sagen wir gegen dreiviertel zwölf ... Vielleicht ein bißchen früher ... Bestimmt vor Mitternacht.« Der Doktor wippte ungeduldig auf den Zehenspitzen. »Sonst noch was?«
Heath überlegte. »Ich glaube, das ist alles, Doktor«, entschied er. »Ich schicke Ihnen die Leiche zur Obduktion. Geben Sie uns so bald wie möglich den Befund.«
Doktor Doremus verabschiedete sich mit Händedruck und stob davon. Heath folgte ihm zur Tür und beauftragte den Schutzmann draußen, nach einer Ambulanz für die Leiche zu telefonieren.
»Ein muntrer Medikus«, sagte Vance zu Markham. »Scheint außer seiner Leber keine Sorgen zu haben.«
»Ja, gegen ihn hetzt die Presse auch nicht ... Nebenbei: was bedeutete eigentlich deine Frage nach dem zerrissenen Kleid?«
Vance betrachtete gemütlich sein Zigarettenmundstück.
»Stell dir die Sache vor: die Odell ist offenbar überrascht worden. Denn wäre ein Kampf vorausgegangen, hätte sie nicht auf dem Sofa sitzend von hinten erwürgt werden können. Das Kleid mit dem Bukett war also intakt, als man sie anpackte. Aber dein smarter Paracelsus irrt, wenn er annimmt, sie habe sich die Schäden am Gewand selbst beigebracht. Wenn das Kleid sich über der Brust gespannt hätte, dann hätte sie sich die Taille selbst von innen nach außen aufgerissen. Aber du sahst selbst, die Taille ist intakt. Zerrissen ist nur das Spitzenkleid, das sie darüber trug, und zwar ist es zerrissen oder richtiger: aufgetrennt worden durch einen starken Ruck von der Seite. Unter den gegebenen Umständen war für die Odell jedoch nur eine Bewegung von oben nach unten oder nach außen möglich. Ferner«, fuhr er fort, »ist da das Blumenbukett. Hätte sie es selbst abgerissen, während sie erdrosselt wurde, dann wäre es bestimmt zu Boden gefallen. Du mußt im Auge behalten, daß sie sich gewehrt hat. Ihr Körper war seitlich verdreht, das Knie hochgezogen, ein Schuh abgeglitten. Es fällt doch so einem Bündel von Seidenblümchen nicht ein, während so heftiger Bewegungen auf dem Kleid liegenzubleiben. Sogar wenn Damen stillsitzen, rutschen bekanntlich ihre Handschuhe, Handtäschchen, Taschentücher, Konzertprogramme ständig zu Boden.«
»Wenn also dein Argument korrekt ist«, wandte Markham ein, »dann kann das Auftrennen des Spitzenkleides und das Abreißen des Buketts nur erfolgt sein, als sie schon tot war. Und es besteht kein Grund für einen so sinnlosen Vandalismus.«
»Deswegen eben«, seufzte Vance, »ist es ja so teuflisch verwickelt.«
Heath sah ihn scharf an. »Das haben Sie nun schon zum zweitenmal gesagt. Es ist doch ein ganz simpler Fall.« Er sprach im Ton eines Mannes, der sich selber gegen seine Unsicherheit bestärken will. »Das Kleid kann schließlich irgendwann zerrissen worden sein. Und das Bukett hat sich wohl so in die Spitze vernestelt, das es einfach nicht runterfallen konnte.«
»Und wie erklären Sie den Juwelenkasten?« fragte Vance.
»Na ja ... Der Kerl hat erst den Schürhaken probiert, und als es damit nicht ging, hat er halt das Brecheisen genommen.«
»Wenn er schon das Brecheisen in der Tasche hatte, warum machte er sich dann erst die Mühe und holte dieses alberne Gußeisen vom Kamin herüber?«
Der Sergeant schüttelte den Kopf. Er war aus der Fassung gebracht.
»War sonst noch was, das Ihnen verwickelt vorkam, Mr. Vance?« fragte er schließlich. Geheime Zweifel schienen nun in ihm die Oberhand zu gewinnen.
»Ja, die Lampe auf dem Wohnzimmertisch.«
Heath drehte sich um und sah durch den Türbogen die umgekippte Lampe mit verständnislosem Blick an.
»Das sagt doch nichts; sie ist halt umgestoßen worden ...«
»Aber es besteht kein Grund dafür«, stellte Vance fest. »Sehen Sie, Sergeant, die allgemeine Unordnung hier beweist, daß der Platz durchsucht worden ist. Sie stimmt mit der Annahme eines Raubüberfalls überein. Aber die Lampe paßt nicht ins Bild. Sie ist eine falsche Note. Es ist ganz ausgeschlossen, daß sie während des Todeskampfes umgeworfen wurde. Sie hat nicht den geringsten Grund zum Umkippen gehabt, ebensowenig wie der hübsche Spiegel