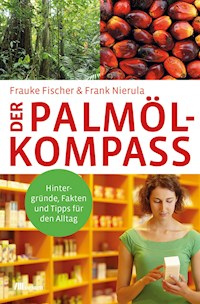Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: oekom verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Künstliche Intelligenz kann Texte schreiben, Bilder generieren und selbstständig lernen – aber kann sie auch Wälder retten, Tierstimmen übersetzen oder Pflanzen gießen? Während Maschinen immer schlauer werden, verbrauchen sie Unmengen an Energie und Rohstoffen. Doch was, wenn sie der Natur nicht nur schaden, sondern ihr auch helfen könnten? Die Biologin Frauke Fischer und die Wirtschaftswissenschaftlerin Hilke Oberhansberg nehmen uns mit auf eine unterhaltsame Reise dorthin, wo sich Hightech und Natur treffen. Können wir bald mit Delfinen sprechen? Warum ist ein Babyhirn schlauer als jeder Supercomputer? Und welche KI schützt Nashörner vor Wilderern? Erstaunlich, lehrreich und mit einer guten Portion Humor – ein Buch für alle, die Natur lieben, Technik spannend finden und wissen wollen, wohin die Reise geht! »Dieses Buch stellt die wichtigste Frage der Zeit: welche Kombination von Intelligenz brauchen wir jetzt zum Überleben? Denn eigentlich ist es ein No-Brainer: Gesunde Menschen gibt es nur auf einer gesunden Erde.« Dr. Eckart v. Hirschhausen, Arzt, Wissenschaftsjournalist und Gründer der Stiftung Gesunde Erde-Gesunde Menschen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
natürlich oekom!
Mit diesem Buch halten Sie ein echtes Stück Nachhaltigkeit in den Händen. Durch Ihren Kauf unterstützen Sie eine Produktion mit hohen ökologischen Ansprüchen:
mineralölfreie DruckfarbenVerzicht auf PlastikfolieFinanzierung von Klima- und Biodiversitätsprojektenkurze Transportwege – in Deutschland gedrucktWeitere Informationen unter www.natürlich-oekom.de und #natürlichoekom
https://www.oekom.de/verlag/natuerlich-oekom/c-37
Wir danken der Stiftung »Forum für Verantwortung« für die großzügige Förderung der Publikation.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
© 2025 oekom verlag, München
oekom – Gesellschaft für ökologische Kommunikation mbH mit beschränkter Haftung
Goethestraße 28, 80336 München
+49 89 544184 – 200
Umschlaggestaltung: Stefan Hilden
Illustration Chamäleon (Umschlag und Innenteil):
HildenDesign, Veronika Wunderer
Lektorat: Laura Kohlrausch, oekom verlag
Korrektorat: Petra Kienle
Typografie & Satz: Ines Swoboda, oekom verlag
Druck: Friedrich Pustet GmbH & Co. KG,
Regensburg
Alle Rechte vorbehalten
Printed in Germany
ISBN 978-3-98726-163-3
https://doi.org/10.14512/9783987264474
FRAUKE FISCHER, HILKE OBERHANSBERG
KANN KIDIE NATUR RETTEN?
EINLEITUNG
TEIL I Eine kurze Geschichte der Intelligenz
1Wissensvorsprung
Evolution: Eine Geschichte von Zeit und Zufall • Von der Feuerstelle zur Mikrowelle • Und plötzlich ging alles ganz schnell • Wir machen es halt anders
2Natürlich genial
Was ist Intelligenz? • Neugierig? • Zufällig genial
3Künstlich intelligent
Kluger Schachzug • Jetzt wird aber ma sch(i)nell gelernt • Wofür steht das I in KI?
TEIL II Technischer Support für die Natur
4Wo liegt das Problem?
Von welchen, die auszogen, das Fürchten zu lehren
5Was kann KI?
Sammeln • Beobachten • Managen • Überzeugen
6Schöne neue Welt
Vertrauen wir mal der Ziege • Dr. Doolittle • Birke vor Gericht
TEIL III Der Haken an der Sache
7Der Blick auf die Stromrechnung
8Früher war mehr
9Schwierige Datenlage
EIN PLÄDOYER ZUM SCHLUSS
Anmerkungen
Bild- und Grafiknachweis
Über die Autorinnen
Einleitung
Die menschliche Intelligenz hat uns an den Rand des Sechsten Massenaussterbens geführt. Kann künstliche Intelligenz uns helfen, dessen Eintreten noch zu verhindern?
Auf unserem langen Weg vom ersten aufrechtgehenden, menschenähnlichen Wesen in den ostafrikanischen Savannen vor etwa sieben Millionen Jahren bis zu heutigen Computer-Nerds in glitzernden Hochhäusern ist viel passiert.1 Und zwar nicht nur mit uns: Durch unsere technologische Entwicklung haben wir die Biosphäre und Atmosphäre dramatisch verändert. Wo sich früher uralte Wälder erstreckten, stehen heute Milliardenstädte. Wo einst Millionen Bisons grasten, staut sich heute der Verkehr auf achtspurigen Autobahnen. Wo unerschöpflich erscheinende Fischbestände existierten, sind selbst riesige Meeresgebiete arm und leer.
Ja, unser Wissen darüber, wie Ökosysteme funktionieren und wie wichtig sie sind, ist ebenfalls rasch gewachsen. Aber: Die Lücke zwischen der Geschwindigkeit und Dimension des Problems (dem Verlust von Biodiversität und Ökosystemleistungen) und der Geschwindigkeit und der Dimension der notwendigen Lösungen (dem Erhalt und der Wiederherstellung unserer Lebensgrundlagen) wird immer größer.
Um diese Lücke zu schließen, bauen viele Menschen (auch) auf Künstliche Intelligenz. Sie hoffen auf mehr Wissen, mehr Verstehen und wirklich schlaue Lösungen. Und seien wir mal ehrlich: Die haben wir auch bitter nötig. Dabei dürfen wir allerdings nicht in Fallen treten, die die Probleme – absichtlich oder unabsichtlich – sogar noch verschärfen.
All dem wollen wir in diesem Buch nachgehen. Dafür beschreiben wir im ersten Teil, wie sich das alles entwickelt hat – die Biodiversität, zu der auch wir Menschen gehören, und die KI. Wir schauen, was an der Natur genial und an KI intelligent ist, was beide können und vor wem wir mehr Respekt haben sollten (oder: um wen wir uns mehr Sorgen machen sollten). Im zweiten Teil hat die KI ihren heldenhaften Auftritt. Wir erklären, wo Naturschutz und Biodiversität mit Hilfe kluger KI-Anwendungen erfolgreicher werden können und wir wieder zu einem gesünderen Umgang mit der uns umgebenden Welt kommen. Der dritte Teil beschreibt, worauf wir dabei achten müssen, wo Grenzen oder Gefahren liegen und wie wir am besten mit ihnen umgehen sollten, damit »gut gemeint« auch »gut gemacht« wird.
Haben wir beim Schreiben dieses Buchs KI benutzt? Klar, aber jeder Satz in diesem Buch wurde von echten Menschen geschrieben. Wir haben bei allen Zahlen und Fakten auf wissenschaftliche Primärliteratur zurückgegriffen. Die Artikel und Studien haben wir alle selbst gelesen. Wir haben uns nichts von einer KI zusammenfassen oder formulieren lassen. Alle Fotos in diesem Buch sind echt. Alle Fotos? Nein, ein einziges ist KI-generiert. Viel Spaß beim Suchen.
TEIL IEine kurze Geschichte der Intelligenz
Hier lernen wir LUCA und den blinden Uhrmacher kennen. Und wir erfahren, warum Langeweile uns manchmal ordentlich voranbringt, warum manche Menschen lieber sterben, als ihre Neugier unbefriedigt zu lassen, und wie wir am Ende sogar versucht haben, unsere Intelligenz in Computer zu stecken.
KAPITEL 1 Wissensvorsprung
Am Anfang war der Urknall. Ganz so weit wollen wir nicht zurück. Aber bevor wir klären, ob KI die Natur retten kann, werfen wir einen Blick in die Vergangenheit und zeigen, wie sich Natur und KI entwickelt haben und was sie heute sind. Was trennt sie, wo sind sie sich sehr ähnlich? Und was ist wirklich genial oder intelligent an ihnen? Dabei fangen wir mit der natürlichen Entwicklung – der Evolution – an.
Während das gesamte Wissen der Menschheit in Köpfen, Bibliotheken und Datenbanken von Menschen gebündelt ist, ist das Wissen der Natur in Genen, Arten und Ökosystemen sowie den Prozessen, die sie miteinander verbinden, gespeichert – also in der Vielfalt des Lebens auf unserem Planeten, kurz der Biodiversität (siehe Kasten Seite 13).
In einem Prozess, den man Evolution des Lebens nennt, verändern sich Arten, Ökosysteme und ökologische Prozesse. Dieser Prozess läuft seit mehr als vier Milliarden Jahren ab und hat seinen Anfang in Mikroorganismen genommen – genauer gesagt vermutlich einem einzigen klitzekleinen Mikroorganismus. Im Laufe der Zeit sind daraus so wunderbare Lebewesen wie Paradiesvögel oder Passionsblumen entstanden, aber auch Prozesse und Abläufe, die uns in Erstaunen versetzen und von denen wir viel lernen können. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass die Natur immer noch einen gigantischen Wissensvorsprung vor uns hat.
Das Wissen der Menschheit steckt in Köpfen, Büchern, Datenbanken – das der Natur in Genen, Arten, Ökosystemen.
In seinem 1802 erschienenen Buch Natural Theology (Natürliche Theologie) leitete der englische Philosoph und Theologe William Paley aus der »Uhrmacher-Analogie« ab, dass es einen Schöpfer geben müsse. Sein Argument: Fände man auf einem Feld einen Stein, so ist die Annahme naheliegend, dass der natürlichen Ursprungs sei. Fände man aber etwas Komplexes wie eine Uhr, so wäre eindeutig, dass sie jemand erschaffen haben müsse.
Kein Schöpfer, sondern Zufall formte diesen Körper.
Und weil Organismen komplizierten Uhren eher ähneln als einfachen Steinen, sei auch im Fall von Organismen klar, dass sie von jemandem geschaffen worden sein müssten. So weit, so logisch – und doch so falsch.
So verrückt das klingt und so unwahrscheinlich es für manche Menschen erscheinen mag: Egal wie ästhetisch manche Tiere, Pflanzen, Pilze und Mikroorganismen aussehen, ihre Entstehung ist einer Reihe von Zufällen geschuldet. Zeit und Zufall machen unsere Biosphäre zu dem fantastischen Ort, der er ist. Und ganz nebenbei zu dem einzigen uns bekannten Ort im Weltall, an dem wir leben können. In ihm steckt ein Wissensvorsprung aus vier Milliarden Jahren Evolution.
Evolution: Eine Geschichte von Zeit und Zufall
Evolution bezeichnet die allmähliche Veränderung vererbbarer Merkmale von Generation zu Generation. Über lange Zeiträume entstehen so neue genetische Varianten innerhalb von Arten, irgendwann sogar neue Arten. Durch Evolution entstehen auch Interaktionen, Symbiosen, ökologische Prozesse und Abläufe – und damit ganze Ökosysteme.
Leben auf der Erde gibt es womöglich schon seit 4,29 Milliarden Jahren. Alles deutet darauf hin, dass das Leben auf unserer Erde nur einmal entstanden ist: Alles Leben eint ein universeller genetischer Code, der Prozess der Proteinbiosynthese, der Aufbau der universellen 20 Aminosäuren und die Verwendung von Adenosintriphosphat (ATP) als gemeinsame »Energiewährung«. Alles uns bekannte Leben hat also einen gemeinsamen Ursprung. Wissenschaftliche Daten weisen darauf hin, dass der letzte universelle gemeinsame Vorfahr aller Lebewesen auf der Erde vor etwa 4,2 Milliarden Jahre existierte. Entsprechend der englischen Bezeichnung »last universal common ancestor« heißt er übrigens LUCA.
Seit LUCA den Planeten bewohnte hat sich ordentlich was getan. Während manche von LUCAs Nachfahren einfache Bakterien oder andere Einzeller blieben, weisen andere kaum noch Ähnlichkeit mit LUCA auf. Sie haben sich zu Orchideen, Tiefseeanglerfischen, Pilzen, Fadenwürmern, Gorillas oder Menschen entwickelt. Innerhalb unserer Art sind wir übrigens ziemlich homogen: Alle Menschen auf der Welt sind zu 99,9 Prozent genetisch identisch.
Was ist Biodiversität?
Biodiversität bezeichnet die Vielfalt des Lebens aus unserem Planeten, auf der Ebene von Genen (Variation innerhalb von Arten), Arten (Variation zwischen Arten) und Ökosystemen (Variation zwischen Lebensräumen, den dort vorkommenden Arten und den Prozessen, die zwischen ihnen ablaufen). Biodiversität ist die Voraussetzung für die Bereitstellung von Ökosystemleistungen, also Leistungen, die die Natur für uns erbringt.
Biodiversität gibt es nur in der Biosphäre der Erde, dem einzigen Planeten, auf dem wir leben können.
Das einzige, bei dem man sich in der Evolution sicher sein kann: Nichts bleibt, wie es ist oder war. Der Bauplan für einen Organismus ist in seinem Erbgut kodiert. Dieses Erbgut wird an die nächste Generation weitergegeben und dafür kopiert. Bei vegetativer Vermehrung, zum Beispiel, wenn Erdbeerpflanzen Ausläufer bilden, sind das Erbgut der Elterngeneration und der nachfolgenden Generation identisch. Bei der geschlechtlichen Vermehrung bekommt die Kindergeneration eine neue Erbgutmischung mit auf den Weg. Die eine Hälfte des Erbguts stammt vom Vater, die andere von der Mutter.
Über viele Generationen wächst mit der steigenden Anzahl von Individuen auch die Vielfalt genetischer Sets. Das gilt ebenso für vegetative Vermehrung, weil es beim Kopieren immer mal wieder zu kleinen Übertragungsfehlern (Mutationen) kommt.
Die so entstehende genetische Vielfalt ist eine der drei Komponenten von Biodiversität und wichtig für das Überleben von Arten. Die genetische Vielfalt innerhalb einer Art bestimmt, wie die Individuen dieser Art auf Umweltveränderungen reagieren. Eine solche Veränderung kann eine neu auftretende Krankheit, klimatische Veränderungen, ein Extremwetterereignis oder ein neuer Konkurrent oder Räuber sein. Je vielfältiger die genetische Ausstattung einer Art, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Individuen gibt, die mit der neuen Situation umgehen können. Und weil das so ist, ist Seltenwerden, das ja mit einer Abnahme genetischer Vielfalt einhergeht, die Vorstufe des Aussterbens.
Über lange Zeiträume führen Mutationen im Erbgut aber nicht mehr nur zu hoher genetischer Vielfalt, sondern irgendwann auch zur Bildung neuer Arten. Von zwei Arten spricht man dann, wenn Individuen so verschieden voneinander sind, dass sie sich nicht mehr gemeinsam fortpflanzen können. Nah verwandte Arten, wie Pferd und Esel oder Löwe und Tiger, können noch gemeinsame Nachkommen zeugen, die in der Regel aber steril oder unfruchtbar sind. Ein Zurück zu einer einzigen Art gibt es dann nicht mehr. Diese Artenvielfalt ist die zweite Komponente von Biodiversität.
Dass sich eine Mutation in einer Population durchsetzt, die neue Genvariante also dominant wird und irgendwann eine neue Art entsteht, kann über drei Wege geschehen. Den ersten nennt man genetische Drift. Sie tritt auf, wenn zum Beispiel eine Insel von einer kleinen Gründerpopulation, sagen wir von 10 Tieren, darunter einem Träger dieses Gens, besiedelt wird. Während in der Ursprungspopulation von zum Beispiel 1000 Tieren die Genveränderung sehr selten war (1/1000), ist sie nun relativ häufig (1/10). Als Mix aller Gene sieht die Gründerpopulation also ganz anders aus als die Ursprungspopulation. Im Laufe der Zeit kann das in die Entwicklung einer neue Art münden.
Einen anderen Weg, aus einem seltenen Gen ein häufiges zu machen, nennt man sexuelle Selektion. Bei ihr spielt die Bevorzugung eines bestimmten Genotyps die entscheidende Rolle – meist treffen die Weibchen dabei die Wahl. Mögen die bei einer Vogelart zum Beispiel besonders gerne lange Schwanzfedern, haben Männchen mit dieser genetischen Variante die besten Fortpflanzungschancen, werden mehr Nachwuchs produzieren und das entsprechende Gen häufiger weitergeben als Männchen mit einem anderen Gen.
Finden Weibchen schicker: Lange Schwanzfedern beim Roten Paradiesvogel
(Paradisaea rubra)
.
Die dritte Form der Verschiebung von Häufigkeiten genetischer Sets basiert auf Umweltveränderungen. In einer veränderten Umwelt (trockener, kälter …) können bestimmte Genotypen Vorteile gegenüber anderen haben. Plötzlich haben die Individuen, die mit weniger Wasser oder niedrigeren Temperaturen zurechtkommen, bessere Überlebenschancen.
Verändert sich eine Art über die Zeit so massiv, dass die Ursprungsart vollkommen verschwindet, bleibt die Artenzahl insgesamt gleich. So sind die direkten Vorfahren des Menschen heute verschwunden. Vorher war eine Art »Urmensch« und jetzt gibt es eine Art »Mensch«. Manchmal spalten sich Arten aber auf. So gibt es heute noch Schimpansen und Menschen, die auf einen gemeinsamen Vorfahren zurückgehen. Aus einer sind da also zwei Arten geworden.
Artbildung kann sympatrisch (an einem Ort) oder allopatrisch (an verschiedenen Orten) stattfinden. Dass sich Individuen einer Ausgangsart, die sich an unterschiedlichen Orten befinden, in verschiedene Arten entwickeln, ist leichter zu verstehen, als dass Individuen an einem Ort verschiedene evolutive Pfade beschreiten. Letzteres kann mit der sexuellen Selektion oder dem Verhalten zu tun haben. Ein Teil der Weibchen einer Vogelart könnte zum Beispiel Männchen mit hellem Schopf, eine andere mit dunklem Schopf toll finden. Männchen, die dazwischen liegen, sind für niemanden interessant. Irgendwann gibt’s den Dunkelschopfvogel als Art A und den Hellschopfvogel als Art B. Bei den Buntbarschen im Viktoriasee haben vermutlich Verhaltensunterschiede die sympatrische Artbildung vorangetrieben. Einzelne Gruppen von Gründertieren einer Art hatten damals wohl unterschiedliche Präferenzen, was Nahrung, Aktivitätszeitraum oder Habitate anging. So gingen die ursprünglich zu einer Art gehörenden Vertreter getrennte Wege. Im Viktoriasee entstanden so in weniger als 15.000 Jahren sogar 500 neue Arten von Buntbarschen.
In allen Fällen sind so Arten entstanden, die perfekt an ihre Umgebung angepasst erscheinen. Der Begriff »Anpassung« ist allerdings irreführend: Organismen können ihr Erbgut gar nicht aktiv an veränderte Umweltbedingungen anpassen. Aber eine veränderte Umwelt kann für manche Individuen, die bereits eine entsprechende genetische Ausstattung mit sich herumtragen, bessere Rahmenbedingungen bieten. Würde Evolution tatsächlich über aktive Anpassung funktionieren, würden Organismen auf die neuen Zustände ihrer Umwelt einfach entsprechend reagieren – und wir müssten kein Buch über schwindende Biodiversität schreiben.
Organismen können ihr Erbgut nicht einfach an veränderte Umweltbedingungen »anpassen«.
Die Bildung neuer Arten braucht relativ viel Zeit. Als superschnell gelten beispielsweise die Entstehung der Flunder in der Nordsee innerhalb von 5.000 bis 6.000 Jahren oder die von Buntbarscharten im Viktoriasee innerhalb von 14.500 Jahren. Im Allgemeinen geht man davon aus, dass die Bildung neuer Arten mehrere 10.000 bis einige Millionen Jahre dauert. Weil die Lebenszeit eines Menschen wesentlich unter diesen Zeiträumen liegt, erscheinen uns Arten unveränderbar zu sein. In Wirklichkeit laufen Evolution und Artbildung jeden Tag und überall auf der Welt ab.
Die fünf Treiber des Verlustes von Biodiversität
Schwindende Biodiversität lässt sich auf fünf wesentliche Ursachen zurückführen – für alle von ihnen sind Menschen verantwortlich:
1 Landnutzungsänderung – zum Beispiel das Roden von Wäldern, das Trockenlegen von Feuchtgebieten oder das Begradigen von Flüssen
2 Klimawandel – er zerstört über Extremwetterereignisse, globale Erwärmung und den Meeresspiegelanstieg die Lebensräume von Tieren und Pflanzen und desynchronisiert ökologische Prozesse.
3 Direkte Verfolgung und Übernutzung – wie Jagd, Fischerei oder das Sammeln von Meeresschildkröteneiern
4 Eintrag von Umweltgiften – etwa Plastik, Radioaktivität oder Hormone, die Tiere töten oder krank machen
5 Invasive Arten – über globale Vernetzung schleppen wir Arten ein, zum Beispiel Füchse oder Katzen auf vormals raubtierfreien Inseln mit bodenbrütenden Vögeln, die von diesen neuen Räubern dann ausgerottet werden.
Im Vergleich zu technologischen Prozessen ist Evolution langsam – und sie ist nicht zielgerichtet. Es hat niemand eine zündende Idee, was gut funktionieren könnte, und schmeißt dann die Produktion an. Wenn aber etwas entsteht, was im World Wide Web of Life nicht funktioniert, verschwindet es einfach wieder – der perfekte Schutz vor doofen Ideen.
Im Vergleich zu technologischen Prozessen ist Evolution sehr langsam und nicht zielgerichtet.
Das, was nicht stört, kann im Genom »schlummern« und sich eines Tages als evolutiver Vorteil herausstellen. So haben einige Mikroben sehr lange Zeit die Fähigkeit, Rohöl zu verarbeiten, ungenutzt in sich getragen. Bei Havarien von Erdöltankern oder Unfällen auf Ölplattformen schlägt damit heute ihre große Stunde. Und Arten, denen große Mengen an Radioaktivität nichts ausmachen, geht es in Tschernobyl und Fukushima prächtig.
Nochmal wiederholt, weil es ein zentraler Unterschied zur Technik ist: Es ist weder gerichteter Anpassung noch einem kreativen Schöpfer zu verdanken, dass es Prozesse und Arten gibt, die super aufeinander abgestimmt sind. Das ist alles Zeit und Zufall.
Kleiner Leberegel
Eines der skurrilsten Beispiele für das, was die Evolution zustande bringt, ist der Lebenszyklus des kleinen Leberegels (Dicrocoelium dendriticum), einem parasitären Saugwurm.
Als erwachsenes Tier lebt er in den Gallengängen von meist großen Pflanzenfressern wie Kühen, Schafen, Rehen oder Hirschen. Über deren Gallengänge gelangen seine Eier in den Darm und werden von da ausgeschieden. In den hitze-, kälte- und trockenresistenten Eiern befinden sich die Wurmlarven, die bis zu 20 Monate darauf warten, wieder verspeist zu werden, von einer der bislang bekannten 99 Landschneckenarten, die als Zwischenwirt infrage kommen. In der Schnecke durchlaufen die Larven innerhalb von drei bis vier Monaten zwei weitere Entwicklungsstufen und werden zu Zerkarien, die in die Atemhöhle der Schnecke einwandern. Verpackt in kleine Schleimbällchen scheidet die Schnecke diese Zerkarien aus – nur im Mai und Juni. Die etwa zwei Millimeter großen Schleimbällchen werden von Ameisen gefressen. In der Ameise wandern die meisten Zerkarien in die Leibeshöhle. Einige wenige machen sich auf zum »Gehirn« der Ameise und beeinflussen von da aus das Verhalten ihres Wirts in gar wundersamer Weise. Befallene Ameisen verspüren bei Temperaturen unter 15 Grad Celsius (dem Temperaturbereich, bei dem Pflanzenfresser am liebsten grasen und gleichzeitig die geringste Gefahr besteht, dass die Zerkarien einen Hitzetod sterben) den unwiderstehlichen Drang, an einem Pflanzenstängel hochzukrabbeln. Oben angekommen verbeißen sie sich in den Stiel und bekommen einen Beißkrampf. So »festgetackert« werden sie von Pflanzenfressern mitverspeist und der Zyklus beginnt von neuem. Wer denkt sich so was aus? Niemand!
Ähnlich den großen Durchbrüchen bei technologischen Entwicklungen gibt es auch in der Geschichte des Lebens ein paar sehr richtungsweisende Momente, die die Vielfalt des Lebens schon mal vor große Herausforderungen stellten, mal der Evolution einen heftig schönen Push gaben.
Vor 2,4 Milliarden Jahren entwickelten sich Cyanobakterien, die über Photosynthese gigantische Mengen an molekularem Sauerstoff in ihre Umgebung entließen. Weil der für die vorherrschenden anaeroben Organismen dieser Zeit extrem giftig war, sorgte diese »Große Sauerstoffkatastrophe« für ein massives Artensterben. Auch wenn es weitere Massenaussterbeereignisse gab (siehe folgender Kasten), haben nur zweimal in der Geschichte des Lebens auf unserem Planeten Lebewesen selbst einen massiven Artenschwund ausgelöst: vor 2,4 Milliarden Jahren die Cyanobakterien und heute wir Menschen.
Im Zuge der »Kambrischen Explosion« vor 541 Millionen Jahren haben sich dagegen innerhalb von nur 5 bis 10 Millionen Jahren fast alle heute bekannten Tierstämme entwickelt (der Auslöser für diese »Superrevolution« ist bis heute unbekannt). Die lebten anfangs alle im Meer. Vor etwa 480 Millionen Jahren besiedelten Pflanzen und Insekten das Land. Ihnen folgten vor rund 400 Millionen Jahren die Wirbeltiere.
Heute sind wir der »große Faktor«, der alle Arten und Ökosysteme extrem beeinflusst. Während wir das Aussterben von Arten derzeit massiv beschleunigen, verläuft die Bildung von neuen Arten gewohnt langsam ab. Nur ein bis zwei neue Arten entstehen pro Jahr. Weil wir durch das Seltenmachen und Ausrotten von Arten die genetische Vielfalt auf unserem Planeten dramatisch reduzieren, hat sich die Artbildung womöglich sogar noch verlangsamt.
Erosion von Biodiversität und Massenaussterben
Etwa 99 Prozent aller jemals auf unserem Planeten lebenden Arten sind schon wieder verschwunden. Während sich viele von ihnen in andere Arten entwickelt haben, sind einige wirklich ausgestorben. Natürliches Aussterben ist in der Geschichte des Lebens eigentlich ein seltenes Ereignis: Nur 0,1 Arten pro eine Million Arten sterben in normalen Zeiträumen des »Hintergrundsterbens« pro Jahr aus.
In den letzten 542 Millionen Jahren (also der jüngeren geologischen Geschichte) gab es aber fünf Massenaussterbeereignisse, die im Abstand von mehreren 10 Millionen Jahren auftraten. Hier sind über einen Zeitraum von einigen Zehntausenden bis mehreren Hunderttausend Jahren (maximal innerhalb von 2,8 Millionen Jahren) mindestens 70 Prozent aller Arten ausgestorben.
Das fünfte und bislang letzte Massenaussterben liegt etwa 66 Millionen Jahre zurück. Ihm fielen 78 Prozent aller Arten, darunter die letzten Vertreter der großen Dinosaurier, zum Opfer.
Im Moment erodiert Biodiversität in rasendem Tempo: In den letzten 50 Jahren haben wir etwa 73 Prozent aller Wirbeltiere verloren, alle drei Sekunden roden wir ein Stück Wald von der Größe eines Fußballfelds. Mehr als ein Viertel aller daraufhin untersuchten Arten sind vom Aussterben bedroht. Damit überschreiten wir die Belastungsgrenzen der Erde (die sogenannten planetaren Grenzen) und bringen Erdsysteme an den Rand von Kipppunkten, nach denen es kein Zurück mehr gibt. Nach wissenschaftlichen Schätzungen liegt die momentane Aussterberate etwa 1.000-mal höher als das normale Hintergrundsterben. Geht man von einer Zahl von etwa 10 Millionen Arten aus (die wirkliche Artenzahl kennen wir nicht), stirbt also nicht eine Art pro Jahr aus, sondern 1.000. geht das so weiter, sterben in nur 7.000 Jahren 70 Prozent aller Arten aus. Damit befinden wir uns im sechsten Massenaussterben der Geschichte – und wohl im bislang schnellsten.
An dieser Stelle müssen wir nochmal einen Schritt zurücktreten. Es gibt nämlich noch eine dritte Komponente von Biodiversität neben genetischer Vielfalt und der Anzahl der Arten: die Vielfalt von Ökosystemen. Denn Arten kommen nicht isoliert voneinander vor. Sie teilen sich ihren Lebensraum, der durch bestimmte abiotische Parameter gekennzeichnet ist (also Elemente der unbelebten Natur wie Temperatur oder Lichtverhältnisse), mit anderen Arten. Diese Arten interagieren mit ihnen oder gestalten als biotische Faktoren den Lebensraum – wie der Baum, der draußen vor dem Fenster Sauerstoff abgibt und Schatten spendet. Solche Lebensgemeinschaften und ihren Lebensraum bezeichnet man als Ökosysteme.
Auch das Zusammenspiel von Organismen in solchen Ökosystemen unterliegt evolutiven Prozessen. Man spricht von Koevolution, wenn sich zwei oder mehr Arten durch den Prozess der natürlichen Selektion gegenseitig in ihrer Evolution beeinflussen. Der vorhin beschriebene kleine Leberegel ist so ein Beispiel einer raffinierten Koevolution. Ein weiteres sind Räuber-Beute-Beziehungen oder Pflanzen und Pflanzenfresser. Koevolution kann einer Art Wettrüsten gleichen, wenn nur die wehrhafteste Beute überlebt, die nur den gefährlichsten Beutegreifern zum Opfer fällt, denen wiederum nur noch wehrhaftere Beute entgeht. Es geht aber auch friedlicher: Die auf ganz wunderbare Weise aufeinander abgestimmten Blüten-Bestäuber-Paare sind ebenso das Ergebnis koevolutiver Prozesse wie die Interaktionen von Termiten mit den von ihnen gezüchteten Pilzen. Solche aufeinander abgestimmten Prozesse nennt man symbiotisch, wenn beide Arten voneinander abhängig sind beziehungsweise voneinander profitieren, und kommensalisch, wenn eine Art (der Kommensale) von der Nahrung des anderen (des Wirtes) profitiert, diesen aber weder schädigt (im Gegensatz zum Parasitismus) noch ihm Nutzen bringt (im Gegensatz zur Symbiose).
Passt perfekt: Kolibri als Bestäuber
Der Gedanke, dass sich verändernde Umweltbedingungen die Evolution vorantreiben, ist ein Grundpfeiler der Evolutionsforschung. Der Gedanke, dass die Evolution umgekehrt auch ökologische Prozesse verändert, ist dagegen ein ziemlich neues Forschungsfeld. Erst im Jahr 2023 hat ein amerikanisches Forschungsteam einen empirischen Beleg dafür geliefert, dass eine evolutive Veränderung bei einer Tierart ein Ökosystem verändern kann.1 Auf den Bahamas fingen sie über 200 Bahamasanolis (eine Reptilienart aus der Gruppe der Leguanartigen). Tiere mit besonders langen Hinterbeinen wurden auf einer Insel, die keine Anolis beheimatete, freigelassen; eine Gruppe mit besonders kurzen Beinen auf einer anderen zuvor Anoli-freien Insel. Wer mittellange Beine hatte (der Großteil der gefangenen Tiere), wurde direkt wieder auf der Heimatinsel freigelassen. Das Ergebnis nach nur acht Monaten: Auf Inseln mit kurzbeinigen Anolis waren die Populationen von Netzspinnen – ein wichtiges Beutetier – um 41 Prozent geringer als auf Inseln mit »schlaksigen« Echsen. Auch beim Pflanzenwachstum gab es erhebliche Unterschiede. Da die kurzbeinigen Reptilien besser in der Lage waren, pflanzenfressende Insekten zu erbeuten, gediehen die Pflanzen besser. Auf Inseln mit kurzbeinigen Eidechsen wuchsen die Triebe bestimmter Bäume doppelt so stark wie die von Bäumen auf Inseln mit langbeinigen Eidechsen. Diese Effekte haben das Potenzial, das gesamte Ökosystem nachhaltig zu verändern.
Von der Feuerstelle zur Mikrowelle
Die Natur hat einen gigantischen zeitlichen Vorsprung bei der Entwicklung von Lösungen für alle möglichen Probleme. Dabei hat sie vieles schon »erfunden«, auf das wir erst viel später gekommen sind:
Schlüssel-Schloss-Prinzip? Kolibri und Blüte!
Wasserabweisende Oberflächen? Lotusblatt!
Stauprävention? Ameisenstraße!
Kompostierbare Verpackung? Bananenschale!
Die meisten Erfindungen machen wir allerdings ohne Abschauen bei der Natur. Wir haben Rollkoffer, Smartphone, Mikrowelle und KI erfunden und im dauerhaften Wettbewerb weiterentwickelt. Dabei setzen wir neben »Versuch und Irrtum« auch auf Kommunikation und Kollaboration. Wir tauschen uns über wissenschaftliche Publikationen und das Teilen von Daten aus. Genau wie die Natur bauen wir oft auf schon Bestehendes auf.
Wohin Erfindungen und Evolution sich entwickeln, hängt also davon ab, was sie begrenzt (etwa die Verfügbarkeit von Energie) und was sie antreibt (zum Beispiel bessere Ressourceneffizienz). Da gibt es zuweilen erstaunliche Parallelen für biologische und technische Prozesse, manchmal hat die Natur auch komplett andere Voraussetzungen als wir.
Bionik
Im Forschungsgebiet der Bionik (ein Begriff, der sich aus Biologie und Technik zusammensetzt) versuchen Ingenieure, biologische Methoden und Systeme auf Technik zu übertragen. Dabei werden zwei Wege verfolgt. Der eine beginnt mit der Analyse von natürlichen Strukturen oder Prozessen und stellt anschließend die Frage: »Können wir das Prinzip nachbauen und dann irgendwo einsetzen?« So kam man zum Beispiel darauf, dass die Strukturen auf den Flügeldecken des Nebeltrinkerkäfers (Onymacris unguicularis), die er zur Gewinnung von Trinkwasser aus Nebel anwendet, von Menschen auf große Netze übertragen werden können, die sich in küstennahen Trockengebieten mit Nebelbildung zur Wassergewinnung nutzen lassen.
Der andere Weg läuft umgekehrt: Man beginnt mit der Beschreibung eines technischen Problems und macht sich dann auf die Suche nach einer Lösung in der Natur. So geschehen bei Wissenschaftler:innen, die eine Möglichkeit suchten, Mikroplastik aus Waschmaschinenwasser zu filtern. Fündig wurden sie bei verschiedenen Tierarten wie Flamingos, Walen oder Muscheln, die ihre Nahrung aus dem Wasser filtern.
Das beste Beispiel dafür ist die Gewinnung von Energie aus Sonnenlicht. Das kann die Natur mit Photosynthese und inzwischen auch der Mensch mit Solarpanelen. Sonnenenergie ist quasi unendlich vorhanden, daher gibt es keinen evolutiven Druck auf Pflanzen, mit dieser Energie effizient umzugehen. Sie produzieren fleißig, aber recht ineffizient aus Wasser und CO2 (gespeist von Sonnenlicht) Sauerstoff und Zucker – und damit eine verwertbare Energieform für alle Tiere. Zwar ist auch für uns Sonnenlicht frei verfügbar, aber die begrenzte Verfügbarkeit von Material und Fläche für Solaranlagen drängt uns zu mehr Leistung pro Einheit. So wundert es nicht, dass Photovoltaikanlagen das Sonnenlicht längst viel effizienter nutzen als Pflanzen.
Andere Entwicklungsprinzipien sind zwischen technischen und natürlichen Systemen überraschend ähnlich. Leichtbauweise und Materialeffizienz gehören dazu. Für Organismen ist es ein evolutiver Vorteil, mit weniger Material, das man selbst aufbauen muss (also Gewebe), beziehungsweise mit wenig Gewicht, das man rumschleppen muss, auszukommen. Bei technischen Systemen muss man Material und Transportenergie zukaufen, also ist es auch da besser, wenig davon zu benötigen.
Vergleichen kann man Evolution und Technik auch an ihrer Geschwindigkeit. Evolution ist wie gesagt langsam und nicht zielgerichtet. Das ist inzwischen zwar bei technologischen Entwicklungen ganz anders, aber begonnen haben auch die langsam. Die vermutlich älteste von unseren Vorfahren genutzte Technologie sind Steinwerkzeuge. Sie begannen vor 3,4 Millionen Jahren, sie zu verwenden. Danach kommt lange: nichts. Feuer nutzen sie erst 2,4 Millionen Jahre später, vor etwa einer Million Jahren. Das war eine bahnbrechende Veränderung – ein echter Technologiesprung. Feuer diente als Wärme- und Lichtquelle, als Schutz vor Raubtieren (vor allem nachts), als Mittel zur Herstellung neuer Jagdwerkzeuge und es erlaubte das Kochen von Nahrungsmitteln. Das machte Nahrung wiederum haltbarer und damit länger verfügbar, und es machte sie sicherer, weil Krankheitserreger und Parasiten abgetötet werden. Darüber hinaus verlängerte die Beherrschung des Feuers die tägliche Aktivitätsphase in die dunklen und kälteren Abendstunden. Damit konnte man Ideen entwickeln, sich über sie austauschen, und vielleicht Kulturtechniken wie Geschichtenerzählen entwickeln, für die man tagsüber wenig Zeit hatte. Die Nutzung von Feuer und die damit einhergehenden kulturellen und technologischen Fortschritte ermöglichten schließlich die geografische Ausbreitung des Menschen.
Auch diese Ausbreitung ging anfangs recht schleppend voran. Den Homo sapiens, also uns, gibt es seit etwa 315.000 Jahren. Nach allem, was wir wissen, brauchte er sage und schreibe 115.000 Jahre, um mal auf die Idee zu kommen, sich ein Bett zu bauen, und das bestand auch nur aus einem Haufen Gras. Erst vor 72.000 Jahren entwickelten Menschen Pfeil und Bogen. Gut gesättigt hatten unsere Vorfahren vor 60.000 Jahren dann Lust auf eine neue Form der Unterhaltung und die Idee, mit einer Flöte Musik zu machen. Nach der Nutzung von Feuer gilt das Sesshaftwerden vor etwa 12.000 Jahren, gepaart mit der Erfindung von Ackerbau und Viehzucht, als ein weiterer entscheidender Schritt in der technologischen Entwicklung des Menschen. Ziemlich genau zur gleichen Zeit kamen Menschen im heutigen Israel auf die Idee, ein Rad um eine Achse kreisen zu lassen.
Ganz ohne Funktionskleidung: Chaski genannte Boten legten im Inkareich pro Tag bis zu 300 Kilometer zurück, um Informationen zu überbringen.
Auch die Entwicklung von Kommunikationstechnologien begann gemächlich. Seit höchstens 8.600 Jahren nutzen Menschen eine Art Schrift, die sie seit über 2.000 Jahren auf Papier bannen. Wollte man seine Idee verbreiten, musste man einen Läufer oder Reiter mit dem Dokument oder der mündlichen Information losschicken. Im Inkareich (13. bis 16. Jahrhundert) etablierten Herrscher ein System von Staffeln vieler schneller Läufer (den Chaski oder Chasqui), die Nachrichten meist in mündlicher Form über Distanzen von 300 Kilometer pro Tag übermitteln konnten.
Wie beeindruckend schnell diese Informationsübermittlung war, zeigt die Tatsache, dass Hunderte Jahre später der legendäre Pony-Express, eine Reiterstafette der US-amerikanischen Post, für die 3.100 Kilometer lange Strecke von Saint Joseph in Missouris bis nach Sacramento in Kalifornien 10 Tage brauchte, also etwa auch 300 Kilometer am Tag zurücklegte. Die transportierte Informationsmenge hatte sich mit dem Einsatz der Pferde zwar auf 10 Kilogramm erhöht, die Geschwindigkeit der Informationsübermittlung blieb aber gleich. Für die Erhöhung der Geschwindigkeit brachte erst die elektrische Telegrafie den entscheidenden Durchbruch. Die direkte Übertragung von Information ab Beginn des 19. Jahrhunderts, zunächst kabelgebunden und ab Ende des 19. Jahrhunderts per Funk, verkürzte die Langstrecken-Kommunikation von Stunden oder Tagen auf einen Zeitraum von (Milli-)Sekunden.
Und plötzlich ging alles ganz schnell
Eine ganz neue Geschwindigkeitsdimension erhielt der technologische Fortschritt mit der Great Acceleration, der großen Beschleunigung, die etwa in der Mitte des 20. Jahrhunderts einsetzte. Was genau diese »Große Beschleunigung« startete, ist schwer zu sagen. Vermutlich spielte aber das Ende des zweiten Weltkriegs eine Rolle.
Great Acceleration
Etwa seit der Mitte des 20. Jahrhunderts gibt es einen starken Anstieg verschiedener soziökonomischer Parameter und solcher, die das Erdsystem beschreiben. Die Weltbevölkerung ist zum Beispiel von 2,5 Milliarden Menschen im Jahr 1950 auf 8,2 Milliarden Anfang 2025 angewachsen. Das weltweite Bruttosozialprodukt ist im gleichen Zeitraum von neun auf 110 Billionen US-Dollar gestiegen. Gleichzeitig stieg die weltweite Plastikproduktion (von der über 90 Prozent als Müll endet) von 1,5 Millionen Tonnen im Jahr 1950 auf 414 Millionen Tonnen im Jahr 2023 an. Die Versauerung der Ozeane hat durch einen massiven Anstieg der CO2-Emissionen um 30 Prozent zugenommen – mit katastrophalen Folgen für kalkbildende Lebewesen wie Korallen.
Von der Entwicklung des ersten Telefons bis zum ersten Mobiltelefon dauerte es noch über 100 Jahre. Vom ersten allgemein verfügbaren Mobiltelefon in Deutschland im Jahr 1992 bis zum ersten käuflich zu erwerbenden Smartphone dauerte es dann nur noch zwei Jahre. Ein Smartphone ist ja eher ein Computer als nur ein tragbares Telefon – und auch bei denen läuft die Entwicklung immer schneller. Von Konrad Zuses 1941 vorgestelltem »Z3«, dem ersten funktionsfähigen Digitalrechner, der fast ein ganzes Zimmer ausfüllte und 15 bis 20 Rechenoperationen pro Sekunde durchführen konnte, bis zum Supercomputer »Frontier«, der 2023 pro Sekunde 1,1 Trillionen Rechenoperationen durchführte, dauerte es gerade mal etwa 80 Jahre. An Supercomputern sieht man gut, wie stark sich technologische Entwicklungen beschleunigen: Im Jahr 1976 konnte der schnellste Supercomputer 160 Millionen