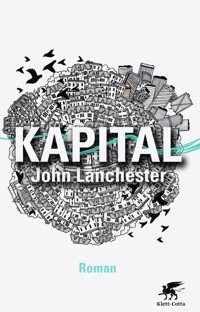
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Alle Bewohner der Pepys Road suchen nach ihrem Glück: Roger Yount ist ein erfolgreicher Banker - mit zwei Kindern und einer verwöhnten Ehefrau. Dass er nicht die erwartete 1 Million Pfund Jahresprämie erhält, stürzt die Familie in eine Krise. Nebenan zieht die senegalesische Fußballhoffnung Freddy Kamo mit seinem Vater ein - wird ihm der internationale Durchbruch in einem Premier-League-Club gelingen? Petunia Howe lebte schon in der Pepys Road, als diese noch eine einfache Arbeiterstraße war. Pakistanische Kioskbesitzer stehen unter Terrorverdacht, die nigerianische Politesse ohne Arbeitserlaubnis schreibt Strafzettel und der polnische Handwerker Zbigniew liebt die Frauen, und die Frauen lieben ihn. An einem ganz normalen Tag liegt bei allen stolzen Eigenheimbesitzern dieser Straße eine merkwürdige Nachricht im Briefkasten: »Wir wollen, was ihr habt.« Ein Roman voller Mitgefühl, Humor und Protagonisten, die man nicht mehr missen möchte. Ein großer unterhaltsamer Gesellschaftsroman, in 20 Sprachen übersetzt, der ein mitfühlendes, humorvolles und hochaktuelles Panorama der Gegenwart über die Top-Themen »Schuldenkrise« und »Gentrifizierung« bietet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 978
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
John Lanchester
KAPITAL
Roman
Aus dem Englischenvon Dorothee Merkel
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Besuchen Sie uns im Internet: www.klett-cotta.de
Klett-Cotta
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Capital«
bei Faber & Faber Ltd; London
© 2012 by Orlando Books Ltd
Für die deutsche Ausgabe
© 2012 by J.G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Schutzumschlag: Rothfos & Gabler, Hamburg unter Verwendung
des Originalcovers von Faber and Faber, Illustration von Tom Berry
Datenkonvertierung: Koch, Neff & Volckmar GmbH, KN digital – die digitale Verlagsauslieferung Stuttgart
Printausgabe: ISBN 978-3-608-93985-9
E-Book: ISBN 978-3-608-10316-8
Dieses E-Book entspricht der 10. Auflage 2013 der Printausgabe.
PROLOG
Im Morgengrauen eines Spätsommertags ging ein Mann in einem Kapuzenshirt langsam und leise durch eine ganz normal wirkende Straße im Süden Londons. Er war mit irgendetwas beschäftigt, aber ein zufälliger Beobachter hätte nur schwer erraten können, womit. Manchmal ging er näher an eines der Häuser heran, manchmal trat er ein paar Schritte zurück. Mal schaute er nach unten, dann wieder nach oben. Besagter zufälliger Beobachter hätte aus der Nähe allerdings erkennen können, dass der junge Mann eine kleine Videokamera in der Hand hielt. Aber es gab keinen solchen Beobachter. Niemand sah den jungen Mann, die Straße war leer. Sogar die Frühaufsteher schliefen noch. Es war auch nicht einer der Tage, an denen die Milch geliefert wurde oder die Müllabfuhr kam. Vielleicht wusste der junge Mann das und es war kein Zufall, dass er die Häuser genau zu diesem Zeitpunkt filmte.
Der Name der Straße war Pepys Road. Sie sah nicht anders aus als viele andere Straßen in diesem Teil Londons. Die meisten Häuser in ihr waren zur gleichen Zeit entstanden. Ein Immobilienunternehmer hatte sie während des Aufschwungs gebaut, der gegen Ende des 19. Jahrhunderts auf die Abschaffung der Backsteinsteuer folgte. Der Architekt aus Cornwall und die irischen Bauarbeiter, die damals von der Firma beauftragt worden waren, brauchten zum Errichten der Häuser ungefähr achtzehn Monate. Jedes von ihnen hatte drei Stockwerke und unterschied sich auf bestimmte Weise von seinen Nachbarn, denn der Architekt und seine Bauarbeiter hatten winzige Variationen eingefügt. Bei manchen war es die Form der Fenster oder der Schornsteine, bei anderen betraf es die Details im Mauerwerk. In einem architektonischen Reiseführer der Gegend heißt es: »Sobald man dieses Phänomen bemerkt hat, beginnt man unweigerlich, die Gebäude näher zu betrachten und nach den kleinen Unterschieden zu suchen.« Vier von den Häusern in der Straße waren doppelt so breit wie die anderen und boten dementsprechend mehr Platz. Und weil Platz immer unbezahlbarer wurde, waren diese Häuser ungefähr dreimal so viel wert wie ihre kleineren Nachbarn. Es waren jene größeren, teureren Häuser, an denen der junge Mann mit der Kamera besonderes Interesse zu haben schien.
Die Gebäude in der Pepys Road waren für eine ganz bestimmte Klientel errichtet worden: Familien aus der unteren Mittelschicht, denen es nichts ausmachte, in einem weniger modischen Stadtteil zu wohnen, wenn sie dafür ihr eigenes Reihenhaus besitzen konnten – groß genug, um auch Dienstboten darin unterzubringen. In den ersten Jahren nach ihrer Fertigstellung wohnten dort nicht etwa Rechtsanwälte, Notare oder Doktoren, sondern deren Angestellte: angesehene, ehrgeizige Leute, die nicht mehr jeden Penny einzeln umdrehen mussten. Im Laufe der nächsten Jahrzehnte vollzog sich in der Straße ein fortwährender demographischer Wandel, sowohl was das Alter der Einwohner als auch was deren Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gesellschaftsschicht betraf. Es hing ganz davon ab, wie beliebt sie gerade bei aufstrebenden jungen Familien war oder welche Anziehungskraft die Gegend zur jeweiligen Zeit ausübte. Im Zweiten Weltkrieg wurde auch dieser Teil der Stadt Opfer von Bombardierungen, aber die Pepys Road blieb unversehrt, bis 1944 eine V2-Rakete einschlug und zwei Häuser in der Mitte der Straße zerstörte. Jahrelang blieb die Lücke offen, wie ein Paar fehlender Schneidezähne, bis schließlich in den fünfziger Jahren neue Häuser gebaut wurden, die mit ihren Balkonen und Terrassentüren aus Glas inmitten all der viktorianischen Architektur sehr seltsam wirkten. Damals waren vier Häuser der Straße von Familien bewohnt, die erst vor kurzem aus der Karibik gekommen waren; die Väter arbeiteten alle für London Transport. Ein kleines, unregelmäßiges, grasbewachsenes Grundstück am Ende der Straße, das seit der Zerstörung des vorherigen Gebäudes im Zweiten Weltkrieg leer gestanden hatte, wurde 1960 zubetoniert, und es entstand ein zweigeschossiger Eckladen mit zwei Räumen auf jeder Etage.
Es wäre schwierig zu sagen, wann genau die Pepys Road auf der Preisleiter nach oben zu klettern begann. Die übliche Antwort wäre vielleicht, dass es zur gleichen Zeit geschah, als in ganz Großbritannien der Lebensstandard zu steigen begann. Mit dem Beginn der Thatcher-Jahre befreite sich die Wirtschaft aus dem unansehnlichen Kokon, in dem sie während der späten Siebziger eingesponnen war, und verwandelte sich in einen grellbunten Schmetterling. Es folgte eine langjährige Hochkonjunktur. Aber die Leute, die in der Straße wohnten, empfanden das ein bisschen anders – nicht zuletzt deswegen, weil sich auch mit ihnen ein Wandel vollzogen hatte. Während die Immobilienpreise langsam stiegen, verkauften die Angehörigen der Arbeiterklasse ihre Häuser und zogen fort, meistens in größere Häuser in ruhigeren Lagen, wo ihre Nachbarn so waren wie sie. Die Bewohner, die neu in die Straße zogen, gehörten größtenteils der Mittelschicht an. Aber nach wie vor galt, dass die Häuser vor allem bei jungen Familien sehr beliebt waren. Die Familienväter hatten einigermaßen gut bezahlte, wenn auch nicht gerade spektakuläre Jobs, die Ehefrauen blieben zu Hause und kümmerten sich um die Kinder. Als dann die Preise weiter stiegen und die Zeiten sich änderten, zogen mehr Familien in die Gegend, bei denen beide Eltern berufstätig waren und sich andere Leute um die Kinder kümmerten.
Man begann, die Häuser nachzubessern, aber nicht so wie bisher, als einfach nur erledigt wurde, was gerade anfiel, sondern mit systematischen Umgestaltungen. Dabei folgte man dem Trend, der in den siebziger Jahren begonnen hatte und seither niemals wirklich aus der Mode gekommen war: Man durchbrach Wände und schuf offene, großflächige Räume. Zahlreiche Hausbesitzer bauten ihre Dachgeschosse aus. Als der Stadtrat in den Achtzigern einen Linksruck machte und zu einem solchen Ausbau keine Erlaubnis mehr erteilte, taten sich einige Anwohner zusammen und zogen für das Recht, ihre Häuser aufzustocken, vor Gericht. Der Musterprozess wurde zu ihren Gunsten entschieden. Sie argumentierten, dass die Häuser ursprünglich für Familien konzipiert gewesen seien und dass der Dachgeschossausbau somit ganz dem Geist der Erbauer entsprach – was durchaus stimmte. Es gab in der Straße immer jemanden, der sein Haus modernisierte, und es verging kein Tag, an dem nicht irgendwo ein Baucontainer stand. Die Laster der Bauarbeiter versperrten die Straße, andauernd hörte man es hämmern, klopfen, bohren, prasseln und dröhnen, die Transistorradios der Handwerker beschallten die Gegend, und unablässig wurden Baugerüste aufgestellt. Nach dem Crash des Immobilienmarktes 1987 ließ die Bauwut etwas nach, aber bereits zehn Jahre später nahm sie wieder zu. Und nach vielen weiteren Jahren des Booms war es auch gegen Ende 2007 noch durchaus normal, dass zwei oder drei Häuser in der Straße gleichzeitig größeren Renovierungen unterzogen wurden. Der neueste Trend war der Einbau eines Kellergeschosses, dessen Kosten jeweils bei mindestens 100000 £ oder mehr lagen. Aber viele von denen, die das Fundament ihres Hauses aushoben, verwiesen gerne darauf, dass der Umbau zwar einen großen Batzen Geld kostete, dem Haus aber mindestens genauso viel an Wert hinzufügte. Wenn man es also von diesem Standpunkt aus betrachtete – und weil viele der neuen Anwohner im Finanzsektor arbeiteten, war es ein sehr beliebter Standpunkt –, gab es den Kellerausbau praktisch zum Nulltarif.
All das war Teil einer einschneidenden Veränderung, die mit der Pepys Road vor sich ging. Seit es die Straße gab, war darin fast alles geschehen, was in einer Straße geschehen konnte. Zahllose Menschen verliebten und trennten sich wieder, ein junges Mädchen wurde zum ersten Mal geküsst, ein alter Mann tat seinen letzten Atemzug, ein Anwalt, der von der U-Bahn-Station nach Hause ging, schaute in den vom Wind ganz blaugefegten Himmel und hatte plötzlich das Gefühl, eine höhere Macht würde ihm Trost zusprechen, würde ihm versichern, dass es mehr als dieses Leben gab und dass das Bewusstsein mit dem Tod nicht endete. Babys starben an Diphtherie, Junkies spritzten sich auf dem Klo Heroin, junge Mütter bekamen Weinkrämpfe, weil sie sich so unendlich müde und einsam fühlten, andere planten ihre Flucht, hofften auf ihre große Chance, schauten Fernsehen, setzten ihre Küche in Brand, weil sie vergessen hatten, ihre Fritteuse auszuschalten, fielen von Leitern und sammelten alle Erfahrungen, die man im Leben so sammeln kann, Geburt, Tod, Liebe, Hass, Glück, Trauer, verwickelte Gefühle und einfache Gefühle, und alle Schattierungen dazwischen.
Jetzt war die Geschichte jedoch mit einer ganz erstaunlichen und unerwarteten Wendung über die Anwohner der Pepys Road hereingebrochen. Das erste Mal seit Entstehen der Straße waren die Menschen, die in ihr lebten – nach globalen und womöglich auch lokalen Maßstäben – reich. Ihr Reichtum ergab sich einfach und allein aus der Tatsache, dass sie in der Pepys Road wohnten. Sie waren reich, weil wie durch ein Wunder alle Häuser in der Straße nun Millionen von Pfund wert waren.
Dadurch vollzog sich eine seltsame Verkehrung der Umstände. Bisher war die Pepys Road von der Art Leuten bewohnt worden, für die sie auch gebaut worden war: aufstrebende, nicht besonders wohlhabende Leute. Sie waren froh gewesen, hier leben zu können, und dass sie hier lebten, war ein Teil ihrer zielstrebigen Bemühungen, etwas Besseres aus sich zu machen und für sich selbst und ihre Familien mehr Wohlstand zu schaffen. Die Häuser selbst hatten in ihrem Leben nur einen Platz im Hintergrund eingenommen. Sie waren zwar ein wichtiger Teil des Lebens gewesen, aber eben nur die Bühne, auf der sich die Handlung abspielte, und nicht die Hauptdarsteller selbst. Jetzt aber wurden die Häuser für die Menschen, die bereits darin wohnten, so wertvoll und für die, die gerade erst einzogen, so teuer, dass die Gebäude selbst die Rolle von Hauptdarstellern übernahmen.
All das geschah zunächst nur ganz allmählich. Die durchschnittlichen Preise krochen langsam nach oben und lagen zunächst bei wenigen Hunderttausend. Als dann die Beschäftigten der Finanzwelt die Gegend für sich entdeckten, stiegen die Immobilienpreise rasant. Es wurde üblich, den Leuten riesige Boni zu zahlen, die drei- oder viermal so hoch waren wie ihr eigentliches Jahreseinkommen und ein Vielfaches dessen betrugen, was ein englischer Durchschnittsbürger verdiente. In der Immobilienwelt brach eine allgemeine Hysterie aus. Ganz plötzlich gingen die Preise so steil nach oben, als hätten sie einen eigenen Willen. Es gab einen Satz, der jahrzehntelang überall zu hören war, einen sehr englischen Satz: »Hast du gehört, was die für das Haus unten in der Straße bekommen haben?« Anfänglich hatten die erstaunlich hohen Summen, über die man sprach, nur im Bereich von einigen Zehntausend gelegen. Dann erreichten sie ein Vielfaches von zehntausend. Dann wenige Hunderttausend, dann lagen sie im oberen Hunderttausenderbereich, und mittlerweile handelte es sich um siebenstellige Summen. Es wurde ganz normal, unentwegt über Immobilienpreise zu reden. Wenn man anfing, sich zu unterhalten, dauerte es nur wenige Minuten, bis unweigerlich das Gespräch auf dieses Thema kam. Immer wenn sich Leute trafen, versuchten sie erst eine Weile, sich zu beherrschen, um dann mit Erleichterung dem Wunsch nachzugeben, genau darüber zu sprechen.
Es war wie in Texas zur Zeit des Ölrauschs, mit dem einzigen Unterschied, dass man kein Loch in den Boden bohren musste, um fossile Brennstoffe daraus hervorschießen zu lassen. Stattdessen saß man einfach nur da und schaute zu, wie der Wert des eigenen Hauses so schnell in die Höhe raste, dass einem schwindelig wurde. Sobald die Eltern zur Arbeit und die Kinder zur Schule gegangen waren, sah man tagsüber weniger Leute in der Straße, abgesehen von den Bauarbeitern. Doch andauernd wurde irgendetwas geliefert. Es schien, als wären die Häuser lebendig geworden, seit ihr Preis gestiegen war, und als hätten sie dadurch ihre eigenen Wünsche und Begierden entwickelt. Transporter von Berry Brothers & Rudd kamen, um Wein zu liefern, zwei oder drei verschiedene Hundesitter fuhren in ihren Autos vor, es gab Blumenlieferanten, Paketboten von Amazon, Fitnesstrainer, Putzfrauen, Klempner und Yogalehrer. Sie alle näherten sich den Häusern wie Bittsteller und wurden prompt von ihnen geschluckt. Leute kamen, um die Wäsche zu waschen oder zu reinigen, es kamen FedEx- und UPS-Lieferungen, Lieferungen von Hundebetten, Druckerfarbpatronen, Gartenstühlen, Vintage-Filmpostern, DVD-Bestellungen, eBay-Schnäppchen und Impulskäufen, und von Fahrrädern aus dem Versandhandel. Es kamen Leute zu den Häusern, um zu betteln, und es kamen Leute, die etwas verkaufen wollten (warme Decken zu Gunsten der Obdachlosen und die besten Energiedeals für die Hausbesitzer). Geschäftsleute, Fitnesstrainer und Handwerker verschwanden im Innern der Gebäude und kamen wieder heraus, wenn sie mit ihrer Arbeit fertig waren. Die Häuser waren wie Menschen geworden, noch dazu sehr reiche Menschen: Sie gaben sich herrisch und gebieterisch, und hatten ihre ganz eigenen Bedürfnisse, deren Befriedigung sie schamlos einforderten. Andauernd befanden sich Bauarbeiter in der Straße, die mit der Wartung der Häuser beschäftigt waren. Sie bauten Speicher um, reparierten Küchen, durchbrachen Wände oder fügten welche hinzu, und immer stand ein Container oder ein Baugerüst vor einem der Häuser. Der Trend, das Fundament auszuheben und Küchen, Spielzimmer oder andere Räume dort unterzubringen, führte zu endlosen Förderbändern voller Erde, die in die bereitgestellten Container geschüttet wurde. Weil das Erdreich von dem Gewicht des darüberstehenden Hauses zusammengepresst worden war, dehnte es sich, einmal an der Oberfläche, auf ein fünf- oder sechsmal so großes Volumen aus. Dadurch gewann dieses Gegrabe etwas Bizarres, Düsteres, als würde die Erde anschwellen, sich übergeben, sich ihrem eigenen Aushub widersetzen. Viel zu viel Boden schien aus dem Untergrund zu kommen, so als sei es gänzlich unnatürlich, sich so tief ins Erdreich zu wühlen, um sich noch mehr Platz zu verschaffen. Als könnte man bis in alle Ewigkeit weitergraben.
Wenn man ein Haus in der Pepys Road besaß, dann war das so, als befände man sich in einem Spielkasino mit Gewinngarantie. Wohnte man bereits dort, war man reich. Wollte man dort hinziehen, musste man reich sein. Es war das erste Mal in der Geschichte, dass dies der Fall war. Großbritannien war zu einem Land von Gewinnern und Verlierern geworden, und alle Menschen in dieser Straße hatten allein durch die Tatsache, dass sie dort wohnten, gewonnen. Der junge Mann, der an diesem Sommermorgen in die Gegend gekommen war, filmte eine Straße von Gewinnern.
ERSTER TEILDezember 2007
1
An einem regnerischen Tag Anfang Dezember saß eine zweiundachtzigjährige Frau in ihrem Wohnzimmer in der Pepys Road Nummer 42 und schaute durch ihre Spitzenvorhänge auf die Straße hinaus. Ihr Name war Petunia Howe, und sie wartete auf den Lieferwagen von Tesco.
Petunia war der älteste Mensch, der in der Pepys Road lebte, und sie war auch der letzte Mensch, der in der Straße geboren worden war und jetzt noch immer dort wohnte. Aber ihre Verbindung mit diesem Ort ging viel weiter zurück. Ihr Großvater hatte das Haus sozusagen vom Reißbrett weg gekauft, noch bevor es gebaut worden war. Er hatte als Rechtsanwaltsgehilfe in einer Kanzlei in Lincoln’s Inn gearbeitet und war privat wie politisch sehr konservativ gewesen. Und wie bei Rechtsanwaltsgehilfen so üblich, hatte er seinen Beruf an seinen Sohn vererbt, und als der nur Töchter bekam, weiter an den Mann einer seiner Enkelinnen. Und das war Petunias Mann gewesen, der vor fünf Jahren gestorben war.
Petunia sah sich selbst nicht gerade als jemanden, der ein besonders aufregendes Leben geführt hatte. Sie war eher der Ansicht, dass es ziemlich übersichtlich und belanglos gewesen war. Immerhin hatte sie zwei Drittel der gesamten Geschichte der Pepys Road miterlebt und eine ganze Menge dabei gesehen. Sie hatte mehr bemerkt, als sie je zugeben würde, und hatte versucht, so wenig wie möglich über die Dinge zu urteilen. Sie fand, dass Albert genug Urteile für sie beide zusammen gefällt hatte. Die einzige Lücke in ihrem Leben in der Pepys Road war entstanden, als sie Anfang des Zweiten Weltkriegs evakuiert worden war und von 1940 bis 1942 auf einem Bauernhof in Suffolk leben musste. So hatte man verhindern wollen, dass sie der Bombardierung ausgesetzt war. Das war eine Zeit, an die sie auch heute noch lieber nicht dachte, nicht etwa weil jemand grausam zu ihr gewesen wäre – der Bauer und seine Frau waren so freundlich gewesen wie möglich und wie es ihnen die ununterbrochene schwere körperliche Arbeit, aus der ihr Leben bestand, erlaubt hatte –, sondern einfach, weil sie ihre Eltern vermisste und sich nach dem behaglichen und vertrauten Familienleben sehnte, wenn der Vater von der Arbeit nach Hause kam und pünktlich um sechs das Abendessen serviert wurde. Die Ironie der Geschichte war, dass sie die Bombardierung dann doch mitbekam. Es war 1944, um vier Uhr morgens, als eine V2-Rakete gerade mal zehn Häuser weiter einschlug. Petunia konnte sich noch gut daran erinnern, dass die Explosion weniger ein Geräusch als vielmehr eine körperliche Empfindung gewesen war. Sie wurde mit unwiderstehlicher Kraft aus dem Bett gestoßen, so als hätte ein neben ihr liegender Liebhaber sie nicht mehr darin dulden mögen, ohne ihr aber Übles zu wollen. Zehn Menschen starben in dieser Nacht. Das Begräbnis, das in der großen Kirche am Park abgehalten wurde, war ganz fürchterlich. Begräbnisse sollten eigentlich besser an regnerischen Tagen stattfinden, wenn man den Himmel nicht sehen kann. An diesem Tag aber war das Wetter hell, klar und frisch gewesen, und noch Monate später musste Petunia immer wieder daran denken.
Ein Lastwagen kam die Straße entlanggefahren, wurde langsamer und hielt vor ihrem Haus. Der Dieselmotor war so laut, dass er die Fenster zum Klirren brachte. Vielleicht war das endlich ihre Lieferung? Aber dann legte der Lastwagen einen anderen Gang ein und verschwand die Straße hinunter, wobei er mit zweimaligem lauten Gepolter – einmal hoch, einmal runter – über die Straßenschwellen fuhr. Die hatten eigentlich dazu dienen sollen, den Verkehr in der Straße zu reduzieren, aber ihr einziger Erfolg schien zu sein, dass es noch mehr Krach gab, und auch mehr Abgase, denn die Autos wurden vor den Schwellen langsamer und beschleunigten danach umso mehr. Seit man sie eingebaut hatte, war kein einziger Tag vergangen, an dem Albert sich nicht über sie beschwert hätte: buchstäblich kein einziger, von dem Tag an, als die Straße wieder für den Verkehr geöffnet wurde, bis zu dem Tag, an dem er ganz plötzlich starb.
Petunia hörte, wie der Lastwagen weiter unten in der Straße hielt. Eine Lieferung – wohl keine Lebensmittel, und auch nicht für sie. Das war etwas, das ihr in diesen Tagen hauptsächlich an der Straße auffiel: die Lieferungen. Sie wurden immer mehr, während die Straße immer vornehmer wurde. Und hier war sie nun und wartete selbst auf eine Lieferung. Es hatte mal einen Begriff dafür gegeben: das »Fuhrkutschergewerbe«. Sie erinnerte sich, dass ihre Mutter davon gesprochen hatte. Irgendwie dachte man dabei an Männer mit Zylinderhüten und an Pferdegespanne. Jetzt gehöre ich auch zum Fuhrkutschergewerbe, dachte Petunia. Und das in meinem Alter. Bei dem Gedanken musste sie lächeln. Die Lieferung, das waren ihre Lebensmittel, und das Ganze war eine Idee ihrer Tochter Mary gewesen, die in Essex wohnte. Petunia hatte in letzter Zeit Schwierigkeiten mit dem Einkaufen gehabt, keine großen Probleme, aber genug, um ein wenig ängstlich zu werden auf dem Weg zur Hauptstraße und zurück, vor allem, wenn sie etwas mehr zu tragen hatte. Also hatte Mary einen Lieferservice für sie organisiert. Einmal in der Woche sollten alle großen und sperrigen Einkäufe direkt ins Haus geliefert werden, und zwar immer mittwochs zwischen zehn und zwölf. Petunia hätte es natürlich viel lieber gehabt, wenn Mary oder Marys Sohns Graham, der in London wohnte, selbst zu ihr gekommen wäre. Dann hätten sie zusammen einkaufen gehen können, aber davon war nie die Rede gewesen.
Jetzt hörte sie wieder einen Lastwagen, diesmal war es ein noch lauteres Poltern. Er fuhr vorbei, aber nicht weit, und sie hörte, wie er ein paar Meter die Straße hinunter parkte. Durch das Fenster sah sie das Firmenzeichen: Tesco! Ein Mann, der eine große Kiste trug, kam zu ihrem Vorgarten und öffnete die Gartentür geschickt mit der Hüfte. Petunia stand auf, sich vorsichtig mit beiden Armen abstützend, und hielt einen Moment lang inne, um sich zu sammeln. Dann öffnete sie die Haustür.
»Guten Morgen! Alles okay bei Ihnen? Es ist alles so, wie Sie’s bestellt haben. Soll ich es nach hinten bringen? Draußen verteilt jemand Knöllchen, aber ich habe ihm gesagt, er soll das mal schön bleiben lassen.«
Der nette Tesco-Mann trug ihre Einkäufe bis in die Küche und stellte die Sachen auf den Tisch. Mit zunehmendem Alter fiel es Petunia immer mehr auf, wenn andere Leute ihre Kraft und Gesundheit demonstrierten, als wäre es nichts Besonderes. So wie jetzt dieser junge Mann, der mit solcher Leichtigkeit die schwere Kiste auf den Tisch hievte und dann jeweils vier Tüten auf einmal herausnahm. Seine Schultern und Arme wurden noch breiter, während er die Tüten hochhob. Er sah dabei riesengroß aus, wie ein Eisbär beim Bodybuilding.
Petunia war es normalerweise nicht peinlich, wenn ihre Sachen ein wenig alt wirkten, aber wegen ihrer Küche schämte sie sich schon ein bisschen. Wenn Linoleum einmal anfing, schäbig auszusehen, dann aber auch so richtig, selbst wenn es sauber war. Aber dem Tesco-Mann schien das nicht weiter aufzufallen. Er war sehr höflich. Wenn er die Sorte Angestellter gewesen wäre, denen man ein Trinkgeld gibt, dann hätte Petunia ihm ordentlich was zugesteckt, aber als Mary den Lieferservice beauftragt hatte, hatte sie ihr extra gesagt, dass man Supermarktlieferanten kein Trinkgeld gibt. Sie hatte dabei ziemlich genervt geklungen, so als würde sie ihre Mutter gut genug kennen, um zu wissen, was sie jetzt schon wieder dachte.
»Danke«, sagte Petunia. Während sie die Tür hinter ihm schloss, sah sie, dass auf der Fußmatte eine Postkarte lag. Sie bückte sich – ganz vorsichtig – und hob sie auf. Vorne auf der Karte war ein Foto ihres Hauses, Pepys Road 42. Sie drehte die Karte um. Es gab keine Unterschrift, nur eine gedruckte Nachricht. Da stand: »WIR WOLLEN WAS IHR HABT.« Darüber musste Petunia lächeln. Warum in aller Welt sollte irgendjemand das haben wollen, was sie hatte?
2
Der Besitzer des Hauses gegenüber von Petunia Howe, Pepys Road 51, befand sich an seinem Arbeitsplatz in der City. Roger Yount saß am Schreibtisch in seiner Bank, Pinker Lloyd, und rechnete. Er versuchte herauszufinden, ob sein Bonus dieses Jahr die Summe von einer Million Pfund erreichen würde.
Roger war vierzig Jahre alt. Es war ihm in seinem Leben mehr oder minder alles zugeflogen. Er war etwa eins neunzig groß – gerade klein genug, um nicht das Bedürfnis zu haben, seine Größe durch eine gebückte Haltung zu kaschieren. Es gelang ihm sogar, durch seinen hohen Wuchs eine gewisse Leichtigkeit auszustrahlen, so als hätte die Schwerkraft beim Wachsen auf ihn weniger eingewirkt als auf andere, gewöhnlichere Leute. Die sich daraus ergebende Selbstzufriedenheit schien so wohlverdient zu sein, und er hatte offensichtlich ein so geringes Bedürfnis, den Leuten sein Glück unter die Nase zu reiben, dass sogar seine Arroganz charmant wirkte. Hinzu kam, dass Roger durchaus attraktiv war, wenn auch auf eine gewisse unpersönliche Art und Weise, und dass er über gute Manieren verfügte. Er war auf eine gute Schule (Harrow) und eine gute Universität (Durham) gegangen und hatte einen guten Job (in der Londoner Finanzwelt). Sein Timing war perfekt gewesen (kurz nach dem großen Crash und kurz bevor der Finanzsektor von all den Mathematikgenies und Glücksrittern überschwemmt wurde). Er hätte perfekt in das alte System gepasst, als die Leute noch spät zur Arbeit kamen und früh wieder gingen und in der Zwischenzeit eine ausgedehnte Mittagspause genossen; als alles noch davon abhing, wer man war und wen man kannte und wie gut man sich anpassen konnte, und als die höchste Auszeichnung darin bestand, dazuzugehören und als ein guter Teamplayer zu gelten. Er passte aber auch hervorragend in das neue System, in dem vermeintlich alles leistungsorientiert war und in dem die Ideologie hieß: Arbeite hart, zocke hart und mache keine Gefangenen. Man musste mindestens von sieben Uhr morgens bis sieben Uhr abends im Büro sein, es war vollkommen egal, mit welchem Akzent man sprach oder wo man herkam, solange man unter Beweis stellte, dass man der Sache gewachsen war und Geld für seinen Arbeitgeber verdienen konnte. Roger hatte einen genialen Instinkt dafür, wann es gerade passte, die Menschen im neuen Finanzsystem an das alte zu erinnern, ohne das neue System dadurch in Frage zu stellen. Er schaffte es zu signalisieren, dass er problemlos mit dem alten System zurechtgekommen wäre, gleichzeitig aber das gegenwärtige System ganz wunderbar fand. Sogar seine Kleidung – exquisit gearbeitete Anzüge im Stil eines Mannes von Welt, angefertigt von einem Schneider, der sein Atelier nur wenige Meter von der Savile Row entfernt hatte – schien zu sagen, dass er verstand, worum es ging. (Bei der Auswahl hatte ihm seine Frau Arabella geholfen.) Er war ein beliebter Boss, der nie die Geduld verlor und wusste, wann man die Dinge einfach nur laufen lassen musste.
Das war ein nicht zu unterschätzendes Talent. Ein Talent, das in einem guten Jahr schon mal eine Million Pfund wert sein dürfte, sollte man meinen … Aber es war nicht so ganz einfach für Roger, die Höhe seines Bonusses auszurechnen. Das lag daran, dass es bei seinem Arbeitgeber, einer relativ kleinen Investmentbank, zahlreiche Gesichtspunkte gab, die man in Betracht ziehen musste: die Größe des Firmenprofits im Ganzen; den Anteil, den seine Abteilung daran gehabt hatte, die für Transaktionen im Devisenmarkt zuständig war; die Frage, wie die Leistung seiner Abteilung im Vergleich mit der Konkurrenz abschnitt; und eine Reihe anderer Faktoren, von denen die meisten nicht gerade transparent waren und viele von dem subjektiven Urteil abhingen, das man über seine Leistung als Manager fällte. Es hatte ganz den Anschein, als wollte man diesen Entscheidungsprozess mit Absicht verschleiern. Verantwortlich für die Entscheidung war der Vergütungsausschuss, auch Politbüro genannt. Und das Ergebnis all dieser verschiedenen Faktoren war, dass niemand je genau wissen konnte, welche Höhe sein Bonus haben würde.
Auf Rogers Schreibtisch standen drei Computerbildschirme. Einer davon zeichnete die Aktivitäten der Abteilung in Echtzeit nach, ein zweiter war Rogers eigener PC, den er für E-Mails, Instant Messaging, Videokonferenzen und seinen Terminkalender benutzte, und ein dritter spiegelte wider, welchen Verlauf der Devisenhandel seiner Abteilung während des gesamten Jahres genommen hatte. Demzufolge hatten sie einen Gewinn von ungefähr 75000000 £ gemacht, bei einem Umsatz von bisher 625000000 £. Das war nicht schlecht, fand Roger, ohne überheblich klingen zu wollen. Wenn man sich die Zahlen so anschaute, dann wäre es nur gerecht, wenn man ihm einen Bonus von einer Million zugestehen würde. Aber es war ein seltsames Jahr am Finanzmarkt gewesen, seit dem Zusammenbruch von Northern Rock vor einigen Monaten. Im Grunde genommen hatte sich Northern Rock mit ihrem eigenen Geschäftsmodell selbst zerstört. Ihr Kredit war versiegt, die Bank of England hatte geschlafen, und die Börsianer waren in Panik geraten. Seitdem waren die Kredite teurer geworden, und es herrschte eine allgemeine Unruhe am Markt. Roger fand das durchaus in Ordnung, denn im Handel mit Devisen führte Unruhe zu Schwankungen, und Schwankungen führten zu Profit. Es hatte am Devisenmarkt einige ziemlich einleuchtende und relativ sichere Wetten gegen Hochzinswährungen gegeben, zum Beispiel gegen den argentinischen Peso; einige Devisenabteilungen von Konkurrenzfirmen hatten dabei höllisch abkassiert. Deswegen war die fehlende Transparenz ein Problem. Das Politbüro maß ihn womöglich an dem Gewinnergebnis irgendeines Senkrechtstarters, eines idiotischen halbwüchsigen Draufgängers, der ein paar verrückte, nicht abgesicherte Wetten abgezogen hatte. Mit einigen Zahlen konnte man eben unmöglich konkurrieren, wenn man nicht die Art von Risiko einging, die seine Bank für inakzeptabel hielt. Aber leider funktionierte das Ganze so, dass solche Risiken sofort viel akzeptabler wurden, wenn sie eine spektakuläre Geldsumme einbrachten.
Ein weiteres mögliches Problem war, dass die Bank behaupten könnte, in diesem Jahr weniger Gewinn erzielt zu haben, so dass die Boni generell unter den Erwartungen bleiben würden. Es gab tatsächlich Gerüchte, dass Pinker Lloyd einige ziemlich hohe Verluste in der Abteilung für Hypothekenanleihen hatte verkraften müssen. Und dann war da noch der weithin publik gemachte Schlag ins Kontor im Zusammenhang mit dem schweizerischen Tochterunternehmen gewesen, das in einem Übernahmekampf den Kürzeren gezogen und dessen Aktie infolgedessen einen Kurssturz von 30 Prozent erfahren hatte. Das Politbüro könnte behaupten, »es sind harte Zeiten angebrochen«, »der Verlust muss gleichmäßig aufgeteilt werden«, »wir spenden dieses Mal alle ein wenig Blut« und (mit einem Zwinkern) »nächstes Jahr wird alles besser«. Das wäre natürlich eine ziemlich große Scheiße.
Roger rotierte in seinem Drehsessel, damit er aus dem Fenster in Richtung Canary Wharf gucken konnte. Es hatte aufgehört zu regnen, und die früh untergehende Dezembersonne tauchte die Hochhäuser, die normalerweise so massiv und vollkommen unätherisch wirkten, einen Augenblick lang in ein klares goldenes Licht, so dass sie in Flammen zu stehen schienen. Es war halb vier, und er würde noch mindestens vier Stunden arbeiten müssen. Zu dieser Jahreszeit verließ er das Haus, bevor es hell wurde, und kam heim, lange nachdem es dunkel geworden war. Das war jedoch für Roger so selbstverständlich geworden, dass er schon lange keinen Gedanken mehr daran verschwendet hatte. Seiner Erfahrung nach waren diejenigen, die sich über die Arbeitszeiten in der City beschwerten, entweder im Begriff zu kündigen oder kurz davor, gefeuert zu werden. Er drehte sich wieder zurück, denn lieber wandte er sich dem Inneren des Gebäudes zu, wo sich das »Parkett« befand, wie es von allen genannt wurde, in Erinnerung an die alten Zeiten des Börsenparketts, wo die Börsianer schrien, kämpften und mit ihren Papieren herumfuchtelten. Man hätte sich jedoch kaum einen größeren Unterschied zu dieser Tradition vorstellen können als die Abteilung für Devisenhandel. Vierzig Angestellte saßen an ihren Bildschirmen, murmelten etwas in ihre Headsets oder zu ihren Nachbarn, schauten aber im Allgemeinen nur selten von dem stetigen Datenfluss in ihren Computern auf. Rogers Büro hatte Wände aus Glas, aber es gab Jalousien, die er schließen konnte, wenn er etwas Privatsphäre brauchte. Er hatte auch ein ganz neues Spielzeug, einen Apparat, der weißes Rauschen erzeugte. Wenn man ihn einschaltete, war es unmöglich, außerhalb des Raumes etwas mitzuhören. Alle Abteilungsleiter hatten so einen Apparat. Er war echt abgefahren. Meistens jedoch zog Roger es vor, die Tür zu seinem Büro offen zu lassen, damit er etwas von der Geschäftigkeit im Nebenraum mitbekam. Er wusste aus Erfahrung, dass es gefährlich war, sich von seiner Abteilung zu isolieren. Je mehr man darüber Bescheid wusste, was unter seinen Untergebenen vor sich ging, desto weniger bestand die Gefahr böser Überraschungen.
Diese Lektion hatte er unter anderem durch die Art und Weise gelernt, wie er an seinen Job gekommen war. Er war stellvertretender Leiter genau dieser Abteilung gewesen, als die Bank plötzlich stichprobenartige Drogentests machte. Vier seiner Kollegen waren getestet worden, und alle vier waren durchgefallen. Roger war keineswegs überrascht gewesen, denn der Test fand an einem Montag statt, und er wusste nur zu gut, dass sich alle jungen Börsianer am Wochenende vollkommen zudröhnten. (Zwei von ihnen hatten Kokain genommen, einer Ecstasy, und einer hatte Gras geraucht – was Roger etwas bedenklich gefunden hatte, denn in seinen Augen war Marihuana eine Verlierer-Droge). Die vier waren streng verwarnt worden; ihr Boss aber wurde gefeuert. Roger hätte ihm sagen können, was vor sich ging, wenn er gefragt worden wäre, aber das war nicht geschehen. Der Boss hatte Roger die ganze Arbeit aufgehalst, war furchtbar arrogant und durch und durch ein Bankier der alten Schule gewesen. Deswegen hatte es Roger, der sich in zwischenmenschlichen Beziehungen nicht die Mühe machte, auf hinterhältige oder intrigante Methoden zurückzugreifen, nicht leid getan, ihn gehen zu sehen.
Im Grunde genommen war Roger persönlich nicht unbedingt ehrgeizig. Am wichtigsten war ihm, dass das Leben nicht allzu viele Forderungen an ihn stellte. Er hatte sich unter anderem deshalb in Arabella verliebt und sie geheiratet, weil sie die Begabung hatte, das Leben vollkommen mühelos aussehen zu lassen. Das war in Rogers Augen eine nicht zu verachtende Fähigkeit.
Er wollte Erfolg haben, und er wollte, dass man sah, dass er Erfolg hatte, und vor allem wollte er seinen Millionenbonus. Er wollte 1000000 £, weil ihm diese Summe bisher noch niemand ausgezahlt hatte, weil er fand, dass sie ihm zustand, und weil sie ein Beweis für seinen Wert als Mann war. Aber er wollte sie auch, weil er dringend Geld brauchte. Die Summe von 1000000 £ war ursprünglich ein vages, nicht ganz ernst gemeintes Ziel gewesen. Sehr bald aber wurde sie zur unverzichtbaren Notwendigkeit, eine Summe, die er brauchte, um die Rechnungen zu bezahlen und seine Finanzen wieder auf ein festes Fundament zu stellen. Sein Grundgehalt von 150000 £ reichte gerade mal als »Kleidergeld« – wie Arabella es nannte –, denn es deckte nicht einmal seine beiden Hypotheken ab. Das Haus in der Pepys Road war ein Doppelhaus und hatte 2500000 £ gekostet, was er damals für das oberste Ende des Immobilienmarktes gehalten hatte, auch wenn in der Zwischenzeit die Preise noch wesentlich höher gestiegen waren. Sie hatten das Dachgeschoss umgebaut, den Keller ausgehoben, alle Leitungen und Rohre neu verlegt, weil das ohnehin ein Aufwasch war, hatten die Wände im Erdgeschoss durchbrochen, einen Wintergarten angebaut, den seitlichen Anbau erweitert und von oben bis unten alles renoviert (Joshuas Zimmer war voller Cowboy-Motive und das von Conrad voller Astronauten, obwohl er in letzter Zeit Wikinger besser zu finden schien; Arabella dachte bereits über eine Neugestaltung nach). Sie hatten zwei Badezimmer zusätzlich eingebaut und das Hauptbadezimmer erst in ein En-Suite-Bad und dann zu einem Wetroom-Bad umgemodelt, weil letztere gerade schwer in Mode waren. Dann hatten sie es wieder zu einem normalen (wenn auch sehr luxuriösen) Badezimmer zurückgebaut, weil Wetroom-Bäder irgendwie vulgär waren und weil sich die Feuchtigkeit bis ins Schlafzimmer ausbreitete und Arabella fand, dass das ihren Bronchien schadete. Roger hatte ein Büro und Arabella ein Ankleidezimmer. Die Küche war ursprünglich von Smallbone of Devizes, aber Arabella war davon bald nicht mehr so angetan gewesen und hatte stattdessen eine neue deutsche Küche bestellt, mit einer ganz erstaunlichen Dunstabzugshaube und einem riesigen amerikanischen Kühlschrank. Die Wohnung für das Kindermädchen hatte zwei separate Räume und eine eigene Küche, weil Arabella es wichtig fand, dass man das Gefühl hatte, voneinander abgetrennt zu sein, für den Fall, dass sie – wer auch immer sie sein würde – ihren Freund zu Besuch hatte. Es gab darin einen Rauchmelder, der so sensibel war, dass er losging, sobald man sich nur eine Zigarette anzündete. Letztendlich wollten sie dann aber doch kein Kindermädchen, das mit ihnen im Haus wohnte und andauernd unter ihren Füßen herumlief; und einen Untermieter zu haben war total uncool. Das machten nur Leute, die in den Siebzigern steckengeblieben waren. Also stand die Wohnung leer. Das Wohnzimmer war komplett verkabelt (mit CAT-5-Kabel natürlich, wie überall im Haus), und mit dem Bang-&-Olufsen-System konnte man Musik im ganzen Haus hören (mit Ausnahme der Kinderzimmer). Der Fernseher hatte einen Sechzig-Zoll-Plasmabildschirm und gegenüber an der Wand hing eines von Damien Hirsts Spot Paintings, das Arabella in einem Jahr gekauft hatte, als Roger einen recht ordentlichen Bonus erhalten hatte. Betrachtete man den Hirst von einem ästhetischen, kunsthistorischen, inneneinrichtungsrelevanten und psychologischen Standpunkt, so kam man zu dem wohlüberlegten Schluss – fand Roger –, dass er 47000 £ plus Mehrwertsteuer gekostet hatte. Die Möbel nicht eingerechnet, hatten die Younts, inklusive der Rechnungen des Architekten, des Gutachters und der Bauarbeiter, für die Umbauten an ihrem Haus ungefähr 650000 £ bezahlt.
Das alte Pfarrhaus in Minchinhampton in Wiltshire war auch nicht ganz billig gewesen. Es war ein wunderschönes Gebäude aus dem Jahr 1780. Leider wurde der Eindruck von Leichtigkeit und ausgewogenen Proportionen, der durch den georgianischen Baustil entstand, etwas dadurch geschmälert, dass die Innenräume eher klein waren und die Fenster erstaunlich wenig Licht durchließen. Ihr Gebot von 900000 £ war zunächst akzeptiert worden, dann aber wurden sie trotz mündlicher Zusage mit 975000 £ überboten und waren daraufhin gezwungen, ihrerseits ein noch höheres Gebot einzureichen. Das Haus wurde ihnen schließlich für lockere 1000000 £ zugeschlagen. Die Renovierung und generelle Verschönerungsarbeiten hatten 250000 £ verschlungen. Ein Teil davon war für den Rechtsanwalt draufgegangen, der die Rücknahme der vollkommen sinnlosen Denkmalschutzauflagen erwirkte. Das winzige Cottage am unteren Ende des Gartens hatte ebenfalls zum Verkauf gestanden, und sie fanden es absolut notwendig, es dazuzukaufen, denn wenn man Freunde zu Besuch hatte, wurde das Ganze doch etwas eng. Die Verkäufer, ein schwules Pärchen, das ebenfalls zwei Häuser hatte und von dem einer ein Baugutachter war, wussten nur zu gut, dass sie die Younts in der Zange hatten, und weil die Preise überall in die Höhe schossen, hatten sie für das winzige Cottage 400000 £ aus ihnen herausgequetscht. Wie sich dann herausstellte, mussten sie weitere 100000 £ zur Behebung bautechnischer Probleme hinblättern.
Minchinhampton war absolut entzückend – die englische Landschaft ist eben einfach unschlagbar. Da konnte jeder nur zustimmen. Aber immer die Sommerferien dort zu verbringen war dann doch ein wenig schäbig, fand Arabella. Es war ja eigentlich eher ein Wochenendhaus. Also verreisten sie im Sommer zwei Wochen lang woandershin, nahmen ein paar Freunde mit und luden jedes zweite Jahr entweder Rogers oder Arabellas Eltern ein, um eine der zwei Wochen mit ihnen zu verbringen. Der marktübliche Preis für die Art Villa, die sie sich für ihre Ferien vorstellten, lag bei 10000 £ die Woche. Geflogen wurde natürlich Business Class. Wozu hatte man denn schließlich Geld, fand Roger, wenn nicht dafür – gesetzt den Fall, man wäre gezwungen, es in einem Punkt zusammenzufassen, was natürlich unmöglich war, aber was, wenn doch –, dass man nie wieder mit den anderen Losern in der Billigklasse fliegen musste. In zwei guten Bonusjahren hatten sie einen Privatjet gemietet, ein Komfort, den man schwerlich wieder missen wollte, wenn man sich einmal daran gewöhnt hatte, nicht für seine Koffer anstehen zu müssen … Oft verreisten sie auch noch ein zweites Mal im Jahr, manchmal um Weihnachten herum – aber Gott sei Dank nicht dieses Jahr, dachte Roger –, meistens allerdings Mitte Februar oder während der Osterferien. Der genaue Zeitraum hing von den Schulferien der Westminster Under School ab, auf die Conrad ging und die geradezu fanatisch darauf achtete, dass man sein Kind nur während der offiziellen Ferien aus der Schule nahm, ein wenig zu fanatisch, wie Roger fand, da die Kinder, um die es sich handelte, gerade mal fünf Jahre alt waren, aber dafür zahlte man eben 20000 £ Schulgeld im Jahr.
Auch andere Kosten summierten sich, wenn man einmal anfing, darüber nachzudenken. Pilar, das Kindermädchen, kostete 20000 £ im Jahr netto – oder eher 35000 £ brutto, wenn man die ganze verdammte Lohnsteuer dazuzählte. Sheila, das Wochenend-Kindermädchen, bekam weitere 200 £ pro Wochenende, was sich auf ungefähr 9000 £ summierte (obwohl sie sie in bar bezahlten und in den Ferien gar nicht – es sei denn, sie kam mit, was recht oft der Fall war, oder die Agentur vermittelte ihnen jemand anderen). Arabellas BMW M3 »fürs Einkaufen« hatte 55000 £ gekostet, und der Lexus S400, das Familienauto, das eigentlich nur vom Kindermädchen benutzt wurde, um die Kinder zur Schule oder zu Spielnachmittagen zu fahren, 75000 £. Roger hatte darüber hinaus noch einen Mercedes E500, den ihm sein Büro zur Verfügung gestellt hatte und für den er nur die Kraftfahrzeugsteuer bezahlte, die sich auf ungefähr 10000 £ im Jahr belief. Er benutzte das Auto jedoch so gut wie nie, weil er es demonstrativ vorzog, mit der U-Bahn zu fahren. Das war einigermaßen erträglich; er musste das Haus um Viertel vor sieben verlassen und kam um acht Uhr abends wieder heim. Weitere Posten waren 2000 £ im Monat für Kleidung, ungefähr dieselbe Summe für die anfallenden Betriebskosten (auf beide Häuser aufgeteilt), eine Steuernachzahlung von ungefähr 250000 £ vom letzten Jahr, Rentenbeiträge »in mindestens sechsstelliger Höhe« – wie sich sein Steuerberater ausgedrückt hatte –, 10000 £ für ihre alljährliche Sommerparty und dann die unglaublich hohen Summen, die das Leben in London kostete – Restaurants, Schuhe, Parkgebühren, Kinokarten, Gärtner. Man hatte das Gefühl, dass das Geld jedes Mal, wenn man irgendwo hinging oder irgendetwas tat, nur so aus einem herausschmolz. Das alles machte Roger nichts aus, er war durchaus bereit, das Spiel mitzuspielen. Es bedeutete jedoch, dass er, wenn er dieses Jahr nicht einen Bonus von einer Million Pfund bekam, durchaus in Gefahr geriet, bankrott zu gehen.
3
Es war später Nachmittag. Roger saß auf einem der Sofas in seinem Büro, gegenüber hatte auf der einen Seite der Mann Platz genommen, der ihm mehr als jeder andere dabei helfen konnte, seinen Millionenbonus zu verdienen, und auf der anderen Seite der Mann, dem definitiv die wichtigste Rolle bei der Entscheidung zufiel, ob er ihn tatsächlich bekam.
Ersterer war sein Stellvertreter Mark. Er war noch nicht ganz dreißig, mehr als zehn Jahre jünger als Roger und hatte von all der Arbeit in Innenräumen und vor Computerbildschirmen eine ganz blasse Gesichtsfarbe. Mark hatte die Angewohnheit, sich ununterbrochen zu bewegen, aber so, dass man es fast nicht mitbekam. Er verlagerte sein Gewicht von einem Fuß auf den anderen, fasste an seine Armbanduhr, prüfte den Inhalt seiner Hosentaschen oder machte kleine Zuckungen mit seinen Gesichtsmuskeln, als wollte er den Sitz seiner Brille korrigieren. Das Ganze hatte eine ähnliche Wirkung wie die Angewohnheit mancher Leute, in Gesprächen andauernd den Vornamen der Person zu benutzen, mit der sie sich gerade unterhielten. Man konnte das jahrelang mitmachen, ohne dass es einem auffiel, aber wenn man es einmal gemerkt hatte, war es fast unmöglich, sich davon nicht ablenken zu lassen – genauer gesagt war es fast unmöglich, nicht das Gefühl zu bekommen, dass dieses Verhalten einzig und allein darauf abzielte, einen in den Wahnsinn zu treiben. Genau das war es, was Marks ewige Zappelei in Roger auslöste. Im Moment spielte er gerade mit seinem Montblanc-Kugelschreiber herum.
In vieler Hinsicht war Mark der perfekte Stellvertreter. Er arbeitete hart, machte nie einen Fehler, war nicht allzu offensichtlich an Rogers Job interessiert, und wenn man mal von seinem ununterbrochenen Herumgezappel absah, schien er nie aus der Fassung zu geraten. Manchmal entstand der vage Eindruck, dass er die Dinge ein bisschen zu fest unter Kontrolle hatte, und er war die Art Mensch, bei der man ein heimliches Laster vermutete. Hätte er sich als pädophil oder als Bondage-Freak herausgestellt, oder wäre unter seinen Bodendielen eine zerstückelte Leiche aufgetaucht, dann wäre Roger zwar überrascht gewesen, aber nicht allzu überrascht. Doch hätte es ihn eindeutig erstaunt, wenn er gewusst hätte, was Mark tatsächlich über ihn dachte und was für ein starkes und persönliches Interesse sein Stellvertreter an seinem Privatleben hatte – wo Roger wohnte, wo er zur Schule gegangen war, wie seine Kinder hießen und wann sie Geburtstag hatten, wofür seine Frau Geld ausgab und wie er seine Freizeit verbrachte. Hätte Roger das gewusst, hätte ihn das vollkommen aus der Fassung gebracht, aber er hatte davon keine Ahnung, und deshalb war das auch nicht der Grund, warum Mark Roger verunsicherte.
Es lag vielmehr daran, dass Roger zu einer Zeit zu Pinker Lloyd gekommen war, als es im Finanzgeschäft noch mehr um persönliche Beziehungen und weniger um Mathematik ging. Er war in den vergangenen Jahrzehnten erfolgreich gewesen und vorangekommen, doch es ließ sich nicht mehr leugnen, dass er mit den grundlegenden Veränderungen, die im Wesen seiner Arbeit vor sich gegangen waren, nicht in jeder Hinsicht Schritt gehalten hatte. Der Devisenhandel basierte auf der Handhabung unendlich komplizierter mathematischer Formeln, die der Bank subtile und lukrative Positionierungsstrategien erlaubten. Im Klartext bedeutete dies, dass die Bank Wetten auf beiden Seiten eines Handelsgeschäfts gleichzeitig abschließen konnte. Solange nicht etwas vollkommen Unvorhergesehenes geschah – etwas außerhalb der Parameter und Prognosen, die in die Wetten eingebaut waren – und solange die Algorithmen stimmten, hatte man eine absolute Gewinngarantie. Es gehörte zu den Gesetzen der Branche, dass man kein Geld verdienen konnte, ohne Risiken einzugehen, aber dank der Wunder der modernen Finanzinstrumente konnte man dieses Risiko fast gänzlich ausschalten. Und natürlich tat die Bank alles nur irgend Mögliche, um sich selbst zu helfen. Ein Teil des Handels war algorithmisch, was hieß, dass seine Basis rein mathematischer Natur war und er so konfiguriert wurde, dass er von der Eigendynamik der Preisentwicklung profitierte: Wenn die Preise sich in eine bestimmte Richtung bewegten, dann war es mehr als wahrscheinlich, dass sie am nächsten Tag dasselbe tun würden. Also benutzten manche der Händler in der Abteilung eine Software, mit Hilfe derer man aus genau diesem Phänomen Profit schlagen konnte. Ein Teil der Handelsgeschäfte bestand aus dem sogenannten Flash Trading, bei dem man seinen Profit aus dem Bruchteil einer Sekunde schlug, der zwischen dem Plazieren eines Gebots an den Märkten und der tatsächlichen Auftragsausführung lag. Wieder ein anderer Teil des Handels zog seine Informationen aus Datenbanken, in denen gespeichert war, was Kunden in der Vergangenheit bezahlt hatten, und benutzte diese Daten, um in Echtzeit vorherzusagen, was sie in der Gegenwart bezahlen würden, damit die Bank ein Preisangebot machen konnte, das der Kunde akzeptieren würde, das aber gleichzeitig einen Gewinn für Pinker Lloyd garantierte. All das war schön und gut, und Roger konnte das Ganze im Wesentlichen sehr wohl nachvollziehen – aber das war nicht dasselbe wie die mathematischen Prinzipien selbst zu verstehen. Das ging mittlerweile weit über seine Fähigkeiten hinaus. Mark hingegen verstand diese Prinzipien. Er hatte seine Promotion in Mathematik abgebrochen, um für Pinker Lloyd zu arbeiten. Roger war nicht gerade begeistert davon, dass er einen nicht mehr ganz so sicheren Stand hatte und dass er nicht mehr in der Lage war, bis ins kleinste Detail hinein zu erklären, was genau bei den Handelsgeschäften vor sich ging, für die seine Abteilung zuständig war. Aber andererseits war auch sonst kaum jemand dazu in der Lage. Das lag einfach in der Natur der Arbeit, die derzeit am Finanzmarkt üblich war.
»Kann ich noch einen weiteren Punkt ansprechen?«, fragte Mark, während er den ersten Stapel mit Zahlenmaterial, den er mitgebracht hatte, auf den Tisch legte und eine weitere Akte in die Hand nahm. »Ich habe hier noch ein paar Vorschläge für diese Sache mit der neuen Software. Ich dachte, Sie wollten sich das vielleicht mal anschauen?«
Mark hob zum Ende seines Satzes hin die Stimme, wodurch das, was er sagte, fast zur Frage wurde, aber eben nicht ganz. Er hielt die Akte so in die Höhe, dass der dritte Mann im Raum Gelegenheit hatte, einen Blick darauf zu werfen, falls er das wollte. Dieser Mann war Rogers höchster Vorgesetzter, Lothar Billinghoffer. Lothar war fünfundvierzig Jahre alt und kam aus Deutschland. Vor ein paar Jahren hatte man ihn von Euro Paribas abgeworben. Alle Firmen haben einen gewissen Stil, was das persönliche Auftreten anbetrifft. Pinker Lloyds Stil war ruhig und gelassen, und niemand verkörperte das so perfekt wie der deutsche Vorstandsvorsitzende. Er sah unglaublich fit und gesund aus für einen Mann, der zwölf bis vierzehn Stunden am Tag arbeitete, auch wenn er, wenn man dicht vor ihm stand, älter wirkte als von Weitem. Lothar war ein fanatischer Anhänger aller Outdoor-Sportarten, er verbrachte seine Wochenenden mit Wanderungen in den Bergen oder fuhr auf Skiern an ihnen herab, oder er hängte sich im Trapez über die Bordwand einer Jacht. Sein Gesicht war oft von der Sonne oder vom Wind ganz rot, und seine Augen hatten vom ständigen Zusammenkneifen lauter kleine Fältchen. Lothar und Mark wirkten, wenn sie nebeneinander standen, wie eine Farbpalette für Männergesichter: Hier haben wir, was passiert, wenn man einen Orientierungslauf durch die Black Mountains macht, und hier können Sie sehen, was dabei herauskommt, wenn man nie freiwillig von seinem Computerbildschirm aufschaut.
Normalerweise war Lothar bei solchen Besprechungen nicht dabei. Dass er einfach mal bei seinen Leuten vorbeischaute, war eine neue Angewohnheit von ihm. Er hatte irgendein Buch über »dekonstruierte« Managementmethoden gelesen, aber da niemand weniger dekonstruiert war als Lothar, hatte er einen genauen Plan. Der sah so aus, dass er eine halbe Stunde pro Woche damit verbrachte, nach einem angeblichen Zufallsprinzip durch das Gebäude zu laufen, sich mit Leuten zu unterhalten und an Besprechungen teilzunehmen. So kam es auch, dass er nun »ganz zufällig« bei Rogers täglicher Besprechung mit seinem Stellvertreter anwesend war.
Man hätte meinen können, es würde Roger nervös machen, in Gegenwart Lothars über Software-Probleme zu sprechen. Wie jeder in der Finanzwelt wusste, war alles, was mit neuer Software zu tun hat, garantiert ein absoluter Albtraum. Aber Mark trat nie mit einem Problem an Roger heran, für das er nicht entweder bereits eine Lösung oder wenigstens den Ansatz einer Lösung hatte. Seine Abteilung arbeitete mit der IT-Abteilung und einem externen Unternehmen zusammen, um ein neues, maßgeschneidertes Computerprogramm zu erstellen, das die Datenanzeige auf den Bildschirmen der Händler optimieren sollte. Im Idealfall würde ein solches Programm ein Maximum an Informationen mit einem Minimum an Datengewirr kombinieren und die größtmögliche Anpassung an die persönlichen Bedürfnisse der einzelnen Händler erlauben (denn jeder von ihnen hatte seine eigene Vorstellung davon, wie sein Bildschirm auszusehen hatte). Darüber hinaus sollte das Ganze auch noch so schnell wie möglich erfassbar sein. Roger war nicht allzu sehr an dieser Sache interessiert, aber das Gleiche konnte man eigentlich über den größten Teil seiner Arbeit sagen. Er war jedoch immer bereit dazu, in seiner umgänglichen, ausgeglichenen Art irgendeine Meinung zu vertreten. Das schien aber in diesem Fall nicht nötig zu sein. Marks Tonfall implizierte, dass er wusste, wie beschäftigt Roger war, dass es sich nicht um ein dringendes Problem handelte und es vollkommen in Ordnung wäre, wenn Roger es vorzog, auf eine neue, verbesserte Version der Software zu warten, bevor er sich dazu herabließ, einen Blick darauf zu werfen. Er ließ also deutlich durchscheinen, dass seine Frage eigentlich pro forma war. Aber sie durfte natürlich nicht zu pro forma wirken, denn dann hätte es so ausgesehen, als würde er auf Rogers Meinung nichts geben. Was selbstverständlich niemals, auf gar keinen Fall, den Tatsachen entsprach. All dies gehörte zu den Gründen, warum Mark ein perfekter Stellvertreter war, so perfekt, dass es Roger fast unheimlich wurde. Lothar machte keine Anstalten, die Akte in die Hand zu nehmen. Einen Moment lang dachte Roger, es wäre ein gutes Beispiel für das Vertrauen, das er in seinen Stellvertreter hatte – und daher ein Beweis für seine Versiertheit im Dekonstruierten Management –, wenn er keinen Blick auf die Unterlagen werfen würde. Aber dann folgte er plötzlich einer winzigen blitzartigen Regung seines Instinkts und tat das Gegenteil.
»Schauen wir doch mal rein«, sagte Roger. Mark legte seinem Vorgesetzten ein paar Screenshots vor. Und tatsächlich, die Screenshots wirkten eine Spur chaotisch und überfüllt. Auf einem von ihnen waren acht verschiedene Diagramme zu sehen. Roger und sein Stellvertreter blickten einander an. Keiner von ihnen sah zu Lothar hinüber, der in Marks Fall der Vorgesetzte seines Vorgesetzten war.
»Nein«, sagte Roger. »Immer noch zu viel.«
Mark senkte leicht den Kopf. Weil er gleichzeitig an seinem Kuli herumspielte, wirkte das Ganze, als würde er in einer Geste der Selbsterniedrigung die Hände ringen.
»Ich lasse es zurückgehen, mit dem Hinweis, dass Sie noch nicht zufrieden waren.« Er nickte und verließ das Büro rückwärts in Richtung des Parketts.
»Gut«, sagte Lothar. Das war eines der wenigen Wörter, bei denen sein deutscher Akzent ganz schwach zum Vorschein kam.
Roger stand auf, streckte sich zu seiner vollen Größe und ging in Richtung der Tür, die Mark beim Hinausgehen hinter sich geschlossen hatte. Er öffnete die Jalousien mit einem Knopfdruck und schaute nach draußen, wo seine Kollegen in den verschiedensten Körperhaltungen auf ihren Stühlen saßen. Manche beugten sich nah an den Bildschirm heran, andere saßen zusammengekrümmt oder nach hinten gekippt, wieder andere waren aufgestanden und gingen hin und her, während sie in ihre Headsets sprachen. Die Sonne war untergegangen, was die Lichter in dem zweiten Canary Wharf Tower noch heller erscheinen ließ. Die einzigen Leute, die aus dem Fenster schauten, telefonierten gerade; sie kauften oder verkauften. Ein paar seiner Kollegen nickten und grinsten Mark an, während er an ihnen vorbeiging. Roger erwischte sich dabei, wie er einen Augenblick lang an seine Million Pfund dachte. Dann riss er sich zusammen und wandte seine Aufmerksamkeit wieder Lothar zu.
»Das sind gute Leute da draußen«, sagte er. »Sie arbeiten hart und können trotzdem das Leben genießen. Wie Kids heutzutage halt so sind.«
»Die Zahlen sehen ziemlich gut aus«, sagte Lothar in neutralem Ton.
Ja!, dachte Roger.
4
Ahmed Kamal, dem der Laden in Hausnummer 68 am Ende der Pepys Road gehörte, wurde um 3.59 Uhr morgens wach, genau eine Minute bevor sein Wecker klingelte. Durch lange Übung war er in der Lage, seine Hand auszustrecken und den Knopf auf der Digitaluhr herunterzudrücken, ohne dabei ganz aufzuwachen. Dann rollte er wieder auf die andere Seite und schmiegte sich an seine Frau Rohinka, die noch in völligem Tiefschlaf versunken war.
Ahmed war daran gewöhnt, früh aufzuwachen. Es machte ihm nicht besonders viel aus, aber er verließ nicht gerne das Bett, wenn Rohinka so warm und das Haus so kalt war. In einer weit entfernten Vergangenheit, als sie noch keine Kinder hatten, war das Heizungssystem so eingestellt gewesen, dass es sich einschaltete, wenn er aufstand. Aber das Haus war klein. Es hatte auf jeder Etage nur zwei Räume, und das Kinderzimmer befand sich genau über der winzigen Küche. Wenn der Heizkessel anging, machte er ein Geräusch, das zwar nicht besonders laut war, aber durch irgendeine dunkle Magie der Schallleitung ihren Sohn Mohammed aus dem Schlaf riss, gerade so, als wäre ein knatterndes Motorrad vorbeigefahren. Mohammed, der achtzehn Monate alt war, weckte dann garantiert die vierjährige Fatima auf, die ihrerseits sofort ins Schlafzimmer marschiert kam und Rohinka aufweckte, so dass der Tag bereits um vier Uhr morgens auf dem besten Wege war, ein Fiasko zu werden. Die einzige Lösung war, die Heizung erst später am Morgen einzuschalten und einfach mehr anzuziehen. Und genau das tat Ahmed. Aber bevor er aufstand, blieb er noch eine Weile im warmen Ehebett liegen und zählte langsam bis hundert.
Genau bei hundert kletterte er aus dem Bett. Das war Teil eines festgelegten Tagesablaufs. Ahmed war nämlich fest davon überzeugt, dass er keine Sekunde länger warten durfte, sonst würde er gar nicht mehr aufstehen. Dann zog er zwei Gap-T-Shirts an, eins in Medium und eins in Extra Large, ein dickes Baumwollhemd, das ihm seine Mutter aus Lahore geschickt hatte, einen Kaschmirpullover, den Rohinka ihm zu Weihnachten geschenkt hatte, ein Paar Boxershorts, zwei Paar Socken, eine dicke braune Hose und schließlich noch ein Paar fingerlose Handschuhe. Rohinka lachte immer darüber, wie schäbig die Handschuhe aussahen, aber sie taten ihm gute Dienste. Vor allem bei der ersten Tagesaufgabe, die darin bestand, die Zeitungen reinzuholen, die Verpackung und das Plastikband aufzuschneiden und die Lieferungen und täglichen Schaufensterauslagen fertig zu machen. Ahmed ging langsam nach unten und vermied dabei die dritte, fünfte und achte Stufe, die alle knarrten. Er erreichte die Küche, ohne Mohammed aufzuwecken. Der Prediger in der Wimbledon-Moschee sprach manchmal von dem Jihad gegen die kleinen Versuchungen und Faulheiten, von dem Jihad, aufzustehen und morgens sein Gebet zu verrichten. Wenn Ahmed noch vor der Morgendämmerung unten in der Küche stand, glaubte er zu wissen, was der Imam meinte.
Er machte sich einen Tee, nahm etwas von dem Naan von gestern aus dem Brotkasten und ging nach vorne, um den Laden zu öffnen und die Zeitungen reinzuholen. Ahmed liebte seinen Laden, liebte die Überfülle, die unglaubliche Menge an Zeug, die sich auf engstem Raum drängte, und das Gefühl der Sicherheit, das ihm das alles gab. All diese wahnwitzige Anhäufung von Druckerschwärze – The Daily Mail, The Daily Telegraph, The Sun, The Times, Top Gear, The Economist, Women’s Home Journal, Heat, Hello!, The Beano und Cosmopolitan, die zahllosen Sorten von industriell hergestellten Süßigkeiten und Schokoladen, die gebackenen Bohnen und das weiße Brot, Marmite und Instantsuppen und die ganzen anderen ungenießbaren Sachen, die die Engländer so aßen, und die Müllbeutel, die Aluminiumfolie, Zahnpasta und Batterien (hinterm Ladentisch, wo man sie nicht stehlen konnte), die Rasierklingen, Schmerztabletten und Keine-Reklame-Aufkleber, die er erst letzte Woche ins Sortiment genommen hatte und schon zweimal hatte nachbestellen müssen, das Achtzig-Gramm-Laserdruckerpapier und die DIN-A4-Umschläge, die so beliebt geworden waren, seit man das Preissystem bei der Post umgestellt hatte, der Kühlschrank voll von Erfrischungsgetränken und der daneben voller Alkohol, die Ribena-Flaschen und das Fruchtsaftkonzentrat, der Kreditkartenautomat, das Aufladegerät für die Fahrkartenchips und die Lotterie-Annahmestelle – all das fühlte sich gemütlich und behaglich und sicher an, es war sein ureigenster Ort, und das vor allem frühmorgens, wenn er den Laden ganz für sich hatte. Das gehört mir, dachte er, das ist alles meins. Ahmed drehte die Lautstärke des CD-Spielers hinter dem Ladentisch herunter und drückte dann auf die Play-Taste. Ganz leise hörte er das Lied »My Ummah« von Sami Yusuf. Später am Tag würde er dann auf das Radio und den Sender Capital Gold umschalten. Nicht alle Leute mochten Sami Yusuf, aber keiner hatte etwas gegen Oldies. Und dann musste er sich auch schon zum ersten Mal an diesem Tag ärgern: Dieser dämliche Mistkerl Usman hatte wieder einmal sein Unwesen getrieben. Die Regale neben dem Ladentisch, wo der Alkohol stand, waren von einem Rollo verdeckt. Das Gleiche galt für den Kühlschrank, in dem Bier und Weißwein aufbewahrt wurden.
Usman war Ahmeds jüngerer Bruder, ein nicht sehr erwachsener (fand zumindest Ahmed) streitsüchtiger (fanden alle) achtundzwanzigjähriger Mann, der seine Zeit zwischen der Arbeit im Geschäft und einem Promotionsstudium in Maschinenbau aufteilte (und in Ahmeds Augen war das eher ein Studium in Anführungszeichen). Entweder machte Usman gerade eine sehr fromme Phase durch, oder er tat nur so, wobei Ahmed die zweite Möglichkeit für wesentlich wahrscheinlicher hielt. Was auch immer zutraf, er machte ein Riesentheater aus seiner Abneigung gegen den Verkauf von Alkohol oder Zeitschriften mit nackten Frauen auf dem Cover. Muslime durften nicht blablabla. Als wüssten nicht alle in der Familie sehr wohl über diese Dinge Bescheid. Aber sie kannten eben auch die wirtschaftlichen Zwänge, denen sie unterworfen waren. Es gab keinen Grund dafür, das Rollo runterzulassen. Das geschah nur in den Zeiträumen, für die das Geschäft keine Lizenz besaß. Auf diese Weise signalisierten sie den Kunden, dass es im Augenblick illegal war, Alkohol zum Verkauf anzubieten; aber gestern Abend hatten sie den Laden um elf geschlossen, und ihre Lizenz erlaubte es ihnen ausdrücklich, bis elf Uhr abends Alkohol zu verkaufen. Usman hatte gestern Abend als Letzter den Laden verlassen, und sein neuester Trick bestand darin, die Rollos runterzulassen, sobald Ahmed weg war. Dann durfte man raten, ob er seine Skrupel dennoch überwunden und den Ungläubigen Alkohol verkauft hatte. Alles nur Augenwischerei.
Ahmed schloss die Eingangstür auf und hievte das untere Ende des Rollladens hoch. Das war immer der schwierigste Teil. Dann schob er den Rollladen so leise wie möglich nach oben unter die Markise. Es war ein kalter Tag, und sein Atem dampfte in alle Richtungen. Um die Ecke konnte er das Surren des elektrischen Milchwagens hören. Er musste ihn gerade verpasst haben. Ahmed zog leise schnaufend die Zeitungen ins Ladeninnere und machte die Tür wieder zu. An schlechten Tagen, wenn Rohinka mit den Kindern beschäftigt war und er den ganzen Tag im Laden zu tun hatte, war dieser kurze Moment seine einzige sportliche Betätigung.
Dann machte er sich an das Auspacken und Auslegen der Zeitungen und legte die Stapel für die drei Zeitungsausträger zurecht, die immer um kurz nach sechs kamen. Dabei schimpfte er die ganze Zeit vor sich hin. Er liebte Usman, keine Frage, aber er war unbestreitbar ein mieses kleines Arschloch. Wenn sein kostbares Gewissen es ihm nicht erlaubte, Alkohol zu verkaufen, dann sollte er das einfach klipp und klar sagen, dann hätte ihm Ahmed nämlich mal so richtig den Kopf waschen können und hätte – das war natürlich der eigentliche Grund dafür, warum Usman nicht offen Farbe bekannte – ihre Mutter in Lahore über Skype angerufen. Ha! Das wäre mal so ein richtiges Vergnügen. Ein Klassiker. Mrs Kamal würde schreien, toben und kreischen. Sie würde jeden einzelnen Fehltritt Usmans anprangern, nichts auslassen und nichts beschönigen, und dann würde sie all die wunderbaren Dinge aufzählen, die man für ihn getan hatte. Als Nächstes würde sie in grellen Farben die Kluft zwischen Usmans Schlechtigkeit und der Güte seiner Familie beschreiben und Allah anflehen, er möge ihr doch sagen, was sie getan hatte, um ein solches Schicksal zu verdienen. Sie würde Allah bitten, dass er sie auf der Stelle töte, um ihr weitere Beweise einer so himmelschreienden Undankbarkeit zu ersparen. Sie würde so richtig in die Luft gehen, ja geradezu die Erdumlaufbahn verlassen. Und das wäre erst der Anfang. Das Aufwärmprogramm sozusagen. Sie würde Usman derart die Meinung geigen, dass er womöglich sofort tot umfiel. Die Welt würde erkennen, dass Pakistan seine atomaren Abschreckungswaffen überhaupt nicht nötig hatte, denn es hatte ja bereits Mrs Kamal senior.





























