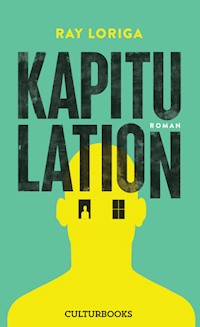
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gewinner des Premio Alfaguara de Novela »Eine mitreißende Parabel auf unsere Gesellschaften, in der jeder jeden beobachtet und beurteilt.« Jury des Premio Alfaguara Zehn Jahre sind seit dem Ausbruch des Krieges vergangen, und der Erzähler weiß noch immer nicht, wofür seine im Krieg verschollenen Söhne überhaupt gekämpft haben. Er und seine Frau bewirtschaften ihren Hof, bis angeordnet wird, dass alle Bewohner der Gegend in die neue Hauptstadt umziehen müssen. Diese Stadt erscheint zunächst als wahres Paradies. Unter einer atemberaubenden Glaskuppel findet sich ein endloses Gewirr aus durchsichtigen Straßenzügen, Gebäuden, Geschäften. Für alles Lebensnotwendige ist gesorgt, und die Frau lebt sich schnell in ihr neues Leben ein. Doch der Mann findet keine Ruhe in dieser vollkommenen Transparenz, in der es weder Geheimnisse noch blickdichte Mauern gibt. Wer gegen die unausgesprochenen Regeln verstößt, muss mit den schlimmsten Konsequenzen rechnen. Wird der Erzähler am Ende kapitulieren, oder gelingt ihm die Flucht aus diesem Albtraum? Eine eindringliche Erzählung über kollektive Manipulation und die Anstrengungen, die wir unternehmen, um uns Liebe, Hoffnung und Menschlichkeit zu bewahren. »Loriga gehört zu der exklusiven Gruppe von Schriftstellern, die – wie Houellebecq und Murakami – die Belletristik des 21. Jahrhunderts neu definieren.« Wayne Burrows, The Big Issue »Ein packender, origineller Roman und ein großer Triumph.« WIRED
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impressum
Deutschsprachige eBook-Ausgabe: © CulturBooks Verlag 2022
Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg
Tel. +4940 31108081, [email protected]
www.culturbooks.de
Alle Rechte vorbehalten
Erstmals erschienen unter dem Originaltitel RENDICIÓN
(Premio Alfaguara de novela 2017)
bei Alfaguara, Penguin Random House Grupo Editorial.
© 2017, Ray Loriga
Die Übersetzung dieses Buches wurde unterstützt
durch die Acción Cultural Española, AC/E.
Übersetzung: Alexander Dobler
Redaktion: Jan Karsten
Umschlaggestaltung: Cordula Schmidt Design, Hamburg
Umschlagillustration: Alessandro Gottardo
ISBN 9-783-95988-223-1
Über das Buch
Zehn Jahre sind seit dem Ausbruch des Krieges vergangen, und der Erzähler weiß noch immer nicht, wofür seine im Krieg verschollenen Söhne überhaupt gekämpft haben. Er und seine Frau bewirtschaften ihren Hof, bis angeordnet wird, dass alle Bewohner der Gegend in die neue Hauptstadt umziehen müssen.
Diese Stadt erscheint zunächst als wahres Paradies. Unter einer atemberaubenden Glaskuppel findet sich ein endloses Gewirr aus durchsichtigen Straßenzügen, Gebäuden, Geschäften. Für alles Lebensnotwendige ist gesorgt, und die Frau lebt sich schnell in ihr neues Leben ein. Doch der Mann findet keine Ruhe in dieser vollkommenen Transparenz, in der es weder Geheimnisse noch blickdichte Mauern gibt. Wer gegen die unausgesprochenen Regeln verstößt, muss mit den schlimmsten Konsequenzen rechnen. Wird der Erzähler am Ende kapitulieren, oder gelingt ihm die Flucht aus diesem Albtraum?
Eine eindringliche Erzählung von den Anstrengungen, die wir unternehmen, um uns Liebe, Hoffnung und Menschlichkeit zu bewahren.
Über den Autor
Ray Lorigan
Kapitulation
Roman
»Wer lebt denn schon mehr als vierzig Jahre?Ich sage Ihnen, wer: Dummköpfe und Schurken.« Fjodor Dostojewskij
»Die anderen Menschen fand ich in derentgegengesetzten Richtung …«e Thomas Bernhard
TEIL I
Unser Optimismus ist unbegründet. Es gibt keinen Anlass für die Annahme, Besserung wäre in Sicht. Er wächst von ganz allein, unser Optimismus, wie Unkraut, nach einem Kuss, einem netten Gespräch, einem guten Glas Wein, auch wenn kaum noch etwas davon übrig ist. Ganz ähnlich ist es mit dem Kapitulieren: Eines schlechten Tages, in der Dämmerung, keimt die giftige Pflanze der Niederlage und gedeiht, genährt durch etwas Belangloses, etwas, was uns zuvor, unter besseren Umständen, nicht das Geringste ausgemacht hätte. Und wenn sie schließlich die Grenze unserer Belastbarkeit durchbricht, vernichtet sie uns. Aus heiterem Himmel zerstört uns etwas, dem wir vorher kaum Beachtung geschenkt haben, als wären wir in die Falle eines geschickteren Jägers getappt, die wir nicht bemerkten, weil wir abgelenkt waren und auf den Köder starrten. Allerdings will ich nicht bestreiten, dass wir selbst, solange wir konnten, mit denselben Mitteln gejagt haben, mit Fallen, Lockvögeln und allerlei groteskem, aber äußerst effektivem Mummenschanz.
Betrachtet man den Garten des Hauses genauer, wird einem sofort klar, dass er schon bessere Tage gesehen hat und dass der leere Pool sehr gut zum Brummen der Flugzeuge passt, die jede Nacht unser Anwesen heimsuchen, wie übrigens auch alle anderen Anwesen in unserem Tal. Wenn sie ins Bett geht, versuche ich sie zu trösten. Dabei weiß ich ganz genau, dass gerade etwas zusammenbricht und dass es uns nicht gelingen wird, es wieder zu reparieren. Jede Bombe in diesem Krieg reißt ein Loch, das wir nie wieder stopfen können. Das weiß sie genauso gut wie ich, auch wenn wir es vor dem Einschlafen verdrängen, auf der Suche nach etwas Ruhe, die wir nicht mehr finden, auf der Suche nach einer längst vergangenen Zeit. Manchmal lassen wir auch der Erinnerung freien Lauf, damit wir besser einschlafen können.
In jener anderen Zeit genossen wir all das, wovon wir annahmen, dass wir es für immer hätten. So erfrischte uns an heißen Tagen das kühle Wasser des Sees, den wir einen See nannten, obwohl es eigentlich nicht viel mehr war als eine große Pfütze. Er bot uns Raum für allerlei Vergnügungen und sichere Abenteuer. Was natürlich ein Widerspruch in sich ist, »sichere Abenteuer«, ein Widerspruch, der uns aber damals nicht aufgefallen ist.
Wir besaßen ein kleines Boot, mit dem die Kinder stundenlang spielten, sie wären Piraten. Und gelegentlich nahm ich sie, meine Frau, damit an Sommerabenden »raus aufs Wasser« – so nannten wir das –, wo wir uns unseren Gedanken hingaben. Dabei schwiegen wir, ganz entspannt und ruhig.
Gestern kam ein Brief von Augusto, unserem Sohn, unserem Soldaten, durch den wir erfuhren, dass er vor einem Monat noch am Leben war, auch wenn das keineswegs heißt, dass er nicht heute bereits tot sein könnte. Die Freude, die wir beim Lesen empfinden, lässt auch unsere Furcht wieder ein kleines bisschen größer werden. Seit die Übergangsregierung beschlossen hat, die Übertragung der Pulsationen auszusetzen, warten wir wieder auf den Postboten wie zu Zeiten unserer Großeltern. Einen anderen Kommunikationsweg gibt es nicht. Wenigstens haben wir von Augusto im letzten Monat eine Nachricht erhalten. Von Pablo hingegen haben wir schon seit fast einem Jahr nichts mehr gehört. Als sie zur Front einberufen wurden, gaben uns die Pulsationen noch kontinuierlich Auskunft über das Schlagen ihrer Herzen. Sie meint, fast wäre es so gewesen, als hätte sie unter ihrem eigenen Herzen die kleinen Herzen der beiden pochen gespürt, wie während ihrer Schwangerschaft. Nun bleibt uns nur, in aller Stille davon zu träumen, dass sie noch leben. Die Eltern kämpfen einen anderen Krieg als die Männer an der Front. Unsere einzige Aufgabe ist es zu warten. Und dabei verödet der Garten und stirbt langsam vor sich hin, erschöpft und kraftlos. Sie und ich dagegen stehen jeden Tag auf, ohne den Mut zu verlieren.
Unsere Liebe geht gestärkt aus diesem Krieg hervor.
Es ist nicht leicht, heute eine Aussage darüber zu treffen, wie sehr wir uns früher geliebt haben. Die Küsse auf unserer Hochzeit waren ganz bestimmt ernst gemeint, doch diese Aufrichtigkeit war verbunden mit unseren Körpern von damals, und gewiss hat die Zeit das eine oder andere an uns verändert. Heute Morgen bin ich wieder einmal unser Grundstück abgeschritten und musste dabei feststellen, wie wenig dieser Ort jetzt noch dem ähnelt, was wir einmal unser Zuhause nannten. Der See ist fast komplett ausgetrocknet. Irgendwer, vermutlich der Feind, hat an den Flussläufen in den Bergen Stauseen errichtet. Das Seeufer, das früher aussah wie ein Dschungel, eine regelrechte grüne Hölle, ist jetzt dabei zu veröden.
Der Krieg an sich verändert nichts. Er erinnert uns nur mit seinem Lärm daran, dass sich alles ständig ändert.
Und trotz des Krieges, oder dank des Krieges, blicken wir nach vorn, an guten Tagen, in guten Nächten, Tag für Tag, einfach so, einen Kuss nach dem anderen, wider alle Vernunft. Das Wasser kocht, die ererbte Teekanne mit dem gehäkelten Überzug, die letzten Reste an Teebeuteln … Alles, was wir noch haben, wird erneut aufgekocht, gehegt, gepflegt und weiter genutzt. Zwischen uns lebt und stirbt etwas. Etwas Namenloses, das wir aus gutem Grund zu leugnen beschlossen haben. Die Leidenschaft muss das Unglück ignorieren, sonst geht sie zugrunde. Wir haben Entscheidungen gefällt. Eine davon lautet, nicht allein zu sein. Lieben heißt, allen bösen Geistern abschwören, die uns weismachen wollen, es ginge auch ohne die Liebe.
Glücklicherweise wächst im Angesicht des Bösen die Nähe.
Ich kann über ihre Hände sprechen, weil ich sie kenne, weil sie mir nahe sind. Über das, was zu weit entfernt ist, lässt sich nichts sagen. Im Keller weint ein Kind. Es ist zwar nicht unser Sohn, aber wir versuchen, so gut es geht, für ihn zu sorgen. Wir mögen es beide, für etwas zu sorgen, darin zumindest sind wir uns ähnlich, auch wenn der Garten leise vor sich hinstirbt. Das Bürschlein kam im vergangenen Sommer zu uns, mehr als sechs Monate ist das jetzt her. Wir wissen nicht, wie alt er ist, aber wir schätzen ihn auf neun. Wir haben zwei Jungs gehabt, und ihr Wachstumsfortschritt ist mit Bleistift auf der Wand im Kinderzimmer markiert. Also haben wir das Alter dieses Fremden anhand der Größe unserer eigenen Kinder berechnet, auch wenn wir wissen, dass dies keine eindeutige Aussage sein kann. Es ist schließlich nicht unser eigener Sohn, den wir hier messen. Aber er hatte keine Familie, also haben wir ihn bei uns aufgenommen.
Als er ankam, war er verletzt, das machte es uns leichter, ihm zu helfen. Wir sind keine besonders guten Menschen, so viel steht fest, aber das heißt noch lange nicht, dass wir kein Mitleid empfänden. Abgesehen davon haben wir jede Menge Platz, seit unsere beiden Jungs weg sind. Im Keller verstecken wir ihn nur, weil wir noch nicht entschieden haben, was wir später mit ihm anfangen wollen. Der Krieg zerstört vieles, aber er schafft auch neue Möglichkeiten. Und Möglichkeiten hatten wir früher keine, deshalb brauchen wir jetzt ein bisschen Zeit, um zu reagieren. Menschen, die guter Dinge sind, haben keine Furcht. Wir dagegen schon, also ich zumindest habe Angst, für sie möchte ich da lieber nicht sprechen. Jedenfalls glauben wir nicht, dass wir irgendwem sein Kind wegnehmen. Besser gefällt uns der Gedanke, dass wir uns seiner angenommen haben.
Allerdings hat der Bursche noch nicht ein Wort gesagt. Sein Schweigen beunruhigt uns, aber es ist auch ein bisschen tröstlich. Wir warten auf sein erstes Wort und fürchten es zugleich.
Denn was, wenn sein erstes Wort gar nicht »danke« ist?
Was machen wir dann mit ihm?
Manchmal weint er nachts, wenn wir Sex haben, aber wir lassen uns davon nicht stören. Schließlich hatten wir auch Sex, während unsere eigenen Kinder weinten. Wir sind nicht verrückt oder so, aber anders gibt es nun mal keinen Nachwuchs. Das ist der natürliche Lauf der Dinge. Das Leben bedroht nicht etwa neues Leben, nein, im Gegenteil, es bringt es hervor. Gestern habe ich unserem Gefangenen ein Schachspiel geschenkt. So nennen wir ihn zwar, wenn wir von ihm sprechen, aber seine Tür ist nicht verschlossen. Wenn er wollte, könnte er jederzeit gehen. So wie er auch aus eigenem Antrieb gekommen ist. Jedenfalls, er bleibt. Ich nehme mal an, der Wille, der ihn zu uns führte, ist derselbe, der ihn auch bei uns bleiben lässt. Im Gegenzug bekommt er gut zu essen, und das trotz unserer beschränkten Möglichkeiten. Bananen mag er nicht, das haben wir inzwischen herausgefunden, er ist schließlich kein Affe. Kartoffeln mit Chorizo dagegen ist sein Leibgericht, das verschlingt er regelrecht, sogar die Finger leckt er sich danach. Es ist immer schön, ein Kind essen zu sehen, selbst wenn es nicht das eigene ist.
Wir haben beide einen ganz guten Eindruck von dem verdammten Burschen, auch wenn wir keine Ahnung haben, woher er kommt. Jedenfalls, wenn alles gut läuft und der Knabe sich entsprechend benimmt, bringen wir ihn am Ende vielleicht doch noch im Kinderzimmer unter. Ihr wäre es am liebsten, wenn das sofort geschähe. Ich dagegen bin zögerlich, schließlich kennen wir sein wahres Verhalten noch nicht. Außerdem haben wir keine Ahnung, ob unsere eigenen Söhne den Krieg überleben werden und nach ihrer Rückkehr zurück in ihre Zimmer wollen. In Wirklichkeit wissen wir so gut wie gar nichts, das ist mein einziger Trost. Denn wenn ich beim Anblick unseres verdorrenden Gartens eines gelernt habe, dann, dass weder das Gute noch das Böse im Leben auf unsere Pläne Rücksicht nimmt oder sich darum schert, ob wir uns bei irgendetwas Mühe geben. Es geschieht einfach. So ist das.
Sie hat den Jungen als Erste gesehen. Sie sah, wie er über den Hügel gelaufen kam und blutend zu uns in den Garten stolperte, ohne ein Wort der Klage. Sie hat ihn ins Haus geholt und seine Wunden versorgt, sie hat ihm die Kleidung unserer Kinder gegeben, die wir sorgfältig aufbewahrt hatten, hat ihn gebadet und ihm Abendessen zubereitet und ihm das Bett gemacht, unten, im Spielzimmer im Keller. Meinen Vorschlag, die Polizei zu rufen, hat sie abgelehnt. Ein Kind war ihr lieber als eine Ermittlung. Sie weiß immer ganz genau, was sie nicht will.
Das alles ist jetzt mehr als sechs Monate her, aber nach wie vor sagt der Junge keinen Ton. Mir gefällt der Gedanke, dass es ihm an nichts fehlt. Er benimmt sich ordentlich, manchmal schmeißt er ein bisschen seine Spielsachen durch die Gegend, aber noch ist nichts Wertvolles zu Bruch gegangen. Er sieht ganz anders aus als unsere eigenen Kinder, sehr schmal und dunkel. Unsere Jungs dagegen waren kräftig und blond, oder vielmehr sind sie es noch, jedenfalls, bis sie für tot erklärt werden. Irgendwie seltsam, aber seine Anwesenheit wird uns immer vertrauter. Wir sehen zusammen fern. Traurige Filme meiden wir, genau wie traurige Lieder, eigentlich alles, was irgendwie traurig ist. Komödien mag er, da lacht er. Er ist ein fröhlicher Junge und ein guter Esser, wir können wirklich nicht klagen. Wenn er auf dem Sofa einschläft, streichelt sie ihm übers Haar, was er sich gerne gefallen lässt. Anschließend bringe ich ihn ins Bett und ziehe ihm einen Schlafanzug an. Einen Gutenachtkuss wie unseren eigenen Kindern gebe ich ihm nicht, das traue ich mich nicht. So nett er auch sein mag, unser eigenes Kind ist er nicht.
Heute Morgen kam der Bezirksvorsteher vorbei und erkundigte sich, wie es bei uns so läuft. Es scheint, als würde der Krieg noch dauern und die Bomben immer näher kommen. Er macht sich Sorgen um uns und unsere Widerstandskraft. Natürlich haben wir gelogen. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht gibt uns das Kind ja wirklich neue Kraft. Die Vorratskammer ist so gut wie leer. Tee haben wir nur noch wenig, Kaffee noch weniger, den Wein trinken wir aus immer kleineren Gläsern, Gemüse haben wir keins, nur Bohnen, Chorizo, Wurst und Kartoffeln für zwei Wochen, dazu noch Tomatensoße für einen Monat. Milch ist nicht das Problem, denn aus unerfindlichen Gründen überstehen die beiden Kühe in unserer Gemeinde die schreckliche Dürre erstaunlich gut. Brot gibt es keins mehr, seit sie den Bäcker festgenommen haben. Es hieß, er habe klammheimlich Berichte geschrieben und dem Feind gezielt Nachrichten über uns alle zukommen lassen, sogar einen geheimen Sender habe man bei ihm gefunden. Schwer zu sagen, ob da etwas dran ist, aber jedenfalls ist es bedauerlich, denn backen konnte der Mann. Seit Krieg ist, haben die Verdächtigungen weitaus mehr Schaden angerichtet als alle Kugeln zusammen.
Der Bezirksvorsteher hat uns darüber informiert, dass nächste Woche die Evakuierung geprobt wird. Wir haben keine Ahnung, was wir dann mit dem Kind anstellen werden, weder während der Übung noch falls aus der Übung am Ende eine echte Evakuierung werden sollte. Vor dem Krieg haben wir nie darüber nachgedacht, dieses Haus einmal zu verlassen. Ich glaube, sie und ich, wir waren stillschweigend übereingekommen, dass wir hier begraben werden würden. Aber jetzt ist alles anders. Unsere Pläne müssen sich ändern.
Am lustigsten ist es, nach dem Baden mit dem Jungen Fangen zu spielen. Er läuft dann immer weg, in ein Handtuch gewickelt. Dabei rutscht er auf dem Holzboden aus, aber das ist ihm egal, er steht einfach auf und läuft weiter. Wir beiden Erwachsenen jagen ihn lachend mit dem Pyjama, sie mit der Schlafanzughose, ich mit der Jacke. Es ist schon lange her, dass wir so glücklich waren. Ich glaube, ihr macht es ebenso viel Spaß, mir bei der verrückten Verfolgungsjagd zuzusehen, wie es mir große Freude bereitet, sie endlich wieder einmal lachen zu sehen. Wenn er den Schlafanzug dann schließlich anhat, machen wir den Fernseher an und holen uns eine Wolldecke. Die Kohle ist nämlich ausgegangen, und es ist kalt, trotz Ofen. Wir kuscheln uns aneinander und sehen uns eine Komödie an, Komödien mögen wir alle. Während er sich amüsiert, ziehen wir ihm die Socken an. Im Fernsehen laufen jetzt nur noch Komödien oder Dramen, traurige Lieder oder Marschmusik. Die Nachrichtensendungen fielen dem Abschalten des Pulsnetzes zum Opfer, damals, als WRIST die Kommunikation beendet hat. Früher konnte man einfach, wann immer man wollte, mit einer Drehung des Handgelenks nachsehen, was in der Welt los war, mehr noch – und wichtiger –, man konnte seine Liebsten in Echtzeit kontaktieren, sogar das Pochen ihrer Herzen konnte man spüren. Aber das bläuliche Licht, das früher einmal am Handgelenk schimmerte, ist schon seit langer Zeit erloschen. Jetzt sollen wir uns im Fernsehen über Komödien amüsieren, die wir schon tausendmal gesehen haben. Aber besser als gar nichts. Und unser Bürschlein hier amüsiert sich prächtig.
Wenn der Junge endlich eingeschlafen ist, sinken sie und ich erschöpft zu Boden und umarmen uns ganz fest, so wie früher. Wir tun schließlich nichts Böses, und der Junge hat von ganz allein zu uns gefunden. Er ist ja nicht entführt worden oder so, und uns gefällt der Gedanke, dass er niemanden hat außer uns.
Andererseits, sie und ich, wir sind sehr unterschiedlich. Sie ist eine feine Dame. Während ich, bevor ich ihr Ehemann wurde, ihr Angestellter war. Ihr Leben ist ganz anders als meins. Aber wenn man unter einem Dach lebt, verliert man deswegen noch lange nicht seinen eigenen Namen.
Sie ist eine feine Dame, so war das schon immer. Und ich war – jeder weiß das, leugnen wäre zwecklos –, bevor ich ein feiner Herr wurde, ihr Diener.
Ich wurde als Tagelöhner geboren und brachte es bis zum Vorarbeiter, und an diesem Punkt nahm sie mich und machte, entgegen meinem Naturell, einen feinen Herren aus mir, einen Vater und Ehemann. Sie ging ganz langsam vor, bedächtig und beharrlich. So wie sie alles macht.
Der Bezirksvorsteher hegt keinerlei Verdacht. Wir haben zwei Söhne, die im Krieg sind und die für uns kämpfen. Er respektiert uns, aber seine ungeheure Verantwortung und seine geringen Befugnisse zwingen ihn dazu, ein paar Fragen mehr zu stellen, als gut wäre. Sie kennt alle Antworten. Wenn sie Nein sagt, dann hört sich das auch an wie ein Nein, ohne jeden Hintergedanken. Sie vermeidet die nächste Frage schon, während sie die erste geschickt beantwortet. Sie besitzt eine Gabe dafür. Während der Bezirksvorsteher zu Besuch war, schlummerte der Knabe. Oder wenigstens tat er so, denn genau das hatte sie ihm beigebracht. Und er war ein gelehriger Schüler. Der Junge weiß ganz genau, wie er sich zu verhalten hat. Woher er auch kommt, er ist keineswegs scharf darauf, zurückgebracht zu werden. Er begnügt sich mit dem wenigen, was wir an Essen und Wärme für ihn aufbringen können. Und das beruhigt uns, denn offen gestanden stellen die eigenen Kinder meist die größeren Ansprüche. Jedenfalls kam es mir immer so vor, wenn ich mir die beiden so ansah und feststellte, wie sehr sie ihrer Mutter glichen. Und vermutlich verbanden sich da der väterliche Stolz und die Verantwortung zu dem Gefühl, dass niemals etwas genug für sie sein könnte. Unsere beiden Jungen, Augusto und Pablo, sind keine zwei Jahre auseinander. Sie sind zusammen groß geworden, haben sich zusammen freiwillig zum Militär gemeldet, und sie sind zusammen in den Krieg gezogen. Für einen Mann, der selber nicht im Krieg war, ist es seltsam, zwei Söhne zu haben, die Soldaten sind. Vom Gefühl her müsste ich es sein, der sie mit seinen Waffen beschützt, nicht umgekehrt. Ich fühle mich nutzlos. Der kleine Gefangene, der eigentlich keiner ist, hilft mir dabei, all das zu vergessen, wie im Übrigen auch fast alles andere. Wenn er lächelt, denke ich an die Zeit, als ich meine eigenen Jungen erzog. Nachts greife ich manchmal zu meiner alten Büchse, meiner Remington, und patrouilliere im Haus auf und ab. Lächerlich, ich weiß, aber irgendwie auch tröstlich. Vielleicht bringe ich dem neuen Jungen irgendwann das Jagen bei. Im Wald treibt sich noch immer mindestens ein vereinzelter Fuchs herum. Sehen kann ich ihn zwar nicht, aber ein Fuchs ist es auf jeden Fall, denn an den Hühnerställen habe ich Kratz- und Bissspuren im Holz gefunden.
Für die Evakuierungsübung haben wir ganz klare Anweisungen erhalten. Was wir mitnehmen dürfen, in welche Reihe wir uns zu stellen haben, welche Ausweispapiere wir mitführen müssen. Wir machen uns Sorgen um den Jungen. Wie sollen wir ihn verstecken, welche Ausweispapiere sollen wir für ihn vorzeigen? Gestern haben wir uns deswegen gestritten. Sie meint, falls eine echte Evakuierung stattfindet, wenn also der Feind sozusagen bereits vor der Tür steht, würden keine großen Fragen mehr gestellt oder Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Ich bin da anderer Meinung. Ich kenne die Leute hier aus der Gegend und weiß um den Neid, mit dem viele uns begegnen, und ich möchte diesen Leuten keinen Vorwand bieten, uns irgendwie zu schaden. Andererseits sind wir uns beide völlig im Klaren darüber, dass wir den Jungen nicht allein hier zurücklassen und dem Feind ausliefern können oder, schlimmer noch, dem Verhungern, falls nämlich der Feind auf sich warten ließe.
Die Übung wurde abgesagt. Anscheinend ist die Zeit zu knapp. Heute Morgen wurde verkündet, dass wir umgesiedelt werden müssen, denn der Krieg wäre verloren. Deshalb sei es in unser aller Interesse, unsere Häuser zu verlassen. So wurde uns gesagt. Man könne uns dann besser schützen.
Es geschieht alles zu unserem Besten.
Hier, mitten unter uns, so wird gemunkelt, gibt es immer mehr Spione, und die Ratten verkriechen sich, oder andersherum, es gibt immer mehr Ratten, und die Spione verkriechen sich, so genau habe ich das nicht verstanden. Jedenfalls, unser Eigentum wird konfisziert, aber die Besitzverhältnisse werden respektiert, und vielleicht, also günstigstenfalls, könnten wir dann irgendwann wieder zurück auf unser Land. Wenn der Krieg beendet und das Misstrauen überwunden wäre.
Angeblich ist der neue Ort, zu dem wir gehen, viel sauberer als dieser hier: ein in sich geschlossener, lichtdurchströmter Raum, in dem sich das Böse weder verstecken noch Schaden anrichten kann. Sie nennen ihn die Durchsichtige Stadt.
Die Leute, die für uns zuständig sind, denken für uns, noch während sie über uns nachdenken. Was der Bezirksvorsteher sagt, ergibt jede Menge Sinn, und er wiederholt nur, was er von der Regierung gesagt bekommt. Und vermutlich weiß die Regierung ganz genau, warum sie etwas sagt und tut.
Wir haben eine Woche, um unsere Abreise vorzubereiten. Sie haben im Rathaus eine Versammlung einberufen und uns erklärt, dass die Durchsichtige Stadt weder Exil noch Gefängnis bedeutet, vielmehr stellt sie einen Zufluchtsort dar. Ob das alle verstanden haben, weiß ich nicht, denn es gab viel Gemurmel und natürlich Fragen, und auch Protest wurde laut. Der Mann von der Fischzucht wollte wissen, für wie lange wir denn an diesem Zufluchtsort bleiben sollten und ob wir dann nicht so etwas wie Flüchtlinge wären, und der Bezirksvorsteher erklärte uns, dass es sich nicht um ein temporäres Lager handelte, sondern um eine rundherum sichere Stadt, in der wir beginnen sollten, an eine neue Zukunft zu denken. Daraufhin fragte eine andere, die, glaube ich, in der Stadtverwaltung arbeitet, ob wir denn dann überhaupt nicht mehr zurückkommen würden, und dann sagte jemand aus einer der hinteren Reihen, dass sie keineswegs vorhätten mitzugehen, und da ist der Beauftragte dann angesichts der ganzen Fragen doch ein bisschen unruhig geworden und hat versucht, die Sache mit dem Hinweis darauf zu beenden, wir würden alle weiteren Informationen bei unserer Ankunft in der Stadt bekommen. Mir reichte das an Information, aber den anderen Anwesenden nicht, und viele riefen ihre Fragen und ihren Protest laut durch den Raum, bis der Bezirksvorsteher schließlich seinen Revolver zog und in die Luft schoss, damit endlich Ruhe herrschte. Als das Schweigen auf diese etwas ungute Art wieder hergestellt war, sagte er zum Abschluss, unsere Fragen würden seine Kompetenzen überschreiten, aber alle unsere zweifellos berechtigten Anliegen würden zu gegebener Zeit von höherer Stelle beantwortet werden.
Wir hielten beide den Mund. Wir haben schließlich selbst genug Probleme.
Wir wissen nicht, wie wir den Jungen, der nicht unserer ist, verstecken sollen. Deshalb versuchen wir, uns etwas auszudenken, was als einigermaßen plausible Begründung für seine Anwesenheit durchgehen könnte. Wird der Bombendonner leiser, beginnt die Gerüchteküche zu brodeln. Täglich wird irgendein weiterer Nachbar verhaftet. Erklärungen dafür gibt es keine. Die Schuldigen wissen selbst am besten, was sie getan haben. Wer unschuldig ist, hat nichts zu befürchten. In die Durchsichtige Stadt kommen nur die, gegen die keine Verdachtsmomente bestehen. Es gibt Denunzianten, die andere Denunzianten denunzieren. Gestern wurde der Postdirektor festgenommen, mit der Begründung, er würde die Briefe öffnen, lesen und dann wieder zukleben, bevor er sie ausliefert. Es heißt, der Feind lauere überall, jeder sei verdächtig. Wir haben zwei Söhne an der Front, deshalb werden wir fürs Erste in Ruhe gelassen, die Tapferkeit unserer Söhne spricht für uns und nötigt unseren Nachbarn einen gewissen Respekt ab. Wir sind Eltern zweier Frontsoldaten, und deshalb besteht seitens des Dorfes auch kein Zweifel an unserer Loyalität. Niemand verrät seine eigenen Kinder. Unser Problem ist der Junge, das wissen wir ganz genau. Wir halten einen Jungen bei uns versteckt, dessen Herkunft ungeklärt ist, dadurch könnten wir Schuld auf uns laden. Es muss etwas geschehen mit dem Knaben. Während wir die Koffer packen, schmieden wir Pläne. Nachts unterhalten wir uns bei gedämpftem Licht im Flüsterton, als würde uns jemand belauschen. Ich glaube, wir haben beide Angst.
Sie ist einverstanden damit, dass wir ihn als unseren Neffen ausgeben, das erscheint uns als die nachvollziehbarste Option. In diesem Krieg sind viele Menschen gestorben, da ist es nicht weiter verwunderlich, wenn wir uns um die Kinder unserer Toten kümmern. Ich selbst habe keine Geschwister, aber sie hat zwei Brüder, die in der Hauptstadt leben. In ihrem Alter hätten sie zwar schlechte Soldaten abgegeben, aber als Bombenopfer konnten sie durchgehen. Um eine Bombe auf den Kopf zu kriegen, muss man kein bestimmtes Alter haben oder irgendeine besondere Begabung. Das kann jedem passieren. Und sie hat schon seit Langem nichts mehr von ihren Brüdern gehört. Sie könnten also wirklich tot sein. Die Telefonleitungen funktionieren schon seit über einem Jahr nicht mehr, Briefe kommen verspätet an (und wenn, dann hat sie anscheinend schon jemand gelesen), im Prinzip ist also eigentlich alles möglich. Klar ist auch, dass wir einen Namen für den Jungen brauchen, auf den er dann auch hört, oder wenigstens sollte er sich umdrehen, wenn er gerufen wird. Wenn man sich bei einem Namen umdreht, bedeutet das, es ist der eigene.
Wir sind uns zwar wegen des Namens uneins, aber wir sind beide der Meinung, dass er möglichst schnell einen bekommen und annehmen sollte. Schließlich braucht der arme Junge auch ein bisschen Zeit zum Üben. Ich bin für Julio, aber sie bevorzugt Edmundo, was ich für viel zu lang und kompliziert halte. Außerdem klingt es irgendwie falsch. Ich glaube, wenn ich ein bisschen quengele, wird es am Ende Julio werden. Die Namen unserer leiblichen Kinder hat sie ausgesucht, da fände ich es nur gerecht, wenn ich wenigstens den Namen für diesen Fremden hier bestimmen dürfte.
Schon diese Woche soll es losgehen, deshalb gehen wir nachts raus und sehen uns unser Haus schon mal von außen an, aus dem abgestorbenen Garten heraus. Damit wir uns an den Anblick gewöhnen. Ein paar Mal haben wir es getrieben, seit wir erfahren haben, dass wir von hier wegmüssen. Und wir haben keine Ahnung, ob es in der Durchsichtigen Stadt überhaupt noch möglich sein wird, es miteinander zu treiben.
Denn eins steht fest: Transparenz beeinträchtigt die Privatsphäre.
Heute Morgen machte ein Gerücht die Runde, und der hiesige Bezirksvorsteher hat es uns später bestätigt: Man darf nur sehr wenig in die Stadt mitnehmen. Keine Möbel zum Beispiel, denn Umzugswagen sind nicht vorgesehen, auch keine Bücher, denn es gibt dort schon welche, zwei Familienfotos pro Paar, jeweils einmal die Eltern, und dazu Fotos von den Kindern, falls welche da sein sollten, und zwar je eins pro Kind. In der Durchsichtigen Stadt muss fast alles wieder bei null anfangen. Keine Putzmittel, denn um die Sauberkeit kümmert sich die Übergangsregierung, auch nichts Schmutziges, damit ihre Arbeit nicht unnötig erschwert wird, ein Sportgerät pro Person, einen Ball, einen Tennisschläger oder ein Schachspiel zum Beispiel, denn Schach ist eine anerkannte Sportart, auch wenn so mancher das vielleicht für einen Witz halten wird. Auf gar keinen Fall Waffen, denn für unsere Sicherheit bürgt die Stadt, Skier auch nicht, denn Schnee gibt es keinen. Badebekleidung geht, denn es gibt dort ein Schwimmbad, ebenso Brillen und Kontaktlinsen, Medikamente dagegen nicht, denn die werden wir dort bekommen, nachdem wir zunächst oberflächlich auf unsere Gesundheit hin untersucht sein werden. Der Bezirksvorsteher sagt, unser Glück könnten wir dort ebenso gut finden wie überall sonst auf der Welt, aber vor allem, meint er, wären wir dort in Sicherheit. Meine Frau hat daran so ihre Zweifel, und ich genauso, fürchte ich, aber was bleibt uns anderes übrig, als der Regierung zu vertrauen, auch wenn es nur eine Übergangsregierung ist. Die Alternative lautet entweder Tod oder Anarchie. Zwei Dinge, die weder sie noch ich wollen. Fast freue ich mich schon ein bisschen auf dieses angeblich so sichere Abenteuer.
Während unsere Vorbereitungen laufen, rufen wir den Jungen gelegentlich bei beiden Namen, Julio und Edmundo, aber bei keinem davon dreht er sich um. Vermutlich hat er einen eigenen Namen, aber den kennen wir nicht, weil er ja nicht mit uns spricht …
Sie ruft Edmundo, und ich rufe Julio, aber der Junge reagiert einfach nicht. Schließlich hat sie genug davon und stimmt mir zu. Ab sofort heißt er Julio.
Die Abreise steht kurz bevor, und sie haben uns mitgeteilt, dass wir unsere Häuser abbrennen müssen, damit sie dem Feind nicht in die Hände fallen. Aber die Grundstücke würden weiter als unsere im Grundbuch stehen bleiben. Und nach dem Krieg, wenn die Regierung es dann für angemessen hält und so beschließt, würde es offiziell Zuschüsse für den Wiederaufbau geben. Jemand fragte, ob das bedeute, dass wir zurückkehren könnten, und der Bezirksvorsteher antwortete, das hieße erst mal gar nichts, und dann fragte ein anderer, ob wir WRIST zurückbekämen und die Pulsempfänger, und der Bezirksvorsteher bestätigte uns, dass das ganze WRIST-System für immer und alle Zeit abgeschaltet sei, denn es habe sich als ein großer Quell der Unruhe erwiesen. Die nächste Frage lautete dann, ob wir Waschmaschinen bekämen oder mit der Hand waschen müssten, und da hatte der gute Mann es fast schon verständlicherweise satt, solche Auskünfte zu erteilen, und meinte bloß noch, so spezifische Informationen würden seine Sachkenntnis und seine Kompetenzen bei Weitem überschreiten.
Die Wahrheit ist, dass der Bezirksvorsteher allem Anschein nach genauso wenig Ahnung hat wie wir, was hier abgeht und was von jetzt an auf uns wartet. Das habe ich, ehrlich gesagt, schon längst bemerkt, deshalb stelle ich auch keine unnötigen Fragen. Für alle Fälle lasse ich die empfindlichen Wäschestücke zu Hause. Wer weiß, nachher waschen sie alles zusammen in einer Maschine.
Um die Häuser abzubrennen, haben sie uns Benzinkanister in die Hand gedrückt. Natürlich lag der Gedanke nahe, den Tank des Wagens damit aufzufüllen und uns unbemerkt aus dem Staub zu machen. Aber gestern ist der Wagen konfisziert worden, da sie auf diesen Gedanken auch schon gekommen sind. In die Durchsichtige Stadt fahren wir in großen, vollklimatisierten Bussen, denn das Schienennetz leidet sehr unter der Sabotage.
Das Haus abzufackeln wird nicht einfach werden, es ist schließlich immer noch unser Haus. Ihr kommen schon beim bloßen Gedanken daran die Tränen, also versuche ich, sie zu trösten. Nicht dass es mir nicht selbst leid darum täte, aber mit der Zeit ist mir das Trösten immer mehr zur Gewohnheit geworden. Außerdem gehört das Haus nun mal ihr, und zuvor gehörte es der Familie ihres ersten Mannes. Es ist also total normal, dass sie ganz besonders darunter leidet.
Wie jede Frau ist auch sie in Wirklichkeit stärker als jeder Mann, nur manchmal verliert sie die Fassung, und dann umarme ich sie. Es geschieht völlig unbewusst, so habe ich es mein ganzes Leben lang gemacht. Mein Vater hat es bei meiner Mutter genauso gemacht.





























