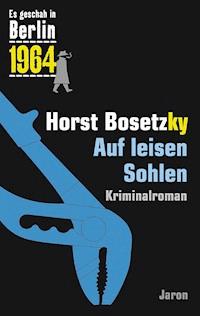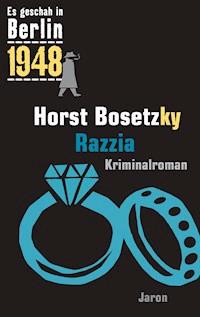Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jaron Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Es geschah in Berlin...
- Sprache: Deutsch
September 1910: In Berlin-Moabit streiken die Kohlenarbeiter. Es kommt zu Unruhen und tätlichen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Nach dem Brand auf einem Kohlenplatz findet man in den rauchenden Überresten die Leiche des Arbeiters Paul Tilkowski. Der jedoch wurde, wie sich schnell herausstellt, zuvor erschossen. Der Fall scheint klar, denn Tilkowski war als Streikbrecher unter den Kohlenarbeitern verhasst. Doch bald tauchen weitere Verdächtige auf. Die verkohlte Leiche ist der erste Mordfall für den jungen Kriminalwachtmeister Hermann Kappe …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Horst Bosetzky
Kappe und die verkohlte Leiche
Kriminalroman
Horst Bosetzky alias -ky lebt in Berlin und gilt als «Denkmal der deutschen Kriminalliteratur». Mit einer mehrteiligen Familiensaga, zeitgeschichtlichen Spannungsromanen und biographischen Romanen (wie «Kempinski erobert Berlin», 2010, und «Der König vom Feuerland» über August Borsig, 2011) avancierte er zu einem der erfolgreichsten Autoren der Gegenwart. Im Jaron Verlag veröffentlichte er daneben mehrere Bände für die Krimi-Serie «Es geschah in Berlin» (zuletzt «Mit Feuereifer», 2011). 2011 erschienen die ersten Bände seiner Mittelalter-Romanserie «Die unglaublichen Abenteuer des fabelhaften Orlando».
Originalausgabe
3. Auflage 2012
© 2007 Jaron Verlag GmbH, Berlin
1. digitale Auflage 2013 Zeilenwert GmbH
Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwertung des Werkes und aller seiner Teile ist nur mit Zustimmung des Verlages erlaubt.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Medien.
www.jaron-verlag.de
Umschlaggestaltung: Bauer + Möhring, Berlin
ISBN 9783955520007
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelseite
Impressum
EINS Freitag, 11. Juni 1910
ZWEI Montag, 19. September 1910
DREI Dienstag, 20. September 1910
VIER Freitag, 23. September 1910
FÜNF Sonnabend, 24. September 1910
SECHS Sonntag, 25. September 1910
SIEBEN Montag, 26. September 1910
ACHT Dienstag, 27. September 1910
NEUN Mittwoch, 28. September 1910
ZEHN Donnerstag, 29. September 1910
ELF Freitag, 30. September 1910
ZWÖLF Sonntag, 2. Oktober 1910
DREIZEHN Montag, 3. Oktober 1910
VIERZEHN Sonntag, 9. Oktober 1910
FÜNFZEHN Montag, 10. Oktober 1910
SECHZEHN Dienstag, 11. Oktober 1910
SIEBZEHN Mittwoch, 9. November 1910
ACHTZEHN Sonntag, 20. November 1910
Es geschah in Berlin …
EINS Freitag, 11. Juni 1910
IRGENDWIE HATTE HERMANN KAPPE heute Abend ein komisches Gefühl - als wenn der Tod auf ihn wartete. Sein Vater, der 1870 / 71 in den Krieg gezogen war, hatte davon erzählt, wie manche Kameraden am Abend vor der Schlacht genau gewusst hatten, dass sie fallen würden.
Hermann Kappe starrte in die Kerze, die auf seinem Schreibtisch stand. Viel fehlte nicht mehr, dann war sie heruntergebrannt. Er stand auf und sah seinem Kaiser, dessen Bild säuberlich geputzt an der Wand der Wache hing, lange ins Gesicht. In den blassblauen Augen Seiner Majestät Wilhelm II. glaubte er ein geringschätziges Lächeln zu erkennen. Das mochte wohl mit seiner Figur zusammenhängen. Mit seinen 175 Zentimetern Körpergröße hätte Hermann Kappe keine Chance gehabt, von Friedrich Wilhelm I. in die Schar der Langen Kerls eingereiht zu werden. Doch was ihm an Länge fehlen mochte, glich er an Breite wieder aus, das heißt, er war sehr kompakt gebaut und hätte auch als Ringer oder Boxer eine Chance gehabt. Bei Menschen seines Typus bestand die Gefahr, im Alter korpulent zu werden, doch das musste ihn im Augenblick nicht kümmern, war er doch im Februar gerade erst 22 Jahre alt geworden. Schnell laufen und gut springen konnte er, hoch wie weit, aber er war nicht eben wendig und ein schlechter Turner. Auf dem Kasernenhof hatte ihm das einigen Spott seines Feldwebels wie seiner Kameraden eingebracht: «Der hängt ja wie ’n nasser Sack an der Reckstange!»
Kappe hatte in Berlin bei den Grenadieren gedient, und sein großer Traum war es, in die Hauptstadt zu gehen und dort sein Glück zu machen. Aber hatte er das nötige Format dazu? Schaute er in den Spiegel, kamen ihm Zweifel. Zu rund und gemütlich sah er aus, hatte noch ein richtiges Kindergesicht. Da half sein martialischer Bart nur wenig. Ein Krieger schaute anders aus. Auch mit seiner Augenfarbe war er unzufrieden: Vergissmeinnicht war nichts für einen richtigen Mann.
Kappe war Schutzmann in jenem Storkow, das in südöstlicher Richtung rund fünfzig Kilometer von Berlins Stadtmitte entfernt an einem langgestreckten See zu finden ist. Manchmal wurde es mit der gleichnamigen Ortschaft in der Nähe Zehdenicks verwechselt. Da in der Gegend um den Storkower und den Scharmützelsee eine Diebesbande ihr Unwesen trieb, hatte Kappe sich entschlossen, nach Einbruch der Dämmerung noch einmal einen kleinen Rundgang durch sein Revier zu unternehmen. Doch als er die Wache verließ, kamen ihm Bedenken. Es schien gewittern zu wollen, und schon als Kind hatte er immer eine fürchterliche Angst davor gehabt, vom Blitz getroffen zu werden. Er gab sich einen Ruck und wandte sich zur Schleuse hin. Besonders Obacht zu geben war darauf, dass in der Nähe der alten holländischen Hebebrücke kein Lagerfeuer entzündet wurde, denn deren Holz brannte wie Zunder. Nein, es war alles in Ordnung. Auch die Kirche lag friedlich im Schein matter Laternen. Er rüttelte an der Tür. Abgeschlossen. Als er den Markplatz überquerte, kam eine Gruppe fröhlicher Zecher aus dem Hotel Berlin. Kappe grüßte militärisch, denn es waren allesamt Honoratioren.
«Guten Abend, Herr Bürgermeister.»
«Kappe, den Herrn da sofort festnehmen!», rief der Apotheker und zeigte auf das Storkower Stadtoberhaupt. «Das ist ein. ..»
«Nicht doch, Jochen.» Der Arzt bemühte sich, dem Apotheker den Mund zuzuhalten.
«Peng! Peng!», machte der Apotheker und zielte mit seinem Zeigefinger, als sei der ein Pistolenlauf, auf den Rektor.
«Seid doch nicht so albern!», schrie der Rektor und schwang einen abgerissenen Zweig wie einen Rohrstock. «Setzen, sonst. ..! Hier wird nicht Tschech gespielt.»
Kappe wandte sich ab. Es war ihm immer peinlich, wenn sich ehrbare Männer wie Kinder benahmen. Wenn die Jungen in Storkow Tschech spielten, ging er immer dazwischen, um das zu unterbinden, aber jetzt. ..? Er empfand das Tschech-Spiel als zutiefst pietätlos. Schön, die Geschichte war inzwischen 66 Jahre her, aber trotzdem. .. Am 26. Juli 1844 hatte der Storkower Bürgermeister Heinrich Ludwig Tschech im Hof des Berliner Schlosses ein Pistolenattentat auf Friedrich Wilhelm IV. verübt. Tschech war in Storkow entlassen worden, nachdem er sich mit der herrschenden Clique angelegt hatte, und war in Rage geraten, weil ihm der preußische Staat nirgendwo eine andere Stelle geben wollte. Zwar war der König nur leicht verletzt worden, aber Kappe fürchtete, dass damit für immer und ewig ein Makel auf Storkow liegen würde und seine Karriere erschwerte.
Kappe machte sich auf zur Burgruine. Wenn Gesindel von Berlin herüberkam oder auf dem Weg in die Hauptstadt war, nächtigte es hier besonders gern. Im Halbdunkel trat er auf etwas, das furchtbar schepperte. Er bückte sich und entdecke ein kleines Emailleschild. Als er es zur nächsten Gaslaterne getragen hatte, konnte er es entziffern: Halt! Habe ich auch nichts vergessen?
Alles war schwarz eingerahmt, und auf Höhe der mittleren Zeilen war rechts und links je ein Loch in das Blech gebohrt worden, um es anschrauben zu können. Am Rand erkennbare Ratscher ließen darauf schließen, dass es jemand in der Eisenbahn abgeschraubt und dann verloren hatte. «Menschen gibt’s», murmelte Kappe und steckte das Schild vorn links in seine Brusttasche. Kam er morgen früh am Bahnhof vorbei, konnte er es dem Stationsvorsteher in die Hand drücken.
Ein Geräusch ließ ihn zusammenzucken. Es klang wie eine kleine Explosion. Er blieb stehen und lauschte. Da war es schon wieder: Plobb, plobb! Komisch. Dem musste er unbedingt nachgehen. Ob da jemand versuchte, einen Verschlag zu öffnen? Nein, Hammerschläge waren es nicht.
Bald sollte Kappe das Rätsel gelöst haben, denn sein Schulfreund Ludwig Latzke kam ihm entgegen, und der hatte einen Fußball dabei, den er beim Laufen in regelmäßigen Abständen vor sich auftippte.
«Unterlassen Sie bitte den ruhestörenden Lärm!», sagte Kappe, und es war nicht ganz klar, wie dienstlich er das meinte.
Latzke schlug den Ball mit dem Spann als Vorlage zu Kappe.
«Los, Kopfball!»
Das ging natürlich nicht - wegen der Pickelhaube. Deshalb fing Kappe den Ball und klemmte ihn unter den Arm. «Hast du jetzt abends noch Fußball gespielt?»
«Nee, ich komme von meinem Cousin in Schauen. Dem hab ich geholfen, sein Haus zu streichen.» Latzke war Maler. «Und als Lohn dafür hat er mir ’n Fußball geschenkt.»
«Schönes Leder.» Kappe warf den Ball zurück. Während seiner Dienstzeit in Berlin hatte er beim FC Germania 88 Fußball gespielt. Dort wurden Ordnung und vaterländische Gesinnung großgeschrieben, für seinen Geschmack etwas zu groß. Jeder Torerfolg wurde mit Hochrufen auf den Kaiser gefeiert, und wer zu spät zum Spiel kam, hatte zehn Pfennig Strafe zu zahlen. Fehlte er ganz, erhöhte sich die Strafe auf 25 Pfennig. Als Ludwig Latzke in Berlin vorübergehend auf dem Bau gearbeitet hatte, war auch er zu Germania gestoßen, und so sangen sie jetzt: «Heil dir, Heil, Germania! Mög es lange noch ertönen: Stoßet zu - hurra, hurra!» In einem Haus ging ein Fenster auf. «Ruhe da unten, sonst hole ich den Schutzmann!»
Kappe machte, dass er weiterkam. Ein Blick war auf alle Fälle noch auf die Badestelle zu werfen, ob da auch nichts Unsittliches getrieben wurde, und ein weiterer auf die Villen Richtung Karlslust und Hubertushöhe, denn wenn es für Einbrecher etwas zu holen gab, dann dort.
Da, wo der Große Storkower See von zwei Landzungen eingeschnürt wurde, hatte sich der Major Ferdinand von Vielitz nach seinem Abschied vom Kaiser-Franz-Garde-Grenadier-Regiment in Berlin am südwestlichen Ufer ein Landhaus errichten lassen. Da er des Öfteren im Ausland weilte, hatte er Kappe gebeten, immer mal wieder ein Auge auf sein Anwesen zu werfen. Zwar verfügte er über eine Köchin und ein Faktotum, aber die waren alt und hörten schwer, und wenn sie sich in ihre Kammern verkrochen hatten, konnte man das ganze Haus ausräumen, ohne dass sie es bemerkten. Kappe ging aber auch gern zu dem Alten, um mit ihm zu plaudern, und Vielitz füllte bei ihm so etwas wie die Rolle eines Großvaters aus, oder nein - mehr die eines geistigen Ziehvaters.
Kappe verließ die schmale Straße, um direkt am Ufer entlangzugehen und sich dem Vielitzschen Grundstück von der Seeseite her zu nähern. Nun gab es in der Mark Brandenburg zwar keine Mittsommernacht wie oben in Schweden, aber stockfinster war es dennoch nicht, und er kannte jeden Meter Weg so gut, dass er nicht ein einziges Mal stolperte.
Schaurig hallten die Rufe eines Käuzchens über den See. Der Tod war dabei, jemanden zu holen. .. Kappe blieb unwillkürlich stehen, um zu lauschen. Hinter ihm knackten die Zweige. Neben ihm raschelte es im Unterholz. Fast schien es ihm so, als würde ihn jemand verfolgen. Aber wer? Und warum? Aus den unergründlichen Wassern des Sees schien jeden Augenblick ein Hakenmann aufzutauchen, um sich auf ihn zu stürzen und ihn in die Tiefe zu ziehen. Kappes Vater war Fischer und glaubte, dass auf dem Grunde der märkischen Seen Nix und Hakenmann zu Hause waren, die dafür sorgten, dass immer wieder Menschen ertranken. «Wir stehlen ihnen die Fische - und das ist ihre Rache.»
Hermann Kappe hielt das für ausgemachten Unsinn, aber ein bisschen bänglich war ihm doch. Gegen seine Natur kam niemand an. Wie immer, wenn er sich selber vorwarf, ein feiger Hund zu sein, versuchte er es mit dem Trick, an Old Shatterhand zu denken. Ein Großcousin aus Köpenick hatte ihm einige zerfledderte Karl-May-Bände mit nach Wendisch Rietz gebracht, und Kappe hatte sie Seite für Seite mit heißem Herzen verschlungen. Ein Junge brauchte nicht viel Phantasie zu haben, um die Gegend um den Storkower und den Scharmützelsee für den Wilden Westen zu halten. Kappe musste unwillkürlich schmunzeln, denn kam er Vielitz mit Old Shatterhand, Winnetou, Old Firehand und Sam Hawkens, dann geriet der in Rage, weil ein Sohn Brandenburg-Preußens seiner Ansicht nach andere Idole haben sollte, zum Beispiel die Generale Seydlitz, Ziethen und Blücher. «Aber du bist ja noch jung, und was nicht ist, kann ja noch werden.» Ohne die Fürsprache des Majors wäre er in seinem Alter nie und nimmer Schutzmann in Storkow geworden.
Hermann Kappe war in Wendisch Rietz am 2. Februar 1888, im Dreikaiserjahr, auf die Welt gekommen. Der Familienname wurde vom örtlichen Pfarrer auf das spätlateinische cappa zurückgeführt, die krempenlose Kopfbedeckung, während sein Vater meinte, die Urahnen hätten an der Oberhavel gesessen, wo knapp östlich von Zehdenick das Dörfchen Kappe lag.
Während Kappe dies alles durch den Kopf ging, hatte er sich der Vielitzschen Villa auf etwa hundert Schritt genähert. Im «Salon Seeblick», wie der Major das größte seiner vielen Zimmer getauft hatte, brannte helles Licht. Also war dieser zu Hause und hatte Besuch. Aber die Büsche waren so dicht, dass sie es Kappe zunächst verwehrten, über die Terrasse hinweg einen Blick in den Salon zu werfen. Er musste weiter vordringen und sie zur Seite schieben. Denn er war ein viel zu neugieriger Mensch, als dass er der Versuchung nicht erlegen wäre, sich näher heranzuschleichen. Ein bisschen kam er sich vor wie ein Voyeur, aber dass Vielitz Damenbesuch hatte, war kaum anzunehmen. Oder doch? Es hieß, er solle es früher toll getrieben haben. Nein, was Kappe da hörte, waren ausschließlich Männerstimmen. Zwei. Der Brummbass des alten Haudegens war unverwechselbar, die andere Stimme war Kappe fremd.
Endlich war er weit genug heran. Vorsichtig teilte er die Büsche mit den Händen. Als er sich freie Sicht auf Terrasse und Salon verschafft hatte, traf ihn fast der Schlag: Von Vielitz stand mit erhobenen Händen vor seinem Kamin, in Schach gehalten von einem Einbrecher in schwarzem Anzug. Dessen Pistole war drohend auf die Brust des Majors gerichtet.
«Her mit den Schlüsseln zu Ihrem Tresor! Wird’s bald!», rief der Eindringling.
«Ich habe keinen Tresor», antwortete von Vielitz.
«Möchten Sie, dass ich Sie über den Haufen schieße?!»
«Möchten Sie gehenkt werden?», fragte der Major zurück.
So schien es schon eine Weile zu gehen, und Kappe fragte sich, ob der Eindringling nicht doch irgendwann die Contenance verlor und abdrückte. Wie es schien, war er kein mit allen Wasser gewaschener Zuchthäusler, sondern in seinem Gewerbe nur ein kleines Licht - und damit schwer zu kalkulieren. Wenn ihn der Major mit seiner Kaltblütigkeit weiter reizte. ..
Kappe musste eingreifen, bevor es zu spät war. Gebückt huschte er über die Terrasse. Das gelang ihm absolut lautlos und ließ ihn darauf hoffen, unbemerkt in den Rücken des Mannes zu gelangen. Ihm mit der linken Hand die Waffe entreißen und ihn gleichzeitig mit der Rechten würgen und zu Boden reißen, das musste alles in einer Bewegung geschehen. Nur so ließ sich der Major noch retten.
Eine der Flügeltüren stand eine Handbreit offen, und Kappe musste sie nur ein paar Zentimeter weiter nach innen drücken, um in den Salon schlüpfen zu können. Ein Kinderspiel, zumal er aus der Dunkelheit kam. Doch die Tür knarrte, und der Eindringling fuhr herum. Als er Kappe erblickt hatte, zögerte er keinen Augenblick, auf ihn zu feuern. Auf die Brust, ins Herz. Und schon mit dem ersten Schuss hatte er getroffen. Kappe schrie auf und stürzte zu Boden.
ZWEI Montag, 19. September 1910
DIE SONNE war noch nicht richtig aufgegangen, als sich Gustav Dlugy auf sein Fahrrad setzte, um zur Arbeit auf dem Kohlenplatz zu fahren. Er wohnte als Untermieter bei seinem Bruder in der Linienstraße und musste hinüber nach Moabit, in die Sickingenstraße.
Im Jahre 1910 war Berlin vieles zugleich: Industriemetropole, Hauptstadt des Kaiserreichs und größte Mietskasernenstadt der Welt. In den Arbeitervierteln waren überfüllte und viel zu kleine Wohnungen die Regel. Großfamilien mit neun und mehr Kindern lebten in Wohnküchen. War etwas mehr Platz, suchte man sich Untermieter. Schlafburschen, die im Schichtdienst arbeiteten, teilten sich ein Bett. Viele hatten nicht genug zum Beißen.
Als Dlugy die Invalidenstraße erreicht hatte und den Lehrter Bahnhof erblickte, kam ihm zum ersten Mal die Galle hoch. Er und seinesgleichen konnten sich kaum den Sonntagsausflug nach Werder leisten, und andere, die am Bahnhof ihre Koffer ausladen ließen, fuhren an die See. Ausbeuter! Und gegenüber in der Ulanen-Kaserne saßen diejenigen, denen die Herrschenden ihre Macht verdankten. Aber die Revolution war nahe, das fühlte er. Der Sturmwind würde sie alle hinwegfegen: den Kaiser, die Generale, die Kapitalisten. Er musste nur sehen, dass er sich dabei rechtzeitig hervortat. Er war nicht auf die Welt gekommen, um ein Leben lang Kohlenarbeiter zu bleiben.
Gustav Dlugy wäre ein wunderbarer Herkules gewesen, wenn man in Berlin schon Filme gedreht hätte. So aber wurde ihm nur angeraten, ein zweiter Athlet Apollon zu werden. Der hatte im Reichshallentheater die Leute allabendlich mit seiner Nummer
«Wegtragen eines Klaviers samt dem Pianisten» zu Begeisterungsstürmen hingerissen. Seine Muskelpakete hatte sich Dlugy aber nicht durch Hantel- und Expandertraining erworben, sondern durch das Schippen von Kohlen. Jahrelang war er zur See gefahren und hatte sich sein Geld als Heizer verdient. Oben an Deck waren die Reichen flaniert, hatten in den Salons diniert und sich im Tanze gewiegt, unten im Bauch des Schiffes hatte er in höllischer Hitze für einen Hungerlohn geschuftet. Kein Wunder, dass er sich, wieder in Deutschland, denen angeschlossen hatte, die die Welt verändern wollten.
Geboren war Gustav Dlugy als vorletztes von acht Kindern im tiefsten Wedding, in der Ackerstraße. Sein Vater hatte bei der Reichsbahn als Gleisbauarbeiter angefangen und sich zum Rangierer hochgearbeitet. Oft war der kleine Gustav zum Stettiner Bahnhof gelaufen, um ihm zuzusehen, wie er zwischen die Puffer sprang, immer in Gefahr, zerquetscht zu werden. «Dann is sein Brustkorb nich mehr dicka als ’n Kartoffelpuffa», fürchtete die Mutter. «Du wirst ma uff keen Fall ooch Ranjiera.» Das würde er doch, hatte er entgegnet, denn er würde einmal so stark werden, dass er die beiden aufeinander zurollenden Waggons mit bloßen Händen aufhalten konnte. Und so hatte er Tag für Tag kräftig geübt. Dann aber hatten sie bei der Bahn keine Rangierer brauchen können, sondern Heizer für ihre Loks. So war Gustav Dlugy angelernt worden und hatte seinen Dienst auf den Schnellzugmaschinen versehen, die zwischen Berlin und der Ostsee unterwegs waren, der «Badewanne der Berliner».
Die Schiffe im Stettiner Hafen hatten ihn nicht sonderlich interessiert, aber eines Tages war es zu einem heftigen Streit zwischen ihm und seinem Lokführer, dem Meister, gekommen, und als der ihn beleidigt hatte, war Dlugy die Hand ausgerutscht. Obwohl er nicht einmal richtig zugeschlagen hatte, war bei dem anderen ein Kieferbruch diagnostiziert worden. Daraufhin war Dlugy wegen gefährlicher Körperverletzung und eines tätlichen Angriffs auf einen Vorgesetzten für einige Monate ins Gefängnis gewandert, und nach seiner Zeit in Moabit hatte ihn die Reichsbahn nicht mehr haben wollen. Eigentlich wurde er in ganz Deutschland geächtet. Da entsann er sich wieder der Schiffe im Stettiner Hafen und konnte auch anheuern. Aber länger als vier Jahre hatte er die Sklaverei nicht ertragen können, und so war er wieder nach Berlin zurückgekommen, um hier als Kohlenarbeiter seine Brötchen zu verdienen.
Als Dlugy in der Sickingenstraße angekommen war, hörte er seine Kollegen lautstark diskutierten. Er stellte sein Rad an die Mauer, lauschte kurz und begriff sofort, dass das seine große Chance war, sich zu profilieren und in seiner Gewerkschaft größeres Gewicht zu bekommen. Jetzt oder nie! Er sprang auf einen Handkarren und ergriff das Wort. «Lasst uns kämpfen, Kollegen!», schrie er. «Auch wenn es nur um Pfennige geht. Aber es sind die Pfennige, die uns bitter zum Leben fehlen - für Brot und Margarine, für Milch und für unsere Kinder. Schluss mit den Hungerlöhnen!»
«Schluss mit den Hungerlöhnen!», kam das Echo aus den Kehlen seiner 140 Kollegen, Kohlenträger und Kutscher, die sich um sechs Uhr morgens auf dem ausgedehnten Lagerplatz versammelt hatten.
Dlugy machte eine kleine Pause und sah zum Bahnhof Beusselstraße hinüber, wo gerade ein Ringbahnzug abgefertigt wurde. Aus dem Schornstein der Lokomotive schossen mit Urgewalt Rauchwolken in den diesigen Himmel. Auf die zeigte er mit großer Geste. «Da seht ihr es: Die Kohle ist es, die in dieser Welt alles in Gang hält, unsere Kohle. Ohne sie bleiben alle Züge stehen, gibt es keine Elektrizität und kein Gas, können wir uns kein Essen kochen, erfrieren wir alle. Und wie dankt man uns das? Mit Hungerlöhnen!»
«Pfui!», schrien alle. «Wir wollen mehr Geld!»
Dlugy informierte sie darüber, dass die Lohnkommission der beteiligten Gewerkschaften von der Firmenleitung aus dem Kontor gewiesen worden war. «Rausgeworfen hat man uns, als wir gefordert haben, den Stundenlohn von 43 auf 50 Pfennig heraufzusetzen. Das ist eine Schande, denn wir arbeiten mehr als alle anderen - zwölf Stunden am Tag.»
«Vierzehn!», riefen die Kutscher.
«Vierzehn», wiederholte Dlugy. «Zwölf bis vierzehn. Und darum sage ich in Richtung dieser Firmenleitung: Wer nicht hören will, muss fühlen! Muss fühlen, dass er kein Geld mehr in die Kassen bekommt, wenn wir die Arbeit niederlegen.»
«Streik! Wir streiken!»
So wurde es einstimmig beschlossen. Dlugy war zufrieden mit seinem Auftritt und machte sich daran, die Streikposten zu organisieren. Als das erledigt war, setzte er sich auf sein Rad und fuhr zu seiner Stammkneipe in der Rostocker Straße, die bei der Polizei als Anarchistentreff verschrien war.
«Wenn det mal nich der Funke is, der det Pulverfass in de Luft jehn lässt», sagte der Wirt, als ihm Dlugy von der Ausrufung des Streiks der Kohlenarbeiter berichtet hatte. «In janz Moabit brodelt et mächtig. Und pass uff, wat ick dir sage: Et wird ooch Tote jeben.»
«Da kannste jetrost eenen druff lassen», fügte sein Zapfer hinzu.
DREI Dienstag, 20. September 1910
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!