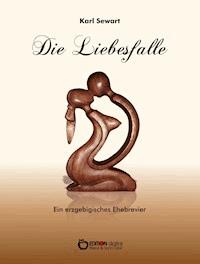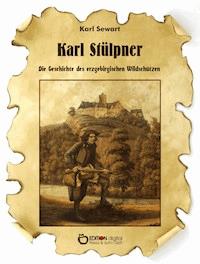
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kaum eine andere historische Gestalt ist im Bewusstsein der Menschen des Erzgebirges so lebendig geblieben wie der Wildschütz Karl Stülpner. Seine Lebensspuren führen durch halb Europa, aber mit vielen abenteuerlichen Taten in seiner Heimatlandschaft hat er die Zuneigung seiner Zeitgenossen und nachwachsender Generationen gewonnen. Karl Sewart erzählt in seinem Buch die Biografie, und er weitet zugleich Tatsachen und Legenden dieses Lebens. Ein Volksbuch für alle Freunde erzgebirgischer Geschichte. Das spannende, sehr gut recherchierte Buch hat seit seinem ersten Erscheinen 1994 viele interessierte Leser in ganz Deutschland gefunden und dem Autor bisher zahlreiche Lesungen und interessante Bekanntschaften und Gespräche eingebracht hat. Der Stülpner-Karl ist schon ein Phänomen. Dieser Analphabet zwingt nach wie vor alle möglichen hochgelehrten Leute dazu, sich mit ihm zu befassen. Wissenschaftler wie die Historikerin Britta Günther M.A., wie Kunst-Prof. Dr. Roland Unger oder PD Dr. Jähne haben die Stülpner-Forschung und damit auch das Gesamt-Geschichtsbild inzwischen um weitere interessante Erkenntnisse bereichert. So wissen wir z. B. nun endlich, wer der Stülpner-Biograf Schönberg eigentlich war und wie zu Stülpners Zeiten eine Staroperation verlief. Weiterhin erfreut sich auch Karl Sewarts Stülpner-Buch der Gunst des Lesers, bringt es ihm doch sowohl die historische Biografie als auch die legendäre Gestalt des erzgebirgischen Wildschützen nahe und regt es ihn dazu an, den Spuren Stülpners in dessen Heimat nachzugehen. Viele Touristen besuchen heute die Erlebnisburg Scharfenstein, nicht zuletzt darum, weil sie von Stülpner einst belagert wurde, weil er geboren wurde und aufgewachsen ist und heute seiner hier mit einer repräsentativen Ausstellung gedacht wird. INHALT: Es wollt ein Jägerlein jagen Hört, ihr Herren, und lasst euch sagen Wo auf steiler Bergesspitze Schuhkel aus, Schuhkel ei ... Der Tod fiel zu unseren Fenstern herein Förster, eile zu dem Wald Es wollt ein Jägerlein jagen Setzt zusammen die Gewehre Der König von Sachsen hat es selber gesagt ... Kaum hab ich das Wildbret geschossen Und als nun die Schlacht vorüber war Viel lieber wollt ich kein Jäger mehr sein Hört, ihr Herren, und lasst euch sagen ... ich will und werde sie nicht nennen ... Hier liegt der lust’ge Hans Im Wald, da sind die Räuber Lieber möcht’ ich kein Jäger mehr sein Für dich, da setz ich Gut und Ehr »Es war ein Jahr der Angst« Dass Carl Stülpner noch lebt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Impressum
Karl Sewart
Karl Stülpner
Die Geschichte des erzgebirgischen Wildschützen
ISBN 978-3-86394-445-2 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1994 unter dem Titel „Mich schießt keiner tot“ im Chemnitzer Verlag. Dem E-Book liegt die 3. erweiterte Auflage von 2004 zugrunde.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2013 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Kalenderblatt für den Monat September aus meinem EWIGEN ERZGEBIRGSKALENDER, einem Who Is Who des Erzgebirges
Im September wurde er geboren. An einem Tag im September ist er gestorben. Von alters her ist der September der Monat der Jagd. Der, von dem hier die Rede ist, war ein Jäger. Und er war ein ewig Gehetzter.
Seine Geburts- und seine Sterbestätte liegen kaum einen Steinwurf voneinander entfernt. Welch ein bewegtes Leben aber hat sich dazwischen zugetragen.
Armut, Enge, erlittene Demütigungen und Zurücksetzungen, innere Unrast, Abenteuerlust, Freiheitsdrang, Konflikte mit einer unbarmherzigen Obrigkeit, die turbulenten Zeitumstände haben ihn durch halb Europa getrieben.
Doch immer wieder hat es ihn aus noch so lockender Fremde unwiderstehlich in die Heimat, zu seiner Familie, zu seinen Freunden zurückgezogen.
In einer Zeit, da Goethe und Schiller ihre unsterblichen Dichtungen verfassten, unterschrieb er noch mit den sprichwörtlichen drei Kreuzen. Seine Memoiren hat er einem Schulmeister in die Feder diktiert.
Wegen Wilddieberei und mehrfacher Flucht aus Militärdiensten steckbrieflich gesucht, entkam er der Übermacht seiner Häscher nicht durch Anwendung seiner hervorragenden Schießkünste, sondern mit List und Witz und durch die tatkräftige Hilfe und Unterstützung der einfachen Menschen, aus deren Mitte er stammte und auf deren Seite er Zeit seines Lebens stand.
Er war ein Wildschütz von Standesehre und Standeswürde. Selbst seine geschworenen Feinde, die Forstbeamten, achteten ihn wegen seines weidgerechten Jagens und seiner menschlichen Fairness. Im Unterschied zu nahezu allen anderen großen Wildschützen Europas hat dieser Erzgebirger seine Jagdbüchse niemals auf einen Menschen angelegt. Vor dem ihm scheinbar geradezu vorgezeichneten Schicksal, zum Räuber und Mörder zu werden, bewahrten ihn seine Erziehung, sein Glaube, sein Gemüt – seine Menschlichkeit.
Aus Liebe zu Weib und Kind gab er, auf der Höhe seines Wildschützenruhmes und seiner Wildschützenmacht stehend, sein freies, unabhängiges Leben auf. Als ihm jedoch sein Vaterland ein menschenwürdiges Dasein verweigerte, hat er es, zusammen mit seiner Familie, verlassen.
Obwohl seit seinem Tod mehr als anderthalb Jahrhunderte und seit seiner Geburt ein gutes Vierteljahrtausend vergangen sind, ist er, weit über die Grenzen seiner engeren Heimat hinaus, unvergessen. Seine Landsleute reden noch heute von ihm, als ob er erst gestern gestorben wäre. In zahllosen Schrift- und Bildwerken haben sie ihm ein Denkmal gesetzt.
Keine andere reale Persönlichkeit und keine andere legendäre Gestalt der sächsisch-erzgebirgischen Geschichte verkörpert auf so originelle, so überzeugende Weise wie er das treuherzige Gemüt, die tiefe Heimatliebe, den geraden Gerechtigkeitssinn, den entwaffnenden Humor, die stetige Hilfsbereitschaft und die unverwüstliche Freiheitssehnsucht des einfachen Volkes.
Alljährlich treffen sich, an seinem Geburts- oder Todestag, Heimatfreunde aus nah und fern auf dem Friedhof zu Großolbersdorf im Erzgebirge, um seiner ehrend zu gedenken.
Hier befindet sich sein schlichtes, immer liebevoll gepflegtes Grab. Dessen Inschrift lautet:
Dem Sohn unserer Wälder Karl Stülpner geb. am 30. 9. 1762 - gest. am 24. 9. 1841 zum Gedächtnis!
Teil 1
Es wollt ein Jägerlein jagen
»Es wollt ein Jägerlein jagen drei viertel Stund vor Tage wohl in dem grünen Wald, ja Wald, wohl in dem grünen Wald. Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, im grünen Wald ...«
Hört, ihr Herren, und lasst euch sagen
Der Nachtwächter hat die zwölfte Stunde ausgerufen. In den Hütten des kleinen Fleckens, die sich ängstlich an den Burgberg ducken, ist das letzte Licht längst ausgegangen. Die Leute ruhen von ihrem schweren Tagwerk aus. Es ist still geworden. Nur das Mühlenwehr rauscht dumpf vom Fluss herauf, das Radwerk klappert leise.
In immer dichteren Schwaden steigt der Nebel auf. Fast drohend ragt die Silhouette der Burg in den düsteren Herbsthimmel. Nur ab und zu dringt ein Mondstrahl durch die schwere Wolkendecke. Einmal ist es, als ob oben auf der Burgmauer die Gestalt einer weiß verschleierten Frau erscheine ...
Da schimmert, blitzt es metallen auf. Gedämpfte Schritte sind zu hören. Der verstohlene Strahl einer Blendlaterne. Zaumzeug klirrt leise, Hufe scharren. Mit gedämpfter Stimme werden kurze Befehle erteilt. Ein Gewehrlauf schimmert im Mondlicht auf. Im Schutz der Dunkelheit sind Männer in den Ort eingedrungen. Zwei, drei Dutzend mögen es sein. Einige sind beritten, die meisten bewaffnet. Kriegsmäßig besetzen sie die Ausgänge des Dorfes. Die Mehrzahl zieht sich an der überdachten Holzbrücke am unteren Ende zusammen. Das Haus an der Brücke wird dicht umstellt.
»Im Namen des Gesetzes! Öffnet die Tür!«
Laut, schrill schallen die Worte gegen das Haus, hallen vom Burgberg wider.
Den Worten folgen Schläge mit Fäusten und Gewehrkolben gegen Tür und Fensterläden. Man ist dabei, die Tür aufzubrechen. Endlich öffnet die Tür sich von innen. Ein älterer Mann, abgearbeitet, aus dem Schlaf gerissen, fragt, was denn sei. Er wird von den Laternen geblendet. Unsanft wird er beiseite gestoßen. Soldaten dringen ins Haus ein, stürmen durch den Flur, die Treppe hinauf, reißen Türen auf, durchsuchen die Zimmer. Vom Keller bis zum Spitzboden durchstöbern sie alle Räume, Ecken und Winkel.
»Schießt in die Feueresse!«, befiehlt ein zivil gekleideter untersetzter Mann. Schüsse krachen, die Mauern erbeben, der Putz rieselt herab, Ruß dringt in den Raum. Indessen schnappen Soldaten sich Würste und Schinken aus dem Rauchfang, greifen frische Männerwäsche aus der Truhe, lassen alles unter ihren Uniformröcken verschwinden.
Eine Frau schreit. »Krieg!«, schreit sie. »Es ist Krieg!«
Der ältere Mann, der die Tür öffnete, sagt: »Es ist schlimmer als Krieg, Frau. Es sind die eigenen Leute, die sich wie die schlimmsten Feinde aufführen ...«
Den Musketieren in der weißen Montur mit gelben Armaufschlägen und roter Halsbinde sind weitere Zivilisten gefolgt. Sie geben sich als Gerichtsbeamte zu erkennen. Auch zwei Forstbeamte treten bewaffnet herein.
Der Gerichtshalter fährt den Hauswirt an: »Wo steckt er, Sein Hausgenosse! Wo steckt schockschwerenot dieser Stülpner!«
Der alte Mann zuckt mit den Schultern. Er wisse nicht, wo dieser sich aufhalte. Er sei Maurer von Beruf und arbeite den ganzen Tag. Er sei spät nach Hause gekommen am vergangenen Abend und habe Stülpner nicht zu sehen bekommen, sei gleich zu Bett gegangen.
»Lüge Er nicht!«, ruft der Büttel, tritt hinter dem Gerichtshalter hervor und bedroht den Hauswirt mit dem spanischen Rohr. »Er steckt doch mit dem Delinquenten unter einer Decke, beherbergt ihn unerlaubterweise. Er wird verhaftet, wenn Er uns nicht verrät, wo dieser Schurke sich aufhält! Er leistet einem gesuchten Verbrecher Vorschub! Er ist sein Komplize!«
Obwohl die Gerichten drohen und mit dem Rohr fuchteln, der Hauswirt weiß nichts oder sagt nichts. Plötzlich wird der alte Mann blass und bricht zusammen. Die Frau schreit und jammert, die Tochter hilft ihr, den Mann ins Bett zu bringen. Vergeblich bemühen sie sich, ihn ins volle Bewusstsein zurückzubringen, er kann sich kaum bewegen, nur noch lallen, er hat einen Schlaganfall erlitten.
»Wo ist die Alte! die Mutter des Lumpen!«, ruft der Büttel. Ein Soldat sagt, da drinnen liege noch eine alte Frau im Bett. Er stürmt in die untere Stube, in die Kammer. Er schreit die schlafende Greisin an, rüttelt sie, zerrt sie an den Haaren aus dem Bett in die Stube. Ob sie die Mutter des Delinquenten Stülpner sei, will er wissen. Die Alte, schlaftrunken, völlig verwirrt, ist unfähig zu antworten. Inzwischen sind Gerichtshelfer aus dem Ort herbeigerufen worden. Einer von ihnen bestätigt, dass die Alte die Mutter des Gesuchten sei. Fragen dringen wie Schläge auf die Greisin ein. Von einem schweren und mühseligen Leben gezeichnet, hat sie jedoch erstaunliche Courage bewahrt. Sie überwindet die anfängliche Verwirrung und das Erschrecken über den Überfall, die brutale Behandlung durch den Büttel. Man droht ihr, sie zu verhaften und geschlossen ins Justizamt zu verbringen, wenn sie nicht gestehe, wo ihr Sohn sich aufhalte. Man wirft ihr vor, sie habe ihren Sohn in ihrer Wohnung tage- und wochenlang beherbergt, obwohl er einem verbotenen Gewerbe nachgehe und gerichtlich gesucht werde.
Die alte Frau fasst sich langsam. Ihr gekrümmter Rücken richtet sich auf. Weder von den Fragen und Vorwürfen des Gerichtshalters Günther noch von den Püffen und Schlägen des Büttels Wohlleben lässt sie sich einschüchtern. Sie sei selber nicht mit dem heimlichen Gewerbe ihres Jungen einverstanden gewesen, sagt sie. Sie habe ihm immer wieder ins Gewissen geredet. Aber was habe er denn für eine andere Wahl gehabt? Unter den Umständen, unter denen er aufgewachsen sei? - Aber das sei nun vorbei, habe sie gedacht. Ihr Sohn habe sein Gewerbe aufgegeben! Und der Herr von Einsiedel selber habe ihm versprochen, sich für seine Begnadigung höchstselbst zu verwenden, wenn er sich nur inzwischen hier, in der Wohnung bei ihr, seiner Mutter, aufhalten werde und sich nichts mehr zuschulden kommen lasse. Und das habe ihr Junge seit Wochen getan. Er habe seine Jagdwaffen nicht mehr angerührt. Am gestrigen Tag noch habe er sich in der Wohnung hier aufgehalten, noch am Abend, als sie zu Bett gegangen sei, habe er sich auf der Ofenbank niedergelegt. Sie sei selber verwundert, dass er nicht hier sei. Ihr Sohn sei kein schlechter Mensch. So grausam er auch verfolgt worden sei, an seinen Händen klebe kein Menschenblut. Gerade darum wolle der Herr sich ja für ihn verwenden. Sie könne sich nur wundern, dass man ihn nun wie einen Verbrecher verfolge und das Haus nächtens überfalle ...
Die Haltung, die Worte der Alten bleiben nicht ohne Wirkung auf die Beamten. Die Stube ist mittlerweile brechend voll von Menschen. Die hier aufgefundenen Jagdsachen seien zu beschlagnahmen, weist der Gerichtshalter die Helfer an. Die Frau sucht er zu beruhigen. Es werde sich alles aufklären.
Indessen treten der Ortsrichter und ein weiterer Einwohner, die herbeigerufen worden sind, herein. Der Richter teilt dem Gerichtshalter mit, der Delinquent könne sich nicht hier im Hause versteckt haben. Er sei diesem soeben auf dem Weg hierher begegnet. Stülpner habe ihn angesprochen und ihn gefragt, was die Kerls vor seiner Wohnung wollten. Er, der Richter, habe gesagt, er wisse es nicht. Er sei mit anderen Einwohnern seitens der Gerichte aufgefordert worden, sich zu Stülpners Wohnung zu begeben. Da habe Stülpner erwidert, er werde schon herausfinden, worum es gehe, und Gnade Gott, es handle sich um eine unrechte Sache gegen ihn. Er werde seine Doppelbüchse aus dem Versteck holen. Das habe Stülpner in drohendem Tone gesagt. Darauf sei er in der Dunkelheit verschwunden, als ob ihn der Erdboden verschluckt habe.
Gewiss, sagt einer von den Lokalgerichten eilfertig und in wichtigtuerisch-hämischem Ton, gewiss sei der Delinquent am Abend heimlich aus dem Haus geschlichen, um ein Mensch hier im Ort zu karessieren. Gewisse Gerüchte im Dorf deuteten seit einiger Zeit auf solche Aktivitäten des Gesuchten hin.
Das sähe dem Stülpner schon ähnlich, sagt ein anderer herbeigezogener Einwohner. »Der versteht sich nicht nur darauf, Rehe und Hirsche zu schießen. Der kann auch auf Schürzen Jagd machen.«
Einige der Männer lachen. Der Gerichtshalter muss einsehen, dass die wohlvorbereitete Überraschungsaktion fehlgeschlagen ist. Wieder einmal ist dieser Fuchs ihm entwischt. Die Enttäuschung des Verwesers ist groß. Wohl oder übel bläst er zum Rückzug. Dabei muss er gute Miene zum bösen Spiel machen. Er spürt die Schadenfreude eines manchen Helfers und Einwohners.
Günther verwarnt die Mutter des Delinquenten streng, verlangt von ihr, sogleich das Gericht zu benachrichtigen, wenn ihr Sohn sich bei ihr blicken lasse. Auf ihren Einwand, der Burgherr habe ihrem Jungen freien Aufenthalt in ihrer Wohnung zugesichert, geht er nicht ein.
Vor dem Haus gibt er dem Leutnant der Musketiere Anweisung, Posten aufzustellen, das Haus unter strenge und heimliche Beobachtung und Bewachung zu stellen.
Die beschlagnahmten Jagdwaffen und -geräte lässt er von den Gerichtshelfern mitführen. Die Untersuchung der Utensilien ergibt, dass sie lange nicht benutzt worden sind. Es geht um eine Flinte, um eine Jagdtasche mit Munition und Zubehör, um einen scharf geschliffenen Hirschfänger und um einen grünen Tuchrock in gutem Zustand.
Ein Knecht des Burgpächters kommt und lädt die Gerichtsbeamten, die Förster und den Leutnant zu einem Frühstück auf die Burg. Auch die Pferde brauchen Futter. Die Mannschaften werden in der Schenke und in den umliegenden Häusern einquartiert. Am Morgen soll Abmarsch sein. Es hat keinen Sinn, die Expedition fortzusetzen. Der Gesuchte ist gewiss längst über alle Berge. Denken die Häscher. Vielleicht ist er nun für immer über die böhmische Grenze verschwunden. Hoffentlich wird er irgendwo von einem Werbekommando geschnappt und in einen Soldatenrock gesteckt, damit er niemals wieder in seiner Jägerkluft die erzgebirgischen Forsten unsicher machen und die Behörden zum Narren halten kann ...
»Was ist das bloß für ein Kerl, dieser Stülpner«, sagt einer der Musketiere des Fangkommandos zu einem anderen. »Die Gerichte, die Förster stellen ihm an allen Ecken und Enden nach, und nun wird auch noch Militär gegen ihn aufgeboten, das Haus besetzt, der ganze Ort abgeriegelt. Ein halbes Dutzend von Spitzeln schwört, er halte sich in der Wohnung seiner Mutter auf, aber als man eindringt, da hat der Kerl sich in Luft aufgelöst. Der muss es doch mit dem Leibhaftigen haben!«
Wo auf steiler Bergesspitze
»Das Schloss Scharfenstein an der Zschopau, deren Ufer herrlich gestaltete Felsen bilden, hat, nächst Augustusburg, die schönste Lage unter allen Schlössern unsers Erzgebirges. Es steht auf einem 60 Ellen hohen, aus dem ungleich höhern Gebirge in westlicher Richtung hervorspringenden ziemlich steilen, doch wenig felsigen Berge, um welchen die Zschopau in einem Halbkreise fließen würde, wäre nicht auch diese Form durch noch einen felsigen Hügel gestaltet, der wieder aus dem Schlossberge in Südwesten hervorspringt, wodurch nun der Fluss zu wahrhaft interessanten Krümmungen gezwungen wird, welcher von der Anhöhe herab, mit seinem krystallenen Wasser einen herrlichen Anblick gewährt.
Das Schloss zerfällt eigentlich in die noch wenigen Ruinen der alten Burg, und in den neuen Anbau; doch umschließt beides nur einen Hof, zu welchem über den langen Schlossgraben hinweg eine steinerne Brücke, und ein altes mit Wappen geziertes Thor rühren. Von den Ruinen, wovon man auch Theile beim neuen Schlossbau benutzt hat (z. B. einen sehr weiten Thurm in Südwest) zeichnet sich besonders der, gegen 30 Ellen hohe, runde und sehr weite, unbedachte Thurm aus, dessen Mauern überaus dick sind, und der wahrscheinlich in der alten Ritterzeit zum Ausspähen der Feinde als Wartthurm diente. Er bedeckt eine isolirte 10 Ellen hohe Klippe, den höchsten Punkt des Schlossberges. Die neuen Gebäude, welche höchstens ein Alter von 2 bis 300 Jahre verrathen, sehr gut bewohnbar sind und viel Raum gewähren, bestehen aus zwei Hauptgebäuden, und einem mehrfach gebrochenen Flügel, welche meist drei Etagen hoch sind ... Einen Theil des Bergabhangs hat man in Gärten umgewandelt, und sie zum Theil terassirt ...
Die Aussichten von Scharfenstein gehen, wegen der Höhe der umliegenden Berge, nirgends weit, sind aber überaus romantisch ...«
So beschreibt Carl Heinrich Wilhelm Schönberg in seiner zeitgenössischen Stülpner-Biografie Schloss Scharfenstein. Es ist ein Schloss, wie es im (Geschichts- und Sagen-) Buche steht. Lage und Anlage sind reizvoll, scheinen der Fantasie eines Romantikers entsprungen zu sein; Ludwig Richter hat es gezeichnet. Die Anfänge liegen im Dunkel der Vergangenheit. Die ursprüngliche, wahrscheinlich um die Mitte des 13. Jahrhunderts entstandene Feste wurde offenbar zum Schutz eines im Tal vorbeiführenden Handelsweges nach Böhmen errichtet.
Die Burg soll, im Verein mit Burg Greifenstein bei Ehrenfriedersdorf, Raubritternest gewesen sein, war Witwensitz und kurfürstlich sächsischer Besitz, ist zu Kriegszeiten erobert und verwüstet worden. Jahrhundertelang war Scharfenstein Herrschaftssitz und Schutzburg für die umliegenden Dörfer, zeitweise auch für die Bergstädte Thum und Ehrenfriedersdorf. Wie jede echte und rechte Burg hat auch die zu Scharfenstein ihre geheimnisvollen unterirdischen Gänge und ihre gespenstische weiße Frau. Von 1492 bis 1931 war sie im Besitz eines Zweiges des bekannten, um die lutherische Reformation hochverdienten altadeligen sächsischen Geschlechts von Einsiedel.
Eines hat Scharfenstein wohl vor allen Schlössern und Burgen weit und breit voraus - von einem einzelnen Mann belagert worden zu sein. Und berühmt ist Scharfenstein heute offenbar weniger durch seine einstigen adeligen Besitzer und ihre wechselvollen Schicksale, sondern vielmehr als Geburts- und Heimatort eben dieses Burgbelagerers.
Nicht hoch oben aber »auf steiler Bergesspitze«, in der ritterlichen Feste, wurde der »kühne Schütze, königlich von Majestät«, geboren. Er erblickte ganz unten, am Fuß des Burgberges, an der tiefsten Stelle des Burgdorfes, in einer der armseligen Hütten im sogenannten »Gänsewinkel«, wo die ärmsten Untertanen ihr Federvieh hielten, das Licht einer so unromantischen und tristen wie gefahrvollen Welt.
Dies geschah am 30. September 1762. Er wurde als Carl Heinrich Stilpner (die Schreibweise änderte sich später) ins Taufregister des zuständigen Pfarramts im benachbarten Großolbersdorf, zu dem Scharfenstein eingepfarrt war, eingetragen.
Es war armer Leute Brauch, als Taufpaten für die Kinder solche Verwandte und Bekannte auszuwählen, die etwas »einzubinden« hatten - die wohlgestellt und freigebig genug waren, um dem Täufling eine Summe Geldes ins Taufkissen zu stecken, und von denen man erwarten konnte, dass sie das heranwachsende Kind mit Rat und Tat unterstützten. Auch traf man die Auswahl der Gevattern in dem Glauben, deren leibliche und geistige Eigenschaften gingen auf das Kind über. Dabei sollten aus verschiedenen Orten stammende Paten dem Kind ein langes Leben sichern. Bei Knaben war es üblich, zwei männliche und einen weiblichen Gevatter einzuladen. Ein lediger Pate verhieß zusätzliches Glück und Wohlergehen.
Die Paten des Carl Heinrich Stilpner waren die ledige Tochter eines Vollbauern aus dem benachbarten Dorf Venusberg, ein Kleinbauer aus dem in unmittelbarer Nähe liegenden Dörfchen Grießbach und ein Häusler, Zimmermeister und Königlich-sächsischer Waldläufer aus dem zwei Wegstunden entfernten Ort Krumhermersdorf bei Zschopau.
Neben den Menschenpaten standen als unsichtbare, gespenstische Gevattern die Armut, der Hunger und der Krieg an der Wiege des Jungen.
Die Wiege hatte der Vater mehr schlecht als recht noch in aller Eile zusammengezimmert. Vorigen Winter hatte er die alte, in der sieben Kinder ihr erstes Bett gefunden hatten, zu Brennholz gemacht. Carl Heinrich war ein unerwarteter Nachzügler. Die Mutter ging in ihr 45. Jahr, als sie mit ihm niederkam. Vielleicht war er unerwünscht. Wieder einmal herrschte Teuerung. Die Eltern wussten kaum, wie sie die Kinder sattbekommen sollten. Und es war Krieg. Der schreckliche Krieg ging in sein siebentes Jahr, als Stülpners noch den Jungen bekamen. Die heiratsfähigen großen Töchter hatten ein Recht darauf, sich ein ordentliches Kleid zu nähen. Es war ein denkbar ungünstiger Stern, unter dem der »kühne Schütze, königlich von Majestät«, geboren wurde.
Ursprünglich stammte Johann Christoph Stilpner von Bauern ab, die in der Gegend um Zschopau, in Krumhermersdorf, Börnichen und Waldkirchen ansässig waren. Infolge der Erbteilung waren aus den jüngeren Söhnen Kleinbauern, aus deren jüngeren Nachkommen Gärtner, dann Häusler und Handwerker, schließlich Tagelöhner geworden. Sein Vater war noch Schuhmacher in Krumhermersdorf gewesen. Als jüngerer Sohn erlernte er dieses Handwerk. Doch die Werkstatt übernahm der ältere Bruder. Zwei Schuster konnte der Ort nicht ernähren, auch in anderen Ortschaften fand der jüngere Stülpner-Schuster-Junge keine Stelle. Die wohlhabenderen Dörfler ließen ihr Schuhwerk vorwiegend in der Stadt machen, und die ärmeren Bewohner sparten selbst am Flickerlohn und gingen lieber barfuß. So sattelte der jüngere Stülpner aufs Müllerhandwerk um. Er kam als Knappe in die Scharfensteiner Schlossmühle. Vielleicht kam er auch schon auf Freiersfüßen dorthin. Jedenfalls ging seine Hoffnung, in eine Mühle einheiraten zu können, nicht in Erfüllung. Auch zur Pachtung reichte sein Geld nicht. Er blieb zeitlebens ein Müller ohne Mühle, so wie er ein Schuster ohne Leisten war. Den kargen Mühlknappenlohn suchte er durch Flickschusterei und andere Gelegenheitsarbeiten aufzubessern. Es war nicht selten, dass Familienväter in solcher Lage ein halbes Dutzend Nebenberufe ausübten, um die Familie ernähren zu können.
Am liebsten wäre der Stülpner-Vater Gärtner oder Förster geworden. Von klein auf war er mit Pflanzen und Tieren vertraut. Nicht umsonst war er am Bornwald aufgewachsen. Und das Schießen hatte er während des Militärdienstes gelernt. Doch zum Gärtnern fehlte ihm das Land, und die Schützenstellen schnappten ihm andere weg, die mehr Fürsprache genossen als er. Vielleicht schoss er, aus Trotz oder aus Not, nach der Mühlenschicht ab und zu heimlich einen Hasen.
Das Müllerhandwerk lag ihm nicht besonders. Der Mehlstaub legte sich ihm auf Seele und Lunge.
Wenn es auch mit dem Erwerb einer Mühle nicht klappte, so gelang es dem Müllerburschen Stülpner immerhin, sich ein wenn auch altes und winziges, so doch eigenes Häusel mit einem winzigen Streifen Land zu erheiraten. Seine Erwählte brachte so viel Geld mit in die Ehe, dass es, mit seinem mühselig Ersparten zusammen, ausreichte, das Anwesen im Scharfensteiner »Gänsewinkel« zu erstehen.
Die Stülpner-Mutter entstammte einer angesehenen Scharfensteiner Familie. Unter ihren Vorfahren befinden sich begüterte Handwerksmeister, herrschaftliche Förster und Holzvögte, Schöppen und Ortsrichter. Ihr Vater, Melchior Schubarth, war Häusler und herrschaftlicher Schütze auf Scharfenstein. Als Kind hatte sie, wenn auch nicht rosige, so doch gute Tage gesehen. Doch ihr Leben lang hielt sie treu und aufopferungsvoll zu Mann und Kindern, auch als schlimme und schlimmste Zeiten zu überstehen waren ...
Schuhkel aus, Schuhkel ei ...
»Schuhkel aus, Schuhkel ei, wo werd’ ich übers Jahr wohl sei?«
Das alte Sprüchel riefen die heiratswilligen Mädchen zum Andreasabend. Der Länge lang lagen sie auf der Stubendiele und warfen ihren Schuh hinter sich. Zeigte die Spitze des Schuhs nach der Tür, so würde die Werferin im kommenden Jahr aus dem Haus gehen und heiraten. Zeigte der Schuh in die Stube herein, so gab seine Lage an, aus welcher Richtung der künftige Liebhaber und Ehemann sich nahen würde.
So lernte auch der kleine Karl das Bleigießen kennen. Er goss so etwas Längliches, spitz Zulaufendes. »Eine Nadel, du wirst mal ein Schneider!«, rief eine der Schwestern.
»Es wird doch keine Flinte sein«, sagte die Mutter.
»Da wird er Jäger wie sein Großvater!«, rief eine andere Schwester.
»Oder Soldat wie sein Vater in jungen Jahren.«
»Davor behüte ihn der liebe Gott«, sagte die Mutter.
Den Jungen interessierte indessen weniger das Weibergeschwätz. Er beschäftigte sich mehr mit dem technischen Vorgang des Bleigießens. Wurden aus diesem Metall nicht auch Schießkugeln gegossen?
Gern geht Karl zur Großmutter. Sie wohnt kaum einen Steinwurf weit entfernt im oberen Teil des Ortes. In ihrer Wohnung hängen Jagdbilder und Rehgehörne an der Wand. Daran kann er sich nicht sattsehen. Und nicht satthören kann er sich, wenn die Großmutter vom Großvater erzählt, der herrschaftlicher Jäger war. Er nahm an vielen Jagden, auch an kurfürstlichen Hofjagden in den Wäldern um Marienberg und Reitzenhain teil. So wenig Sitzfleisch der Junge sonst hat, der Großmutter kann er stundenlang lauschen, wenn sie von den Pirschgängen und Jagden des Großvaters erzählt. Warum nur war er schon längst gestorben? Und warum saß ein Fremder als Schütze auf Scharfenstein?
Je älter Karl wird, um so mehr wird er in den Kreislauf der häuslichen und familiären Pflichten einbezogen. Jedes Kind muss nach Kräften zum Lebensunterhalt beitragen. Im Sommer gibt es nicht nur Beeren zu pflücken. Pilze müssen eingetragen werden, Brennreisig, Fichtenzapfen, Leseholz. Es gibt Wege zu belaufen, dem Vater Essen in die Mühle zu bringen. Auf dem Rittergut kann man sich durch Hilfsdienste in Stall und Speicher einen manchen zusätzlichen Bissen verdienen. Der Heranwachsende hat immer Hunger, und die häusliche Kost ist mager.
Das kleine Scharfenstein hatte weder eine eigene Kirche noch eine eigene Schule. Die Scharfensteiner Kinder mussten den steilen Berg hinauf in den Kirchspielhauptort Großolbersdorf gehen, wenn sie »Schreibn, lasen un singe« lernen wollten. Das war eine gute halbe Wegstunde. Im Sommer aber gab es in der elterlichen Wirtschaft und auf dem Gutshof viel zu tun. Während der Erntezeit fiel der Unterricht ganz aus. Die Bauernkinder wurden zu Hause gebraucht. In der kalten Jahreszeit gab es oft hohen Schnee, sodass für die Scharfensteiner Kinder gar kein Durchkommen war. Auch hatten sie oft kein geeignetes Schuhwerk und keine rechte Kleidung.
Der aufgeweckte Stülpner-Junge ging gern in die Schule. Er wollte schon wissen, was alles im Gesangbuch und in der Bibel stand, und er wollte die Zeilen selber entziffern. Und das Rechnen machte ihm regelrechten Spaß. Der Schulmeister setzte ihn auf den Ersten Platz in seiner Altersgruppe, und er war stolz darauf und nahm es sogar mit älteren Schülern auf.
Dann geschieht etwas Schreckliches. Der Vater wird ins »Bummerle« gesteckt, muss bei Wasser und Brot auf dem Schloss im Keller stecken. Und Kinder im Ort und bald auch im Nachbarort in der Schule zeigen mit Fingern auf den kleinen Stülpner und verachten und verhöhnen ihn, weil sein Vater ein Leinöldieb ist ...
Der Lehrer setzt ihn auf den letzten Platz. Eltern von Kindern, die nach ihm saßen, haben es von ihm verlangt.
Karl geht zur gewohnten Zeit mit den Schulsachen früh aus dem Haus. Doch er geht kaum noch in die Schule. Er versteckt das Schulzeug unterwegs in einem Strauch und streift durch den Wald. Hier können ihm die Spottreden der Kinder und der falsche Schulmeister gestohlen bleiben. Bei schlechtem Wetter geht er zur Großmutter.
Auf dem Dachboden der Großmutter entdeckt er eines Tages beim Stöbern eine alte Flinte. Er schafft sie heimlich aus dem Haus, versteckt sie im Wald in einem hohlen Baum. Jeden Tag sieht er nach, ob sie noch da ist, er hütet sie wie seinen Augapfel. Von den Jägern hat er sich bei den herrschaftlichen Jagden schon einiges in der Handhabung der Gewehre abgeguckt. Er weiß, wie das Schloss funktioniert, dass man alles sauber halten und ölen und trockenhalten muss. Einen Vorrat an Pulver und Blei hat er sich angelegt. Er beobachtet den Jäger, geht ihm zur Hand. Vom Winkler-Bauer, seinem Paten, lässt er sich die Flinte in Schuss bringen. Der kennt einen Büchsenmacher in Chemnitz. Auch Formen zum Kugelgießen weiß der Junge sich zu beschaffen. Wenn auch der erste Schuss danebengeht, er hat geknallt. Übung wird nun den Meister machen.
*
Irgendwann und irgendwie muss der spätere aktenkundige Wilddieb Stülpner zu einem Schießgewehr gekommen sein. Und das frühzeitig, denn er war frühzeitig fertig als solcher. Wenn er die Flinte nicht vom großelterlichen Oberboden stibitzt hat, hat er sie sich anderweitig beschafft. Früh übt sich, wer ein Meister werden will.
»So wusste er sich schon damals, ohne dass es seine Mutter bemerkte, eine alte Flinte zu verschaffen, die ihm als das heiligste und theuerste Kleinod galt.« Das ist alles, was der alte Stülpner seinem Memoirenschreiber verrät. Er wird dem, nach so vielen Jahren und einem wild bewegten Leben, auch keine Bedeutung weiter beigemessen haben.
So außergewöhnlich war es nicht, wenn sich in einem Ort wie Scharfenstein damals ein heranwachsender Junge für die Jägerei begeisterte. Der Alltag verlief eintönig, das Leben bot einem aufgeweckten Jungen wenig Abwechslung und Anregung. Da war eine herrschaftliche oder gar eine in der Nähe abgehaltene kurfürstliche Jagd ein großartiges, spannendes Ereignis. So wie später viele Jungen Lokomotivführer oder Piloten oder Fußballstars werden wollten, so war der Traumberuf vieler damaliger Jungen der des Jägers.
Scharfenstein bot die beste Vorbereitung auf diesen Beruf. Der Wald reichte bis in den Ort herein und zog sich weit an den Steilhängen der Zschopau hin und bis nach Hohndorf und die Hohe Straße hinauf, und jenseits begann der Bornwald, der in den Heinzewald überging. Ein hier aufwachsendes Kind wurde von klein an mit Gelände, Pflanze und Tier vertraut, lernte es, sich in dieser natürlichen Umgebung zu bewegen und zu beobachten.
Die Erzählungen der Großmutter mögen ein weiteres getan haben. Der Vater war nur ein Müllerbursche und Flickschuster. Der Großvater war ein geachteter herrschaftlicher Schütze gewesen, auf den der Enkel besonders stolz sein konnte. Müllerburschen, Waldarbeiter, Tagelöhner, Fuhrknechte, kleine Handwerker gab es genug. Herrschaftliche Jäger gab es nur einen weit und breit. Der Junge wollte wohl einmal in die Fußstapfen des Großvaters treten.
*
Über den vom Vater begangenen Diebstahl schweigt Stülpner-Schönberg sich aus wie über alles Ehrenrührige, das seine Familie und seine näheren Freunde und Bekannten betrifft. Doch die Gerichtsbücher lügen nicht. Das Repertorium verzeichnet die Akte »Wider Johann Christoph Stilpner und Consorten ergangene Untersuchung wegen bei Georg Gottfried Zöllnern gestohlenen Leinöls«. Das war im Jahre 1769. Karl war gerade sieben Jahre alt.
Die Stülpner waren bisher rechtliche Leute gewesen. Ihr Name war in noch keinem Gerichtsbuch aufgetaucht. Was brachte den Vater dazu, sich an fremdem Eigentum zu vergreifen?
Es war die bittere Not. Leinöl war eigentlich kein Nahrungsmittel. Es wurde für verschiedene Gewerbe in der Ölmühle gepresst. Es war Arm-Leute-Essen. Es war billig. Wer es nötig hatte, Leinöl zu stehlen, dem musste es schlimm ergehen.
1769 herrschte wieder einmal Teuerung. Die Ernte hatte wenig Korn geschüttet. Die Kosten für den 1763 zu Ende gegangenen Siebenjährigen Krieg betrugen schätzungsweise 300 Millionen Taler für das Land Kursachsen. Als im Jahre 1768, fünf Jahre nach dem Friedensschluss zu Hubertusburg, Friedrich August III., der später den Beinamen der Gerechte erhielt, die Regierung als Achtzehnjähriger in Dresden antrat, übernahm er noch 40 Millionen Taler an Kriegsschulden. Die Schulden wurden nach unten verteilt. Wirtschaft und Handel erholten sich nur langsam. Im verhältnismäßig dicht besiedelten und landwirtschaftlich durch seine klimatischen und bodenmäßigen Bedingungen nicht gut gestellten Erzgebirge litten viele Familien große Not. Auch die Stülpner in Scharfenstein wussten kaum, wie sie die Steuern fürs Haus und die Abgaben an die Gutsherrschaft aufbringen sollten.
Doch die Not sollte noch viel größer werden ...
Der Tod fiel zu unseren Fenstern herein
»Wie lautet Ihr Name?« Der Gerichtsdirektor der Herrschaft Scharfenstein fragt es hinter seinem von Akten beladenen Tisch im Gerichtszimmer auf Schloss Scharfenstein hervor in strengem Ton. Neben ihm sitzen der Pächter des Schlosses und Rittergutes und der Ortsrichter. Vor dem Tisch stehen eine Frau von etwa 55 Jahren, ein junger Mann und ein halbwüchsiger Junge.
»Ich heiße Stilpner«, sagt die Frau, »Marie Sophie Stilpnerin.«
»Stilpner«, sagt der Direktor. »Der Name ist hier schon bekannt.«
Er blättert in den Akten zurück, bespricht sich flüsternd mit den Beisitzern.
»Ah - hier haben wir die Akte«, sagt er. »Wider Johann Christoph Stilpner und Consorten ergangene Untersuchung wegen ... gestohlenen Leinöls! - Seid Ihr verwandt mit diesem -«
Er wendet sich wieder an die Frau.
»Er war mein Mann«, antwortet die Stülpnerin.
»Er war - ist er Ihr davongelaufen?«
»Er ist gestorben. Voriges Jahr. Gestorben >am Menschenelend<, wie der Herr Pastor es nennen.«
»Er wurde des Diebstahls überführt.«
»Er hat billiges Leinöl genommen und ist trotzdem verhungert. Ist das nicht Strafe genug?«
»Antwortet nur auf die Fragen! - Habt Ihr nichts aus der Verurteilung Eures Mannes gelernt? - Ihr seid des Getreide- und des Fleischdiebstahls angeklagt, verübt auf dem herrschaftlichen Speicher. Ihr habt das herrschaftliche Vertrauen missbraucht, als Ihr zu Arbeiten auf dem Speicher bestellt wart. Bekennt Ihr Euch schuldig?«
»Ich bekenne mich schuldig, vor Hunger und Not nicht mehr ein noch aus gewusst zu haben, Herr Gerichtshalter. Ich hab’ nicht mehr gewusst, was ich auf den Tisch bringen soll ...«
»Wie ich höre, habt Ihr Euch nicht nur selbst des Diebstahls schuldig gemacht. Ihr habt Euren Schwiegersohn Gottfried Mehner und Euren halbwüchsigen Sohn Karl zur Beihilfe angestiftet. Wie alt ist Euer Sohn?«
»Mein Sohn Karl ist neun Jahre alt.«
»Schämt Ihr Euch nicht, Euer eigenes unschuldiges Kind zur Ausübung einer strafbaren Handlung zu verführen?«
»Ich hab’ mich geschämt, mein eigenes unschuldiges Kind verhungern zu lassen, Herr Gerichtshalter. Ich hab’ nicht mehr mit ansehen können, wie mein Junge jeden Tag magerer und magerer wird, wie seine Backen einfallen, wie er schwächer und schwächer wird. Aus Häcksel und Kleie und Gras hab’ ich Suppe gekocht, Eicheln und Baumrinde und Wurzeln hab’ ich gemahlen und verbacken. Ist das Nahrung für einen heranwachsenden Jungen? Seht selbst« - die Stülpnerin trat mit dem Jungen an den Richtertisch heran -, »seht selbst, der Junge ist nur noch Haut und Knochen! Hat er kein Recht, gesund aufzuwachsen und zu leben? Kann er dafür, dass sein Vater gestorben ist und seine Mutter kein Geld hat, das teure Brot zu kaufen?«
Der Gerichtshalter richtete den Blick auf den Jungen und wandte ihn ab. Es war, als ob er etwas wie Scham fühle. Verlegen blätterte er in den Akten.