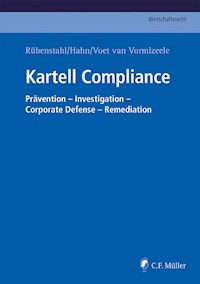
197,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C.F. Müller
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Verstöße gegen Kartellrechtsvorschriften können ein Unternehmen im Extremfall in seiner Existenz gefährden. Neben empfindlichen Geldbußen gegen das Unternehmen, Geschäftsführer und Mitarbeiter, einer Schädigung des Rufs sowie der Beziehungen zu Geschäftspartnern drohen auch strafrechtliche Sanktionen und Schadensersatzansprüche Dritter. Neben den Vorschriften des deutschen Rechts sind oft noch die Vorgaben des europäischen Kartellrechts und ggf. je nach Handelspartnern weitere Rechtsordnungen zu beachten. Das Handbuch behandelt das Thema Kartellrecht und Compliance umfassend und abschließend. 1. Teil: schlüssige Darstellung der besonderen materiell-rechtlichen Risikofelder der Kartell-Compliance, getrennt nach Kartell- und Strafrecht 2. Teil: vertiefende Erläuterung der Rechtsfolgen von Verstößen gegen das Kartellrecht einschließlich Schadensersatzklagen und Regressansprüche eines Unternehmens 3. Teil: praxisgerechte Erläuterung der von einem in der Krise befindlichen Unternehmen zu ergreifenden Maßnahmen sowie Verhaltensempfehlungen 4. Teil: umfassende Erläuterung der präventiven Kartell Compliance-Maßnahmen von der Errichtung eines Compliance Management Systems bis zur präventiven Absicherung durch D&O-Versicherungen 5. Teil: Überblick über wichtige Kartell Compliance-Erfordernisse in CH, A, F, I, E, USA, China, Russland und Brasilien, teilweise in englischer Sprache.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Kartell Compliance
Prävention – Investigation –Corporate Defense – Remediation
Herausgegeben von
Dr. Markus Rübenstahl, Mag. iurRechtsanwalt
Dr. Andreas HahnRechtsanwalt
Dr. Philipp Voet van VormizeeleRechtsanwalt
1. Auflage
C.F.Müller GmbH
www.cfmueller.de
Impressum
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-8114-5309-8
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 89 2183 7923Telefax: +49 89 2183 7620
www.cfmueller.de
© 2020 C.F. Müller GmbH, Waldhofer Straße 100, 69123 Heidelberg
Hinweis des Verlages zum Urheberrecht und Digitalen Rechtemanagement (DRM)Der Verlag räumt Ihnen mit dem Kauf des ebooks das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen. Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Der Verlag schützt seine ebooks vor Missbrauch des Urheberrechts durch ein digitales Rechtemanagement. Bei Kauf im Webshop des Verlages werden die ebooks mit einem nicht sichtbaren digitalen Wasserzeichen individuell pro Nutzer signiert.Bei Kauf in anderen ebook-Webshops erfolgt die Signatur durch die Shopbetreiber. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.
Vorwort
Kartellrechtliche Compliance ist heutzutage aus dem Alltag von Unternehmen und der sie im Kartellrecht beratenden Rechtsanwälte nicht mehr wegzudenken. Die Verhinderung der wirtschaftlichen und sonstigen Schäden, die einem Unternehmen bei einem Verstoß gegen Normen des Kartellrechts – sei es in Form von Bußgeldern, zivilrechtlichen Schadensersatzklagen oder straf- und vergaberechtlichen Konsequenzen – drohen, sind zweifellos einer der maßgeblichen Beweggründe für Unternehmensleitungen, effektive kartellrechtliche Compliance-Systeme zu etablieren. Eine solche Risikovorsorge ist daher heute richtigerweise Teil jeder guten Unternehmensführung. Das Kartellrecht gehört indes zu einem der komplexesten Rechtsgebiete mit einer hohen Schnittmenge zu ökonomischen Fragestellungen. Sowohl die Bewertung kartellrechtlich relevanter Sachverhalte als auch die Prävention, Aufdeckung und Ahndung kartellrechtlicher Verstöße stellt für die mit diesen Fragestellungen befassten Juristen und Ökonomen somit häufig eine besondere Herausforderung dar.
Das vorliegende Handbuch soll vor diesem Hintergrund eine pragmatische und zugleich umfassende Arbeitshilfe für alle interessierten und im Bereich der kartellrechtlichen Compliance tätigen Kreise sein. Die Autorinnen und Autoren bringen allesamt jahrelange Erfahrung im Bereich der kartellrechtlichen Compliance mit und stellen hier Ihr Praxiswissen zur Verfügung. Das Handbuch gliedert sich insgesamt in fünf Teile, die in Ihrer Gesamtschau ein umfassendes Bild über die Grundlagen und Handlungsfelder der Kartell-Compliance geben. Im ersten und zweiten Teil erfolgt eine Darstellung der wesentlichen materiellen und prozessualen Aspekte des Kartell- und Kartellverfahrensrechts sowie des Kartellstrafrechts sowie des zugehörigen Verfahrensrechts. Der dritte Teil konzentriert sich auf die Reaktionsmöglichkeiten, die sich einem Unternehmen im Falle einer Krise – also der Konfrontation mit einem kartellrechtlichen Verstoß – bieten. Der vierte Teil erläutert die Bausteine eines erfolgreichen Compliance Management-Systems zur Verhinderung der im dritten Teil beschriebenen Krisensituationen. Und letztlich schließt das Handbuch im fünften Teil mit einem Blick über den deutschen Tellerrand auf wesentliche ausländische Jurisdiktionen, was insbesondere für international agierende Unternehmen von besonderem Interesse sein dürfte.
Wir hoffen, dass es uns gelungen ist, mit der Zusammenstellung der Themen unserem Ziel einer hohen Praxisrelevanz gerecht geworden zu sein und den Lesern lehrreiche und vielleicht auch neue Einblicke in das spannende Themenfeld der Kartell-Compliance zu gewähren. Unser Dank gilt allen Autorinnen und Autoren, die zum Gelingen dieses Handbuchs beigetragen haben, und dem Verlag C.F. Müller und hier besonders Frau Annette Steffenkock und Frau Andrea Markutzyk für die zuverlässige Koordination und sachkundige Unterstützung.
Frankfurt/Stuttgart/Essen, im Oktober 2019 Die Herausgeber
Bearbeiterverzeichnis
Dr. Malte Abel, MBA
Syndikusrechtsanwalt, Uniper SE, Düsseldorf
20. Kapitel
Dr. Donata Beck
Rechtsanwältin, OPPENLÄNDER Rechtsanwälte, Stuttgart
16. Kapitel
Dr. Virginia Bellucci
Avvocato, Trevisan & Cuonzo, Milano
32. Kapitel (zusammen mit Canzi/Caminiti/Isolabella/Pietrantoni/Trevisan)
Marc Blumenauer
Global Legal Counsel, RAYGROUP SASU, Umkirch
26. und 28. Kapitel
Dr. Andreas Boos
Rechtsanwalt, BUNTSCHECK Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München
22. Kapitel
Dr. Tobias Brenner
Oberregierungsrat, Köln
12. Kapitel
Italia Caminiti
Avvocato, Studio legale Isolabella, Milano
32. Kapitel (zusammen mit Bellucci/Canzi/Isolabella/Pietrantoni/Trevisan)
Enrico Maria Canzi
Avvocato, Studio legale Isolabella, Milano
32. Kapitel (zusammen mit Bellucci/Caminiti/Isolabella/Pietrantoni/Trevisan)
Dr. Sibylle von Coelln
Rechtsanwältin, HEUKING • VON COELLN Rechtsanwälte PartG mbB, Düsseldorf
27. Kapitel (zusammen mit Heuking)
Dr. Lilly Fiedler
Rechtsanwältin, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Berlin
21. Kapitel (zusammen mit Seibt)
Elena Garcia Aguado
Compliance Officer, thyssenkrupp Elevator AG, Essen
33. Kapitel
Dr. Christian Haellmigk, LL.M.
Rechtsanwalt, CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Stuttgart
3. Kapitel
Dr. Andreas Hahn
Rechtsanwalt, OPPENLÄNDER Rechtsanwälte, Stuttgart
1. und 4. Kapitel
Dr. Isabella Hartung, LL.M.
Rechtsanwältin, Barnert Egermann Illigasch Rechtsanwälte GmbH, Wien
30. Kapitel
Berndt Hess
Rechtsanwalt, Frankfurt
25. Kapitel
Christian Heuking
Rechtsanwalt, HEUKING • VON COELLN Rechtsanwälte PartG mbB, Düsseldorf
27. Kapitel (zusammen mit von Coelln)
Ricardo Inglez de Souza
Advogado, IWRCF Advogados, São Paulo
37. Kapitel
Francesco Isolabella
Avvocato, Studio legale Isolabella, Milano
32. Kapitel (zusammen mit Bellucci/Canzi/Caminiti/Pietrantoni/Trevisan)
Frank Jiang
Equity Partner, Zhong Lun Law Firm, Beijing
35. Kapitel (zusammen mit J. Jiang/Yu)
John Jiang
Counsel, Zhong Lun Law Firm, Beijing
35. Kapitel (zusammen mit F. Jiang/Yu)
Dr. Christian Karbaum
Rechtsanwalt, Glade Michel Wirtz, Düsseldorf
2. Kapitel
Dr. Lars Kogel, MBA
Rechtsanwalt, Head of Compliance, thyssenkrupp Elevator AG, Essen
23. Kapitel
Dr. Matthias Lorenz
Rechtsanwalt, OPPENLÄNDER Rechtsanwälte, Stuttgart
15. Kapitel (zusammen mit Wolf)
Daniil Lozovsky
Attorney, ALRUD Law Firm, Moscow
36. Kapitel (zusammen mit Rudomino/Vedernikov/Zakharov)
David Mamane, LL.M.
Rechtsanwalt, Schellenberg Wittmer AG, Zurich
29. Kapitel
Uwe Mühlhoff
Oberstaatsanwalt, Staatsanwaltschaft Duisburg
10. Kapitel
Dr. Philipp Otto Neideck, LL.M.
Rechtsanwalt, Hengeler Mueller Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Düsseldorf
8. Kapitel (zusammen mit Willer)
Dr. Alexander Paradissis
Rechtsanwalt, verte|rechtsanwälte, Köln
6. Kapitel
Nicola Pietrantoni
Avvocato, Studio legale Isolabella, Milano
32. Kapitel (zusammen mit Bellucci/Canzi/Caminiti/Isolabella/Trevisan)
Dr. med. Mathias Priewer
Rechtsanwalt und Arzt, Hengeler Mueller Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Berlin
13. Kapitel
Dr. Lukas Ritzenhoff
Rechtsanwalt, Hengeler Mueller Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Berlin
18. und 34. Kapitel
Dr. Andreas Rosenfeld
Rechtsanwalt, Redeker Sellner Dahs Rechtsanwälte, Bonn/Brüssel
7. Kapitel
Dr. Markus Rübenstahl, Mag. iur.
Rechtsanwalt, Rübenstahl Rechtsanwälte, Frankfurt
5. Kapitel
Vassily Rudomino
Senior Partner, ALRUD Law Firm, Moscow
36. Kapitel (zusammen mit Lozovsky/Vedernikov/Zakharov)
Dr. Florian Schmidt-Volkmar
Rechtsanwalt, OPPENLÄNDER Rechtsanwälte, Stuttgart
14. und 17. Kapitel
Dr. Markus Schöner, M.Jur.
Rechtsanwalt, CMS Hasche Sigle, Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Hamburg
24. Kapitel (zusammen mit Soltau)
Dr. Max Schwerdtfeger
Rechtsanwalt, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Düsseldorf
9. Kapitel (zusammen mit Travers)
Prof. Dr. Christoph H. Seibt, LL.M.
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Hamburg
21. Kapitel (zusammen mit Fiedler)
Christoff Henrik Soltau, LL.M.
Rechtsanwalt, CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Hamburg
24. Kapitel (zusammen mit Schöner)
Dr. Daniel Travers
Rechtsanwalt, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Düsseldorf
9. Kapitel (zusammen mit Schwerdtfeger)
Luca Trevisan
Avvocato, Trevisan & Cuonzo, Milano
32. Kapitel (zusammen mit Bellucci/Canzi/Caminiti/Isolabella/Pietrantoni)
Roman Vedernikov
Associate, ALRUD Law Firm, Moscow
36. Kapitel (zusammen mit Lozovsky/Rudomino/Zakharov)
Dr. Philipp Voet van Vormizeele
Rechtsanwalt, thyssenkrupp Elevator AG, Essen
11. und 19. Kapitel
Dr. Ralf Willer
Rechtsanwalt, Avocat à la cour, Hengeler Mueller Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Berlin
8. Kapitel (zusammen mit Neideck) und 31. Kapitel
Dr. Christoph Wolf
Rechtsanwalt, OPPENLÄNDER Rechtsanwälte, Stuttgart
15. Kapitel (zusammen mit Lorenz)
Scott Yu
Equity Partner, Zhong Lun Law Firm, Beijing
35. Kapitel (zusammen mit F. Jiang/J. Jiang)
German Zakharov
Partner, ALRUD Law Firm, Moscow
36. Kapitel (zusammen mit Lozovsky/Rudomino/Vedernikov)
Zitiervorschlag:
Rübenstahl/Hahn/Voet van Vormizeele/Abel 20. Kap. Rn. 1
Vorwort
Bearbeiterverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
1. TeilBesondere materiell-rechtliche Risikofelder der Kartell-Compliance
Kartellrecht
1. KapitelKartellverbot und horizontale Wettbewerbsbeschränkungen
I.Einleitung
1.EU- oder deutsches Kartellrecht?
2.Der Tatbestand
a)Die Normadressaten
aa)Unternehmen
bb)Unternehmensvereinigung
b)Die erfassten Handlungsformen
aa)Vereinbarung
bb)Beschluss
cc)Abgestimmte Verhaltensweise
c)Die Wettbewerbsbeschränkung
aa)Der Begriff der Wettbewerbsbeschränkung
bb)Horizontale und vertikale Wettbewerbsbeschränkungen
cc)Bezwecken oder bewirken
dd)Spürbarkeit
3.Freistellung vom Kartellverbot
a)Gruppenfreistellungsverordnungen
b)Einzelfreistellung (Legalausnahme)
aa)Verbesserung der Warenerzeugung oder Verteilung – Effizienzgewinne
bb)Angemessene Beteiligung der Verbraucher
cc)Unerlässlichkeit
dd)Keine Ausschaltung wesentlichen Wettbewerbs
4.Rechtsfolgen
a)Zivilrechtliche Folgen
b)Verwaltungsrechtliche Folgen
c)Bußgeldrechtliche Folgen
II.Horizontale Wettbewerbsbeschränkungen
1.Verkaufskooperationen
2.Einkaufskooperationen
3.Produktionskooperationen
4.Arbeitsgemeinschaften
5.Forschungs- und Entwicklungskooperationen
6.Wettbewerbsverbote
7.Informationsaustausch
8.Vergleiche, Abgrenzungsvereinbarungen und Schiedssprüche
9.Sternverträge/Hub & Spoke-Problematik
2. KapitelVertikale Vereinbarungen
A.Vertikale Vereinbarungen: Grundlagen
I.Einführung
1.Bedeutung vertikaler Wettbewerbsbeschränkungen
2.Vertikale Vereinbarungen als Compliance-Herausforderung
II.Rechtsrahmen für vertikale Wettbewerbsbeschränkungen
1.Art. 101 AEUV
2.VO 330/2010 („Vertikal-GVO“)
3.Bedeutung des nationalen Rechts
4.Soft law
a)Rechtsnatur und praktische Bedeutung
b)Softlaw der Kartellbehörden im Überblick
III.Praxisleitfaden für die Prüfung vertikaler Vereinbarungen
1.Erster Schritt: Vertikale Wettbewerbsbeschränkung
2.Zweiter Schritt: Anwendungsbereich der Vertikal-GVO eröffnet?
3.Dritter Schritt: Einschränkungen des generellen Anwendungsbereichs
4.Vierter Schritt: Marktanteilsschwellen
5.Fünfter Schritt: Kernbeschränkungen und Wettbewerbsverbote
6.Sechster Schritt: Entzug der Gruppenfreistellung und Nichtanwendbarkeit der GVO
7.Siebter Schritt: Art. 101 Abs. 3 AEUV
a)Möglichkeit der Einzelfreistellung nach Art. 101 Abs. 3 AEUV
b)Rechtsfolgen
aa)Bußgeldrisiko
bb)Zivilrechtliche Nichtigkeit
B.Einzelne Beschränkungen
I.Gebiets- und Kundengruppenbeschränkungen
1.Beschränkungen i.S.v. Art. 4 lit. b Vertikal-GVO
2.Ausnahmen nach Art. 4 lit. b Ziff. i-iv Vertikal-GVO
a)Verbot des aktiven Verkaufs in/an exklusiv zugewiesene Gebiete/Kundengruppen
b)Sprunglieferungsverbot
c)Beschränkungen im Selektivvertrieb
d)Beschränkung beim Verkauf von Zwischenprodukten
e)Verbote des Vertriebs von Graumarktware
3.Gebiets- und Kundenbeschränkungen im Überblick
II.Preis- und Konditionenbeschränkungen
1.Vertikale Preisbindung
a)Das Preisbindungsverbot i.S.d. Art. 4 lit. a Vertikal-GVO
aa)Preisbindung zulasten der Abnehmer
bb)Verbot der versuchten Preisbindung im deutschen Recht (§ 21 Abs. 2 GWB)
b)Maßnahmen der Preispflege
aa)Höchstpreise
bb)UVP
cc)Faktische Preisbindung durch Druck oder Anreize als Grenzen der zulässigen Preise
dd)Preisüberwachungssysteme („Preisbindungsverbot 2.0“)
ee)Sonderproblem: Datenaustausch zwischen Hersteller und Händler
c)Möglichkeiten der Einzelfreistellung nach Art. 101 Abs. 3 AEUV
d)Vertikale Preisbindung im Überblick
2.Meistbegünstigungsklauseln (insbesondere sog. Bestpreisklauseln)
a)Bestpreis- und Preisparitätsklauseln als aktuelles Online-Phänomen
aa)Enge und weite Bestpreisklauseln von Buchungsportalen
bb)Anwendbarkeit von Art. 101 Abs. 1 AEUV
cc)Anwendbarkeit der Vertikal-GVO auf Bestpreisklauseln
dd)Möglichkeit der Einzelfreistellung
b)Meistbegünstigungsklauseln im Übrigen
c)Bestpreisklauseln im Überblick
3.Konditionenbindungen
III.Wettbewerbsverbote und Ausschließlichkeitsbindungen
1.Überblick
2.Wettbewerbsverbot i.S.d. Art. 1 Abs. 1 lit. d Vertikal-GVO
a)Verpflichtungen zulasten des Anbieters
b)Unmittelbare oder mittelbare Verpflichtung
c)Ausschluss der Anwendbarkeit von Art. 101 Abs. 1 AEUV bei notwendigen Nebenabreden
3.Zeitliche Beschränkung von Wettbewerbsverboten, Art. 5 Abs. 1 lit. a, Abs. 2 Vertikal-GVO
4.Nachvertragliche Wettbewerbsverbote, Art. 5 Abs. 1 lit. b, Abs. 3 Vertikal-GVO
5.Wettbewerbsverbote in selektiven Vertriebssystemen, Art. 5 Abs. 1 lit. c Vertikal-GVO
6.Zivilrechtliche Rechtsfolgen
7.Wettbewerbsverbote und Ausschließlichkeitsbindungen im Überblick
IV.Besondere Vertriebsformen
1.Selektiver Vertrieb
a)Überblick
b)Anwendbarkeit von Art. 101 Abs. 1 AEUV
aa)Qualitativer Selektivvertrieb („Metro“-Kriterien)
bb)Quantitativer Selektivvertrieb und sonstige Selektionskriterien
c)Freistellung vom Kartellverbot
aa)Freistellung nach Art. 2 Abs. 1 Vertikal-GVO
bb)Einzelfreistellung nach Art. 101 Abs. 3 AEUV
2.Internet-Vertrieb
a)Totalverbot des Internet-Vertriebs
b)Drittplattformverbote
c)Beschränkung von Online-Werbung
d)Verbot der Unterstützung von Preisvergleichsportalen
e)Doppelpreissysteme (dual pricing)
f)Qualitative Anforderungen an den Online-Vertrieb in selektiven Vertriebssystemen
g)Internet-Vertrieb im Überblick
3. KapitelEinseitige Verhaltensweisen und Missbrauch von Marktmacht
A.Einführung
I.Grundlagen und Schutzzwecke
II.Verhältnis von deutschem und europäischem Kartellrecht
B.Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung
I.Marktbeherrschende Stellung
1.Abgrenzung des relevanten Marktes
a)Der sachlich relevante Markt
b)Der räumlich relevante Markt
c)Der zeitlich relevante Markt
d)Marktabgrenzung bei Unentgeltlichkeit der Leistung
2.Feststellung einer marktbeherrschenden Stellung
a)Einzelmarktbeherrschung
b)Kollektive Marktbeherrschung
c)Erweiterung auf Unternehmen nach § 19 Abs. 3 GWB im nationalen Recht
d)Marktbeherrschung auf mehrseitigen Märkten und in Netzwerken
II.Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung
1.Missbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung – Generalklausel und Beispielkatalog
2.Kategorien des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung
a)Abgrenzung der Missbrauchskategorien
b)Ausbeutungsmissbrauch
aa)Preishöhenmissbrauch
bb)Konditionenmissbrauch
cc)Diskriminierender bzw. behindernder Preishöhenmissbrauch/Konditionenmissbrauch
dd)Ausbeutungsmissbrauch im Rahmen des Anzapfverbots (§ 19 Abs. 2 Nr. 5 GWB)
c)Behinderung und Ungleichbehandlung
aa)Inhalt des Behinderungs- und Diskriminierungsverbotes
bb)Verhältnis von Behinderung und Ungleichbehandlung
cc)Fallgruppen mit horizontalem Schwerpunkt
(1)Kampfpreise („predatory pricing“)
(2)Kopplungsgeschäfte
(3)Rabattsysteme
dd)Fallgruppen mit vertikalem Schwerpunkt: Insbesondere Nichtbelieferung von Abnehmern (Geschäfts- und Lieferverweigerung) sowie Bezugsverweigerung gegenüber Lieferanten
(1)Nichtbelieferung von Abnehmern
(2)Bezugsverweigerung gegenüber Lieferanten
ee)Behinderung beim Zugang zu wesentlichen Einrichtungen („essential facility“)
C.Verbotenes Verhalten von Unternehmen mit relativer oder überlegener Marktmacht
I.Behinderungs- und Diskriminierungsverbot für marktstarke Unternehmen (§ 20 Abs. 1 GWB)
II.Anzapfverbot für marktstarke Unternehmen (§ 20 Abs. 2 GWB)
III.Behinderungsverbot für Unternehmen mit überlegener Marktmacht (§ 20 Abs. 3, 4 GWB)
D.Ausblick
4. KapitelFusionskontrolle und transaktionsbezogene Risiken
A.Einführung
B.Europäische Fusionskontrolle
I.Zusammenschlusstatbestand
1.Fusion
2.Kontrollerwerb
a)Alleinige Kontrolle
b)Gemeinsame Kontrolle – Gemeinschaftsunternehmen
aa)Erwerb der gemeinsamen Kontrolle
bb)Vollfunktionscharakter
II.Gemeinschaftsweite Bedeutung
1.Umsatzschwellen
2.Beteiligte Unternehmen
3.Umsatzberechnung
4.Extraterritoriale Anwendung der FKVO
III.Wettbewerbliche Beurteilung von Zusammenschlüssen
1.Marktabgrenzung
a)Sachlicher Markt
b)Räumlicher Markt
2.Erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs
a)Einzelmarktbeherrschung
b)Oligopolmarktbeherrschung
c)Effizienzgewinne
d)Sanierungsfusion
e)Beurteilung von Gemeinschaftsunternehmen
3.Nebenabreden
IV.Das Fusionskontrollverfahren
1.Anmeldung
2.Das Vorprüfungsverfahren (Phase I)
3.Das Hauptprüfungsverfahren (Phase II)
4.Vollzugsverbot
a)Inhalt des Vollzugsverbots
b)Maßnahmen zwischen Signing und Closing (pre closing covenants)
c)Ausnahmen und Befreiung vom Vollzugsverbot
d)Rechtsfolgen eines Verstoßes
5.Gerichtlicher Rechtsschutz
V.Verhältnis zur nationalen Fusionskontrolle
C.Deutsche Fusionskontrolle
I.Zusammenschlusstatbestand
1.Vermögenserwerb
2.Kontrollerwerb
3.Anteilserwerb
4.Wettbewerblich erheblicher Einfluss
5.Einschränkungen des Zusammenschlussbegriffs
II.Umsatzschwellen
1.Schwellenwerte
2.Beteiligte Unternehmen
3.Umsatzberechnung
4.Exterritoriale Anwendung des GWB
III.Wettbewerbliche Beurteilung von Zusammenschlüssen
1.Der Marktbeherrschungstest
a)Marktabgrenzung
b)Voraussetzungen der Marktbeherrschung
2.Einzelmarktbeherrschung
3.Oligopolmarktbeherrschung
4.Marktbeherrschungsvermutungen
5.Begründung oder Verstärkung von Marktbeherrschung
6.Abwägungsklausel
7.Beurteilung von Gemeinschaftsunternehmen
IV.Das Fusionskontrollverfahren
1.Anmeldung
2.Das Vorprüfverfahren (Phase I)
3.Das Hauptprüfverfahren (Phase II)
4.Beteiligung Dritter/Beiladung
5.Ministererlaubnis
6.Vollzugsverbot
7.Rechtsschutz
Strafrecht
5. KapitelStrafbare Submissionsabsprachen und (Submissions-)Betrug
A.Einführung
I.Submissionsabsprachen als Kartellstrafrecht im engeren Sinne
II.Ursachen und Erscheinungsformen
III.Entwicklung und Bestand des Kartellstrafrechts im engeren Sinne
B.Der Submissionsbetrug (§ 263 StGB)
I.Allgemeines
II.Objektiver Tatbestand
1.Täuschung, Irrtum und Vermögensverfügung
2.Vermögensschaden
a)Vermögensschaden beim Submissionsbetrug bis zur „Rheinausbauentscheidung“
b)Vermögensschaden in der Form des Eingehungsbetrugs zulasten des Auftraggebers
c)Vermögensschaden in der Form des Erfüllungsbetrugs zulasten des Auftraggebers
d)Eingehungsbetrug zu Lasten der Mitbewerber
III.Subjektiver Tatbestand
C.Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen (§ 298 StGB)
I.Hintergrund der Regelung
II.Rechtsgut
III.Deliktsnatur und Tatbestandsstruktur
IV.Kontext der Tat: Ausschreibung über Waren oder gewerbliche Leistungen
1.Begriff der Ausschreibung
2.Öffentliche Ausschreibungen
a)Allgemeines
b)Ober- und unterschwelliger Bereich: Unterschiedliche Verfahrensregelungen
c)Verfahrensarten der öffentlichen Ausschreibung gem. § 298 Abs. 1 StGB
d)Weitere tatbestandliche Verfahren mit zusätzlichem Erfordernis des Teilnahmewettbewerbs gem. § 298 Abs. 2 StGB?
e)De-facto-Vergabe und rechtsfehlerhafte Vergabeverfahren
3.Private Ausschreibungen
4.Ausschreibungen der EU und Ausschreibungen im Ausland
V.Tathandlung: Abgabe eines Angebots
VI.(Zugrundeliegende) kartellrechtswidrige Absprache
1.Absprache
2.Beteiligte der Absprache
3.(Kartell-)Rechtswidrigkeit der Absprache
4.Finalität der Absprache: Veranlassen eines bestimmten Angebots
VII.Kausalität und objektive Zurechnung des Angebots zur rechtswidrigen Absprache
VIII.Subjektiver Tatbestand
IX.Vollendung und Beendigung
X.Täterschaft und Teilnahme
XI.Unterlassen
XII.Tätige Reue (§ 298 Abs. 3 StGB)
XIII.Konkurrenzen
XIV.Kurze Hinweise zum Verfahrensrecht
6. KapitelSonstige Begleit- und Anschlussdelikte
A.Praktische Relevanz sonstiger Begleit- und Anschlussdelikte
B.Die Delikte im Einzelnen
I.Untreue (§ 266 StGB)
1.Tatbestand der Untreue vor und neben kartellrechtswidrigem Verhalten
2.Untreue durch Übernahme von Verteidigungskosten oder Geldbußen
II.Korruption (§ 299 und §§ 331 ff. StGB)
1.Amtsträgerkorruption (§§ 331 ff. StGB)
2.Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr (§ 299 StGB)
III.Verletzung von Geschäftsgeheimnissen (§ 23 GeschGehG)
IV.Nötigung und Erpressung (§§ 240, 253 StGB)
V.Bildung krimineller Vereinigungen (§ 129 StGB)
VI.Steuerhinterziehung (§ 370 AO)
2. TeilVerfahren und Rechtsfolgen
7. KapitelVerteidigung in Bußgeldverfahren bei Kartellverstößen (Deutschland)
A.Allgemeines
I.Systematik der Bußgeldregelung des GWB
II.Verhältnis zum Kartellverwaltungsverfahren
III.Verhältnis von deutschem und europäischem Kartellordnungswidrigkeitenrecht
B.Die Bußgeldtatbestände des § 81 GWB
I.Verstöße gegen § 81 Abs. 1 GWB
1.§ 81 Abs. 1 Nr. 1 GWB i.V.m. Art. 101 Abs. 1 AEUV
2.§ 81 Abs. 1 Nr. 2 GWB i.V.m. Art. 102 S. 1 AEUV
II.Verstöße gegen § 81 Abs. 2 Nr. 1 GWB
1.§ 81 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 1 GWB
2.§ 81 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 19 GWB
3.§ 81 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 20 GWB
4.§ 81 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 21 Abs. 3 und 4 GWB
5.§ 81 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 29 S. 1 GWB
6.§ 81 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 41 Abs. 1 S. 1 GWB
III.Verstöße gegen § 81 Abs. 2 Nr. 2 GWB
IV.Verstöße gegen § 81 Abs. 2 Nr. 3 GWB
V.Verstöße gegen § 81 Abs. 2 Nr. 4 GWB
VI.Verstöße gegen § 81 Abs. 2 Nr. 5 GWB
VII.Verstöße gegen § 81 Abs. 2 Nr. 5a GWB
VIII.Verstöße gegen § 81 Abs. 2 Nr. 5b GWB
IX.Verstöße gegen § 81 Abs. 2 Nr. 6 GWB
X.Verstöße gegen § 81 Abs. 2 Nr. 7 GWB
XI.Verstöße gegen § 81 Abs. 3 Nr. 1 und 2 GWB
XII.Verstöße gegen § 81 Abs. 3 Nr. 3 GWB
C.Bußgeldrechtliche Verantwortlichkeit
I.Handeln und Unterlassen
II.Zurechnung nach § 9 OWiG
III.Erweiterung des Täterkreises gem. § 14 OWiG
IV.Aufsichtspflichtverletzung gem. § 130 OWiG
V.Verbandsgeldbuße nach § 30 OWiG
D.Schuldmaßstab
I.Vorsatz
II.Fahrlässigkeit
E.Konkurrenzen
F.Bußgeldbemessung
I.Fester Bußgeldrahmen
II.Umsatzbezogener Bußgeldrahmen
III.Abschöpfung des wirtschaftlichen Vorteils
IV.Verzinsung
V.Steuerliche Behandlung der Geldbuße
G.Sonstige Sanktionen
I.Eintragung in das Gewerbezentralregister
II.Ausschluss von Vergabeverfahren
III.Abschöpfung des wirtschaftlichen Vorteils
H.Verjährung
I.Verjährungsfristen
II.Unterbrechungen
I.Zuständigkeiten
I.Das Bundeskartellamt
II.Die obersten Landesbehörden
J.Das Bußgeldverfahren
I.Verfahrensgrundsätze im Kartellbußgeldverfahren
II.Einleitung des behördlichen Bußgeldverfahrens
1.Ermittlungsbefugnisse der Kartellbehörde
a)Durchsuchungen
b)Sicherstellung von Beweismitteln
c)Zugriff auf elektronisch gespeicherte Daten
d)Zufallsfunde
e)Vernehmung von Zeugen
f)Rechtsbehelfe
g)Auskunftsverlangen durch Richtlinie 2019/1
2.Rechtsstellung und Verteidigung des Betroffenen
a)Aussagefreiheit
b)Kooperation
c)Rechtliches Gehör
d)Recht auf Verteidigung und Akteneinsicht
III.Abschluss des Ermittlungsverfahrens
1.Einstellung des Verfahrens
2.Erlass eines Bußgeldbescheids
3.Settlement
4.Vollstreckung des Bußgeldbescheids
IV.Einspruch gegen den Bußgeldbescheid
K.Übergang an die Staatsanwaltschaft
I.Einstellung des Verfahrens durch die Staatsanwaltschaft
II.Vorlage an das OLG
L.Das gerichtliche Bußgeldverfahren
I.Zuständigkeit des OLG
II.Verfahrensgrundsätze des gerichtlichen Bußgeldverfahrens
III.Ablauf des gerichtlichen Bußgeldverfahrens
1.Zulässigkeit des Einspruchs
2.Hauptverhandlung oder schriftliches Beschlussverfahren
3.Ablauf der Hauptverhandlung
IV.Beteiligung der Kartellbehörde im gerichtlichen Verfahren
1.Formlose Mitwirkung außerhalb des förmlichen Verfahrens
2.Anwesenheitsrecht
3.Antragsrecht
4.Gelegenheit zur Äußerung
5.Befragung von Zeugen, Sachverständigen und Betroffenen
6.Erklärung nach § 257 StPO
7.Verfahrenseinstellung
8.Schlussvortrag
9.Mitteilung abschließender Entscheidungen
10.Ausweitung der Beteiligung durch Richtlinie 2019/1
V.Reformatio in peius
VI.Vollstreckung der gerichtlichen Bußgeldentscheidung
M.Rechtsbeschwerde zum BGH
8. KapitelDie Verteidigung in Bußgeldverfahren bei Wettbewerbsverstößen (EU)
I.Rechtsquellen und Beteiligte
II.Unternehmensinterner Umgang mit Wettbewerbsverstößen
III.Zuständigkeit der EU Kommission und Abgrenzung von mitgliedstaatlichen Wettbewerbsbehörden
IV.(Vor-)Ermittlungsphase: Ermittlungsbefugnisse der Kommission und ihre Grenzen
1.Auskunftsverlangen und Auskunftsentscheidung nach Art. 18 VO 1/2003
a)Gemeinsamkeiten von Auskunftsverlangen und Auskunftsentscheidung
b)Auskunftsverlangen
c)Auskunftsentscheidung
2.Nachprüfungsbefugnisse der Kommission (dawn raid), Art. 20 f. VO 1/2003
a)Nachprüfung bei Unternehmen und Unternehmensvereinigungen nach Art. 20 VO 1/2003
aa)Prüfungsauftrag
bb)Nachprüfungsentscheidung
b)Sonderreglung für „andere Räumlichkeiten“ nach Art. 21 VO 1/2003
3.Befragung nach Art. 19 VO 1/2003
4.Grenzen der Ermittlungsbefugnisse
a)Verbot der Selbstbezichtigung (nemo tenetur)
b)Anwaltsgeheimnis (Legal Professional Privilege) nach EU-Recht
5.Umgang mit Geschäftsgeheimnissen
6.Begleitung der Vorermittlungen und Vorbereitung der Entscheidungsphase
V.Entscheidungsphase
1.Verfahrensweg und Verteidigung im Bußgeldverfahren, Art. 7, 23 Abs. 2 VO 1/2003
a)Verfahrenseinleitung
b)Mitteilung der Beschwerdepunkte
c)Akteneinsicht, einvernehmliche Einsichtnahme und Datenraum-Verfahren
d)Stellungnahme auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte
e)Mündliche Anhörung
f)Erlass einer Entscheidung
2.Verfahrensweg und Verteidigung bei Verpflichtungszusagen
3.Einvernehmliche Verfahrensbeendigung (Settlement Procedure)
4.Bindungswirkung der verfahrensbeendenden Entscheidung
a)Entscheidungen der Kommission
b)Reichweite und Umfang der Bindungswirkung
VI.Verjährung
1.Verfolgungsverjährung, Art. 25 VO 1/2003
a)Beginn und Ende der Verjährung
b)Unterbrechung und Ruhen der Verjährung
c)Folgen der Verjährung
2.Vollstreckungsverjährung, Art. 26 VO 1/2003
VII.Rechtsschutz
1.Rechtsschutz gegen Untersuchungsmaßnahmen
2.Rechtsschutz gegen verfahrensabschließende Maßnahmen
3.Zwangsgelder und Bußgelder wegen Obstruktionsmaßnahmen
9. KapitelBesonderheiten der Verteidigung in Kartellstrafverfahren (einschließlich nicht kartellrechtlicher Unternehmensgeldbußen gem. § 30 OWiG)
A.Verteidigung von Individualpersonen in Kartellstrafverfahren
I.Straftaten im Zusammenhang mit Kartellsachverhalten
II.Sachliche Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft
III.Zuständigkeit der Kartellbehörden für Unternehmensgeldbußen im Zusammenhang mit Kartellstraftaten
IV.Parallele Ermittlungen durch Staatsanwaltschaft und Kartellbehörden
V.Zusammenarbeit zwischen Staatsanwaltschaft und Kartellbehörden
VI.Sachliche Zuständigkeit der Gerichte im Strafverfahren
VII.Örtliche Zuständigkeit von Gericht und Staatsanwaltschaft
VIII.Verfahrensablauf
1.Einleitung des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens gegen eine Individualperson
2.Interdependenzen zwischen Strafverfahren und kartellbehördlichem Bußgeldverfahren
3.Ermittlungsverfahren
a)Durchsuchung, §§ 102 ff. StPO
b)Sicherstellung zur Durchsicht von Papieren und Speichermedien gem. § 110 StPO und Beschlagnahme gem. §§ 94 ff. StPO
c)Telekommunikationsüberwachung
d)Rechtsbehelfe
4.Zwischenverfahren
5.Hauptverfahren
6.Berufung und Revision als Rechtsmittel
IX.Ausgewählte Verfahrensbeteiligte
1.Beschuldigte
2.Der Zeuge
3.Der Zeugenbeistand
4.Der Verletzte
5.Unternehmen als Nebenbeteiligte des Strafverfahrens
X.Ausgewählte Verfahrensgrundsätze mit kartellrechtlicher Relevanz
1.Legalitätsprinzip
2.Nemo tenetur-Prinzip
3.Kronzeugenregelung gem. § 46b StGB
XI.Einstellung des Verfahrens aus Opportunitätsgründen
XII.Strafen, Sanktionen und Maßnahmen
1.Geld- und Freiheitsstrafe
a)Freiheitsstrafe
b)Geldstrafe
2.Einziehung als Vermögensabschöpfung
XIII.Interdependenzen zwischen Strafurteil und vorangegangenem Bußgeldbescheid sowie ne bis in idem
B.Verteidigung von Unternehmen gegen die staatsanwaltliche Festsetzung von Unternehmensgeldbußen gem. § 30 OWiG sowie die Einziehung von Vermögenswerten gem. §§ 73 ff. StGB und § 29a OWiG
I.Geltendes Unternehmenssanktionenrecht und Reformbestrebungen
1.Defizite des Unternehmenssanktionenrechts
2.Diskussion um die Einführung eines Unternehmensstrafrechts
II.Die Unternehmensgeldbuße gem. § 30 OWiG und das nicht-kartellrechtliche Bußgeldverfahren
1.Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft im Bußgeldverfahren
a)Verfolgungs- und Ahndungszuständigkeit bei Straftaten
b)Verfolgungs- und Ahndungszuständigkeit bei Ordnungswidrigkeiten
2.Voraussetzungen
3.Rechtsfolge
a)Ahndungsanteil
b)Abschöpfungsanteil
4.Besonderheiten des nicht-kartellrechtlichen Bußgeldverfahrens
a)Das verbundene Verfahren
aa)Rolle und Rechte des Unternehmens im Ermittlungsverfahren
(1)Anhörung gem. § 444 Abs. 2 S. 2 StPO i.V.m. § 426 Abs. 1 S. 1 StPO
(2)Die „beschuldigtenähnliche Stellung“ des Unternehmens
(3)Rechte des Unternehmens
(4)Beantragung der Beteiligung
bb)Rolle und Rechte des Unternehmens nach gerichtlicher Anordnung der Beteiligung
cc)Rechtsmittel
b)Das selbstständige Verfahren
III.Einziehung gem. §§ 73 ff. StGB bei Unternehmen und Einziehungsverfahren
1.Einziehung von Vermögenswerten bei Unternehmen
2.Das Einziehungsverfahren
IV.Sanktionierung von Unternehmen in der Praxis
C.Kooperation und Koordination durch den Unternehmensverteidiger
I.Kooperation mit der Staatsanwaltschaft im Strafverfahren
1.Vor- und Nachteile einer Kooperation
2.Ausgestaltung der Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden
II.Der Unternehmensverteidiger als Koordinator
1.Das Unternehmensinteresse als Handlungsmaxime
2.Zusammenarbeit mit Individualverteidigern sowie Grenzen der Sockelverteidigung
10. KapitelKartellstraf- und Kartellbußgeldverfahren aus Sicht der Staatsanwaltschaft
I.Zur Zuständigkeit von Staatsanwaltschaft und Generalstaatsanwaltschaft in Kartellstraf- und -bußgeldverfahren
1.Kartellstrafverfahren
a)Klassische Kartellstraftaten (§§ 263, 298, 299, 331 ff. StGB)
b)Sonstige Straftaten im Zusammenhang mit wettbewerbsbeschränkenden Absprachen
aa)Untreue (§ 266 StGB)
(1)Beteiligung an Kartellordnungswidrigkeiten als Untreue?
(2)Nichtgeltendmachung von Schadensersatzansprüchen als Untreue?
(3)Übernahme von Bußgeldern bzw. Kosten der Strafverteidigung als Untreue?
bb)Steuerhinterziehung (§ 370 AO)
cc)Strafbare Falschaussage vor Gericht (§§ 153 ff. StGB)
dd)Bildung einer kriminellen Vereinigung (§ 129 StGB)
c)Ermittlungen bei Kartellstraftaten
aa)Legalitäts- und Opportunitätsprinzip
bb)Verdeckte Ermittlungen bei Kartellstraftaten
(1)Vertraulichkeitszusage bei Informanten – Zusicherung der Geheimhaltung der Identität bei Vertrauenspersonen
(2)Telekommunikationüberwachung, Innenraumüberwachung u.a. (§§ 100a ff. StPO)
d)Zuständigkeit der Staatsanwaltschaften grundsätzlich (nur) für natürliche Personen – Ausschließliche Zuständigkeit des Bundeskartellamts und der Landeskartellbehörden für Unternehmensgeldbußen gem. § 30 OWiG (§ 82 GWB)
e)Zur Abgabepflicht der Kartellbehörde gem. § 41 OWiG und zur Strafbarkeit gem. §§ 258, 258a StGB
f)Zur Diskussion um die Kriminalisierung von Hardcore-Kartellabsprachen
2.Kartellbußgeldverfahren
a)Zum Zwischenverfahren bei der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf nach Abgabe gem. § 69 OWiG und zur Abgabe an die Kartellsenate des OLG Düsseldorf
aa)Zum Übergang der Verfahrenshoheit auf die Generalstaatsanwaltschaft und zu dem Umfang ihres Prüfungsrechts und ihrer Prüfungspflicht
bb)Erörterungen und Verständigungen im Zwischenverfahren (§ 202a StPO i.V.m. § 46 Abs. 1 OWiG)
b)Zur erforderlichen Vollmacht des Verteidigers (§ 302 Abs. 2 StPO)
3.Allgemeines zur aktuellen und künftigen Zusammenarbeit zwischen Kartellbehörden und der (General-)Staatsanwaltschaft
a)Zur Situation de lege lata
b)Zur Situation nach einer Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1 zur Stärkung der Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten
II.Ausgewählte Probleme im straf- und bußgeldrechtlichen Ermittlungsverfahren
1.Zum Umgang mit „Kronzeugen“
2.Zur sog. Nichtverfolgungszusage im OWi-Verfahren
a)Zur Verfolgungsgefahr i.S.d. § 55 StPO
b)Zur rechtlichen Zulässigkeit einer Nichtverfolgungszusage
c)Zur Bindungswirkung einer Nichtverfolgungszusicherung
3.Aktenführung – Grundsätze der Aktenklarheit und Aktenwahrheit
4.Durchsuchungen im Kartellordnungswidrigkeitenverfahren
5.Beschleunigungsgrundsatz (Art. 6 Abs. 1 S. 1 EMRK und Art. 20 Abs. 3 GG)
III.Ausgewählte Probleme im Hauptverfahren
1.Zu den wesentlichen Unterschieden zwischen dem Strafprozess und dem gerichtlichen Bußgeldverfahren
2.Zur Tätigkeit von Generalstaatsanwaltschaft und Kartellbehörde in der Hauptverhandlung
a)Zur allgemeinen Zusammenarbeit zwischen Generalstaatsanwaltschaft und Kartellbehörde
b)Nachermittlungen nach Abgabe an den Kartellsenat
3.Zur Beweisaufnahme
a)Zur zunehmenden Ökonomisierung des Straf- und Bußgeldverfahrens und zur Notwendigkeit der Beiziehung ökonomischen Sachverstandes
b)Einzelaspekte der Beweisaufnahme
aa)Zur Ladung von Zeugen unter Beifügung eines Fragenkatalogs
bb)Zum Selbstleseverfahren bei Urkunden
cc)Zur Unterscheidung von Beweisantrag, Beweisermittlungsantrag und Beweisanregung
dd)Zum Sachverständigenbeweis
4.Betroffene und Nebenbetroffene in der Hauptverhandlung
5.Zur Rechtsnachfolge
6.Verständigung in der Hauptverhandlung (§ 257c StPO)
7.Bußgeldbemessung
a)Allgemeines zur Festsetzung der Bußgelder durch die Kartellsenate
b)Zu den abweichenden Maßstäben für die Bemessung des Bußgeldes
c)Zur reformatio in peius
d)Zur Verzinsungspflicht des § 81 Abs. 6 GWB
e)Zum Verhältnis von § 81 Abs. 4 S. 2 GWB zu § 17 Abs. 4 OWiG (Abschöpfung des wirtschaftlichen Vorteils über die 10 %-Grenze hinaus)
f)Zur Darstellung der Bußgeldbemessung in den Urteilsgründen
8.Zur Urteilsabsetzungsfrist des § 275 Abs. 1 StPO
9.Anordnung eines Vermögensarrestes zur Sicherung der Geldbuße
11. KapitelKooperation und Absprachen im Bußgeldverfahren: Kronzeugenantrag, Leniency Procedure und „Settlements“
A.Allgemeine Erläuterungen
I.Einleitung
II.Abgrenzung zwischen Kronzeugen- und Verständigungsverfahren
B.Kooperation im Bußgeldverfahren (Kronzeugenregelung)
I.Überblick und historische Entwicklung
II.Kronzeugenprogramm auf europäischer Ebene
1.Rechtliche Grundlagen
2.Voraussetzungen für den Erlass oder Ermäßigung der Geldbuße
a)Erlass der Geldbuße
b)Ermäßigung der Geldbuße
3.Verfahren (Kronzeugenantrag, Leniency Procedure)
a)Verfahren für den vollständigen Erlass der Geldbuße
b)Verfahren für eine Ermäßigung der Geldbuße
4.Praktische Erwägungen/Zielkonflikte
a)Parallele Antragstellung bei allen in Betracht kommenden Kartellbehörden
b)Auswirkungen auf zivilrechtliche Kartellschadensersatzprozesse
III.Kronzeugenprogramm in Deutschland
1.Rechtliche Grundlagen
2.Voraussetzungen für den Erlass oder Reduktion der Geldbuße
a)Erlass der Geldbuße
b)Reduktion der Geldbuße
3.Verfahren (Bonusantrag, Leniency Procedure)
4.Praktische Erwägungen/Zielkonflikte
IV.Kritische Würdigung von Kronzeugenprogrammen
C.Absprachen im Bußgeldverfahren („Settlement“-Verfahren)
I.Überblick und historische Entwicklung
II.Vergleichsverfahren (Settlements) auf europäischer Ebene
1.Rechtliche Grundlagen
2.Mitteilung der Kommission über die Durchführung von Vergleichsverfahren
a)Voraussetzungen für ein Settlement
b)Ablauf des Settlementverfahrens
c)Hybride Vergleichsverfahren
d)Rechtsmittel gegen Vergleichsbeschlüsse
III.Einvernehmliche Verfahrensbeendigung (Settlements) in Deutschland
1.Rechtliche Grundlagen
2.Merkblatt des Bundeskartellamts zu Settlements im Bußgeldverfahren
a)Voraussetzungen für ein Settlement
b)Ablauf des Settlementverfahrens
c)Rechtsmittel gegen Kurzbußgeldbescheid
IV.Kritische Würdigung von Settlementverfahren
12. KapitelAmtshilfe und Informationsaustausch in Kartellverfahren
I.Einleitung und Überblick
II.Zusammenarbeit der Kartellbehörden auf nationaler Ebene
III.Zusammenarbeit der Kartellbehörden im ECN
1.Historische Entwicklung des ECN
2.Rechtsgrundlagen und Grundsätze für die Zusammenarbeit im ECN
3.Formen der Zusammenarbeit
a)Koordinierung von Verwaltungs- und Bußgeldverfahren
aa)Fallverteilung bzw. –umverteilung zu Beginn von Verfahren
bb)Sicherung der kohärenten Rechtsanwendung in laufenden Verfahren
cc)Informelle Maßnahmen zur Koordinierung von Verfahren
b)Zusammenarbeit bei Ermittlungsmaßnahmen
c)Austausch von Beweismitteln und anderen Informationen
aa)Ermächtigungsgrundlage für den Informationsaustausch
bb)Beschränkungen für die Verwendung der Informationen
d)Gemeinsame Grundsatzarbeit und Ausarbeitung von Empfehlungen
4.Ausblick: Anpassungsbedarf im GWB durch die RL (EU) 2019/1
a)Hintergrund und Bedeutung der Richtlinie
b)Allgemeine Grundsätze der Zusammenarbeit
c)Zusammenarbeit bei Ermittlungsmaßnahmen
d)Zustellung von vorläufigen Beschwerdepunkten und anderen Unterlagen
e)Vollstreckung von Entscheidungen zur Verhängung von Geldbußen oder Zwangsgeldern
IV.Zusammenarbeit mit Wettbewerbsbehörden aus Drittstaaten
1.Austausch von Informationen zu konkreten Sachverhalten
a)Möglichkeiten zur Übermittlung von Informationen
b)Empfang von Informationen und Verwendungsbeschränkungen
2.Rolle und Bedeutung des International Competition Network
V.Zusammenarbeit mit nicht-kartellrechtlichen Behörden
1.Kartellverfolgung in Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden
2.Zusammenarbeit mit Regulierungs-, Datenschutz- und Verbraucherschutzbehörden
3.Zusammenarbeit mit sonstigen Behörden
VI.Einfluss der Zusammenarbeit auf die kartellrechtliche Compliance
1.Berücksichtigung im Rahmen der vorsorglichen Compliance
2.Koordinierung von (multinationalen) Verwaltungs- und Bußgeldverfahren
3.Rechtsschutz gegen die Zusammenarbeit von Kartellbehörden
13. KapitelRechtshilfe in Strafsachen
A.Einleitung
B.Hintergründe und Dogmatik
C.Rechtsquellenlehre
I.Normativer Rahmen
II.Anwendbares Recht bei vertragsloser Rechtshilfe
III.Anwendbares Recht bei vertraglicher Rechtshilfe
1.Ermittlung der einschlägigen Rechtsquellen
2.Normenkollisionen
a)Kollision auf völkerrechtlicher Ebene
b)Kollision zwischen Völkerrecht und nationalem Recht
c)Kollision zwischen Völkerrecht und Unionsrecht
IV.Anwendungsbeispiele
1.Allgemeine Rechtsgrundlagenfindung bei eingehendem Rechtshilfeersuchen
a)Ist der ersuchende Staat EU-Mitgliedstaat?
b)Existiert ein völkerrechtlicher Rechtshilfevertrag?
aa)Ist der ersuchende Staat Mitglied des Europarats oder ist er dessen Rechtshilfeübereinkommen beigetreten ohne Europaratsmitglied zu sein?
bb)Existieren sonstige im konkreten Rechtshilfeverhältnis anwendbare völkerrechtliche Verträge?
c)Welche Vorgaben macht das nationale Recht?
2.Auslieferungsrecht Deutschland–USA
a)Auslieferungsvertrag Deutschland–USA von 1978
b)Erster Zusatzvertrag von 1986 zum Auslieferungsvertrag Deutschland–USA
c)Auslieferungsabkommen EU–USA von 2003 und Zweiter Zusatzvertrag von 2006 zum Auslieferungsvertrag Deutschland–USA
D.Allgemeine Grundsätze des Rechtshilferechts
I.Grundsatz der Gegenseitigkeit
II.Grundsatz der Spezialität
III.Grundsatz der beiderseitigen Strafbarkeit
IV.Grundsatz der Nichtauslieferung eigener Staatsangehöriger
E.Auslieferung von Unionsbürgern an Drittstaaten
I.Allgemeines/Relevanz
II.Die Rechtssache Pisciotti
1.Sachverhalt
2.Die Rechtssache Petruhhin
3.EuGH-Entscheidung in der Rechtssache Pisciotti
III.Implikationen für die Auslieferung von Unionsbürgern an Drittstaaten
1.Verfahrensgrundsätze nach Petruhhin/Pisciotti
2.Europäischer Haftbefehl
IV.Offene Fragen
1.Umfang der Unterrichtung des Heimatstaates
2.Zeitpunkt der Unterrichtung des Heimatstaats
3.Disponibilität der Verfahrensgrundsätze
V.Kritik
VI.Bedeutung für die Beratung/Verteidigung
14. KapitelBußgelder bei Verstößen gegen Kartellrecht (D/EU)
I.Unternehmensgeldbuße nach europäischem Recht
1.Ermächtigungsgrundlage
2.Bußgeldadressat
a)Konzernhaftung
b)Haftung bei Rechtsnachfolge
3.Verschulden
4.Bußgeldrahmen
5.Bußgeldbemessung
a)Festlegung des Grundbetrages
b)Anpassung des Grundbetrages
c)Ermessen der Kommission
6.Bußgelderlass oder -ermäßigung durch Kronzeugenregelung
a)Vollständiger Erlass der Geldbuße
b)Reduktion der Geldbuße
c)Risiko einer Bußgelderhöhung durch Offenlegung von Informationen
d)Konzernsachverhalte
7.Bußgeldabschlag durch Settlement-Verfahren
8.Rechtsmittel
II.Unternehmensgeldbuße nach deutschem Recht
1.Ermächtigungsgrundlage
2.Bußgeldadressat
a)Die am Verstoß unmittelbar beteiligte Unternehmenseinheit
b)Konzernhaftung
c)Nachfolgehaftung
aa)Ausgangssituation bis zur 9. GWB-Novelle
bb)Ausdehnung der Rechtsnachfolgehaftung
cc)Haftung bei wirtschaftlicher Nachfolge
d)Ausfallhaftung
e)Gesamtschuldnerische Haftung
3.Verschulden
4.Bußgeldrahmen
5.Gesetzliche Bußgeldbemessungskriterien
6.Bußgeldbemessung durch das Bundeskartellamt
a)Bußgeldbemessung nach den Bußgeldleitlinien des Bundeskartellamts
aa)Bestimmung des Bemessungsspielraums
bb)Festsetzung der Geldbuße innerhalb des Bemessungsspielraums
b)Bußgelderlass oder -ermäßigung durch Kronzeugenregelung
aa)Vollständiger Erlass der Geldbuße
bb)Reduktion der Geldbuße
cc)Kooperationspflichten
c)Bußgeldabschlag durch Settlement-Verfahren
d)Abschöpfungsanteil der Geldbuße
7.Rechtsmittel
a)Möglichkeit der reformatio in peius und Bußgeldrahmen
b)Bußgeldbemessungskriterien nach der Rechtsprechung
III.Geldbußen gegen natürliche Personen
IV.Berücksichtigung von Compliance-Systemen bei der Bußgeldbemessung
V.Steuerliche Behandlung von Geldbußen
VI.Verzinsung von Geldbußen
1.Kartellbußen nach EU-Recht
2.Kartellbußen nach deutschem Recht
VII.Verfolgungsverjährung
15. Kapitel(Kartell-)Schadensersatzklagen
I.Einleitung
II.Voraussetzungen kartellrechtlicher Schadensersatzansprüche
1.Anspruchsgrundlagen
2.Kartellverstoß und Bindungswirkung
3.Anspruchsberechtigung, Kartellbetroffenheit und Kartellbefangenheit
4.Passivlegitimation und Gesamtschuld
5.Verschulden
6.Schaden
7.Schadensabwälzung
8.Zinsen
9.Verjährung
10.Gesamtschuldnerinnenausgleich
III.Offenlegung von Informationen
1.Offenlegungsansprüche
2.Weitere Möglichkeiten der Informationsbeschaffung
IV.Durchsetzung kartellrechtlicher Schadensersatzansprüche
1.Außergerichtliche Geltendmachung
2.Zuständigkeit der Gerichte
3.Klagearten
4.Kosten und Verfahrensdauer
5.Gebündelte Geltendmachung von Ansprüchen
6.Schiedsverfahren
V.Pflichten im Zusammenhang mit der Geltendmachung von Kartellschadensersatzansprüchen
1.Business Judgement Rule
2.Besonderheiten bei öffentlichen Unternehmen
3.Angemessene Entscheidungsgrundlage
a)Maßstab für die Informationsgrundlage
b)Aktive Suche nach Ansprüchen?
c)Prüfung der Grundlagen und Erfolgsaussichten
4.Entscheidung über die Geltendmachung von Ansprüchen
a)Außergerichtliche Geltendmachung
b)Gerichtliche Durchsetzung
c)Vergleich
5.Organisationspflichten
a)Pflichtendelegation und Organisationspflichten
b)Dokumentationspflichten
VI.Gesellschaftsrechtliche Pflichten bei der Abwehr von Ansprüchen
1.Abwehr von Ansprüchen
2.Gesamtschuldnerausgleich
3.Vergleich
16. KapitelRegressansprüche der Gesellschaft und D&O-Versicherungen
A.Regressansprüche der Gesellschaft
I.Anspruchsgrundlagen der Innenhaftung
II.Pflichtverletzung
1.Sorgfaltspflicht und Legalitätspflicht
2.Organisations- und Überwachungspflicht
a)Überwachung nachgeordneter Mitarbeiter
b)Organinterne Überwachungspflicht
III.Kausaler Schaden
1.Schadensermittlung nach der Differenzhypothese
2.Kartellbußgeld gegen die Gesellschaft
a)Für den Bußgeldregress in voller Höhe
b)Gegen den Bußgeldregress
c)Für einen begrenzten Bußgeldregress
3.Sonstige Schadenspositionen
4.Vorteilsausgleichung
IV.Verschulden
V.Beweislast
VI.Verjährung
VII.Verzicht und Vergleich
1.Bei der GmbH
2.Bei der AG
VIII.Gesamtschuldnerische Haftung von Organvertretern
1.Haftung mehrerer Organvertreter
2.Innenausgleich und Sicherung von Regressansprüchen
B.Absicherung von Regressansprüchen durch D&O-Versicherungen
I.Gegenstand und Struktur der D&O-Versicherung
1.Rechtlicher Rahmen
2.Beteiligte einer D&O-Versicherung
3.Sachlicher Umfang des Versicherungsschutzes
a)Vermögensschäden eines Dritten
b)Abwehr- und Deckungshilfe
c)Die Versicherungssumme
d)Allgemeine und besondere Versicherungsbedingungen
4.Ausschlüsse
a)Vorsatz und Wissentlichkeit
b)Sonderfall: Nur ein Versicherter handelte wissentlich
c)Bußgelder und Vertragsstrafen
d)Darlegungs- und Beweislast für Ausschlüsse
5.Zeitlicher Umfang des Versicherungsschutzes
a)Der Versicherungsfall (Claims Made-Prinzip)
b)Rückwärtsdeckung
c)Nachhaftung
d)Umstandsmeldung
II.Obliegenheiten
1.Vorvertragliche Anzeigeobliegenheiten
2.Gefahrerhöhung während der Vertragslaufzeit
3.Obliegenheiten im Versicherungsfall
4.Folgen von Obliegenheitsverletzungen
III.Abschluss der D&O-Versicherung
1.Vertragsschluss
2.Selbstbehalt
3.Firmenpolice vs. Einzelpolice
IV.Abläufe im Versicherungsfall
1.Erste Maßnahmen
2.Haftungs- und Deckungsprozess
3.Vergleich
4.Abtretung des Freistellungsanspruchs an die Gesellschaft
a)Die Abtretung des Freistellungsanspruchs
b)Folgen einer Abtretung des Freistellungsanspruchs
3. TeilKrisenreaktion in der Unternehmenspraxis
17. KapitelDawn Raids: Ablauf und Verhalten bei kartellbehördlichen Durchsuchungen
I.Überblick
II.Durchsuchungen durch die Kommission
1.Ermächtigungsgrundlage
2.Vorgehen der Kommission und Mitwirkungspflicht des Unternehmens
3.Typische Nachprüfungsmaßnahmen während der Durchsuchung
a)Physische Dokumentensuche
b)IT-Suche
c)Befragung von Mitarbeitern
4.Grenzen der Ermittlungsbefugnisse
III.Durchsuchungen durch das Bundeskartellamt
1.Ermächtigungsgrundlage
2.Vorgehen des Bundeskartellamts und Duldungspflicht des Unternehmens
3.Typische Ermittlungsmaßnahmen während der Durchsuchung
a)Physische Dokumentensuche
b)IT-Suche
c)Befragungen von Mitarbeitern
4.Grenzen der Ermittlungsbefugnisse
IV.Verhaltensregeln für die Durchsuchungssituation
1.Allgemeine Verhaltensregeln
2.Beginn der Durchsuchung
a)Empfangspersonal
b)Führungsteam
3.Während der Durchsuchung
a)Dokumentensuche
b)IT-Suche
c)Mitarbeiterbefragungen
4.Ende der Durchsuchung
5.Nachbereitung
V.Vorsorgemaßnahmen
18. KapitelInterne Untersuchungen in der Krise
A.Die interne Untersuchung in der Krise
I.Anlass, Inhalt und Ziel interner Untersuchungen
II.Diskussion einer gesetzlichen Regelung
III.Umfang der internen Untersuchung und Business Judgement Rule
IV.Organisation der internen Untersuchung und erste Schritte im Krisenfall
V.Informationspflichten
B.Anlässe für interne Untersuchungen im kartellrechtlichen Kontext
I.Repressive interne Untersuchungen
II.Interne Untersuchungen wegen eines Hinweisgebers
III.Exkurs: Präventive interne Untersuchungen
C.Rechtlicher Rahmen und Governance interner Untersuchungen
I.Untersuchungspflicht und Pflicht zur Einrichtung eines wirksamen Compliance Management Systems
II.Governance der Untersuchung
1.Mandatierung und Berichtslinien
2.Untersuchungsgegenstand und -umfang
3.Legal Privilege bzw. Verteidigerkommunikation
4.Überarbeitung des Compliance Management Systems
D.Die Informationssammlung als Kern der internen Untersuchung
I.Grundsätze zur Informationssammlung
1.Strategie und Untersuchungsplan
2.Hold Notices und Datensicherung
3.Kulturelle Besonderheiten
4.Organisation und Projektmanagement
5.Blocking Statutes und Staatsgeheimnisse
II.Datensammlung
III.Datendurchsicht/Review
IV.Befragungen von Mitarbeitern
1.Rechtlicher Rahmen, Belehrung und weitere Besonderheiten
2.Befragungsstrategie
3.Logistik der Befragung und Teilnehmer
4.Inhaltliche Vorbereitung und Ablauf der Befragung
5.Dokumentation des Befragungsinhalts
6.Kooperationsanreize
E.Verwendung und Verwertung von Informationen aus der internen Untersuchung
I.Untersuchungsbericht
II.Kronzeugenantrag
III.Nachteile und Risiken einer Kooperation
19. KapitelAmnestieprogramme und Haftungsfreistellungen in der Krise
A.Allgemeine Erläuterungen
I.Einleitung
B.Umfang und Inhalt von Amnestieprogrammen
I.Grundsätzliche Ausgestaltung von Amnestieprogrammen
II.Bestandteile eines Amnestieprogramms
1.Verzicht auf arbeitsrechtliche Maßnahmen
2.Verzicht auf die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen
3.Verzicht auf Erstattung von Strafanzeige
4.Übernahme von Verteidiger-/Rechtsanwaltskosten
5.Freistellung von Schadensersatzansprüchen Dritter
6.Freistellung von Bußgeldern und sonstigen Sanktionen
C.Rechtliche und Praktische Erwägungen
I.Vergaberechtliche Grenzen von Amnestieprogrammen
II.Praktische Umsetzung von Amnestieprogrammen
D.Fazit
20. KapitelKooperationsreichweite im Unternehmen
I.Die Reichweite kartellrechtlicher Compliance
II.Das Unternehmen im kartellrechtlichen Sinne
1.100 %-Gesellschaften
2.Mehrheitsgesellschaften
3.Paritätische Gemeinschaftsunternehmen (50/50 Joint Venture)
4.Minderheitsbeteiligungen
a)Stufe 1 – (Gemeinsame) Kontrolle bzw. die Möglichkeit zu bestimmendem Einfluss
b)Stufe 2 – Die Ausübung bestimmenden Einflusses
aa)Gesellschaftsvertragliche Rechte
bb)Personelle Verflechtungen
cc)Kommerzieller Einfluss auf die Tochter
5.Widerlegung der Zurechnung
6.Dritte
a)Handelsvertreter
b)Dienstleister
7.Der Begriff des „verbundenen Unternehmens“ im deutschen Kartellrecht
8.Bewertung und Zwischenergebnis
III.Umsetzung im Unternehmen
1.Risikoanalyse des Beteiligungsportfolios
2.Abwägungsentscheidung und Auswirkungen auf das CMS
IV.Ergebnis
21. KapitelPublikationspflichten in der Krise
I.Einleitung
II.Kapitalmarktrechtliche Ad-hoc-Publizitätspflicht nach Art. 17 MAR
1.Einordnung und Hintergrund
2.Adressatenkreis
3.Vorliegen einer Insiderinformation
a)Präzise Information
b)Nicht öffentlich bekannt
c)Kurserheblichkeit
d)Umstände mit Emittentenbezug
4.Unmittelbare Betroffenheit des Emittenten
5.Kenntnis des meldepflichtigen Emittenten
6.Ausnahme und Möglichkeit zur zeitweisen Selbstbefreiung
a)Ausnahme von der unverzüglichen Bekanntgabe als Grundregel
b)Zeitweiser Aufschub nach Art. 17 Abs. 4 MAR
aa)Berechtigtes Emittenteninteresse
bb)Keine Irreführung der Öffentlichkeit
cc)Sicherstellung der Geheimhaltung
dd)Entscheidung über den Veröffentlichungsaufschub
7.Häufige Anknüpfungspunkte im Rahmen kartellrechtlicher Krisen
a)Interne Information über mögliche Kartellrechtsverstöße
b)Absehen von einem Leniency-Antrag
c)Stellung eines Leniency-Antrags
d)Behördliche Durchsuchungen
e)Weitere Maßnahmen im Rahmen laufender kartellrechtlicher Verfahren
f)Veröffentlichungen der Kommission bzw. des Bundeskartellamts
g)Mitteilung eines anderen Kartellanten
h)Verhandlungen mit den Wettbewerbsbehörden
i)Zivilrechtliche Follow-on-Schadensersatzforderungen
j)Reputationsschäden
III.Prospekttransparenzpflichten nach dem WpPG
1.Bestehen und Umfang einer Prospektpflicht
2.Häufige Anknüpfungspunkte im Rahmen kartellrechtlicher Krisen
IV.Transparenzpflichten nach Rechnungslegungsvorschriften
1.





























