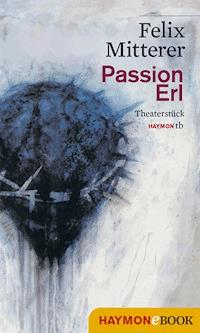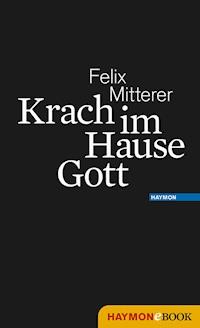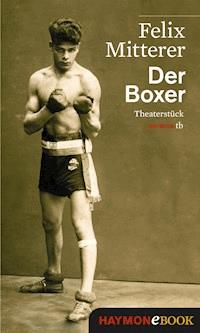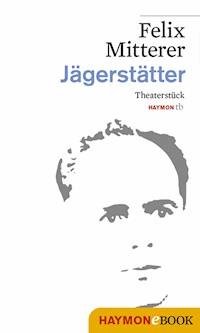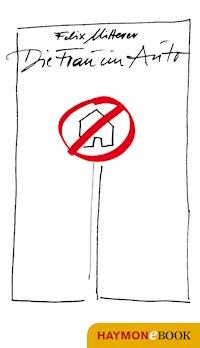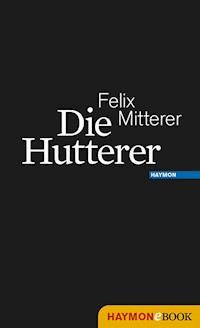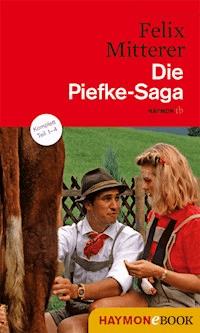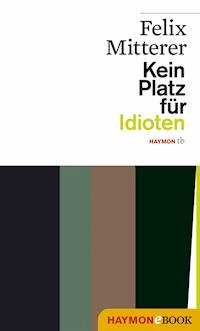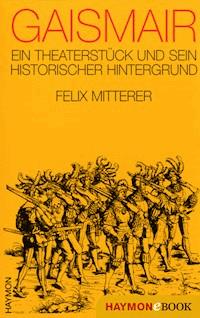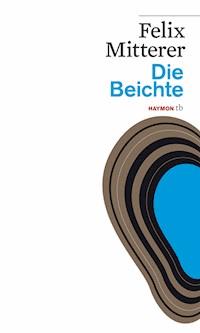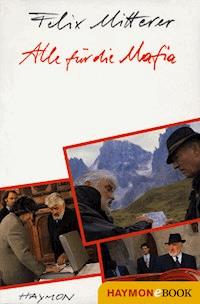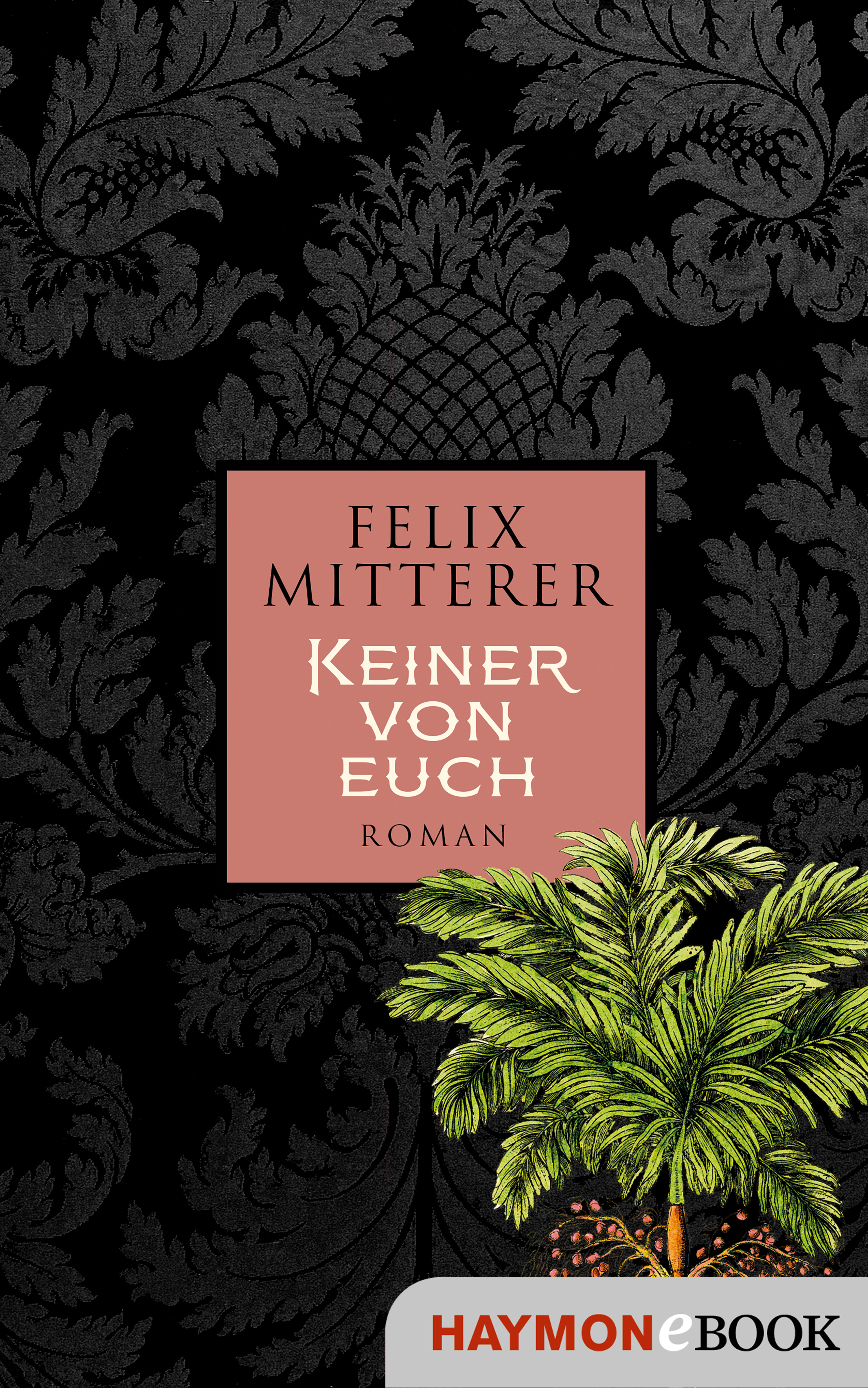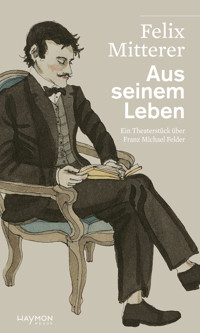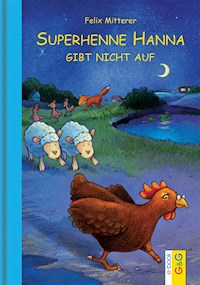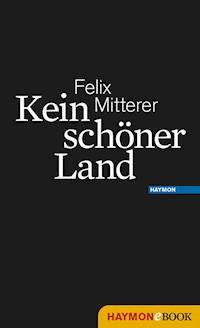
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Aus dem Sammelband "Stücke 1" von Felix Mitterer: Der erste Band von Mitterers "Gesammelten Stücken" befasst sich mit Heimatgeschichte. Das Stück "Kein schöner Land" handelt vom Eindringen des Faschismus in die ländliche Gemeinschaft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 97
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Felix Mitterer
Kein schöner Land
Die Herausgabe der Werksammlung wurde vom Land Tirol, dem Bundesministerium für Unterricht und Kunst und von der Gemeinde Telfs gefördert.
© 1992
HAYMON verlag
Innsbruck-Wien
www.haymonverlag.at
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Aufführungsrechte für alle Stücke beim Österreichischen Bühnenverlag Kaiser & Co., Am Gestade 5/II, A-1010 Wien
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-7099-7630-2
Umschlaggestaltung:
hœretzeder grafische gestaltung, Scheffau/Tirol
Dieses Stück wurde dem Sammelband »Stücke 1«, erschienen 1992 im Haymon Verlag, entnommen. Den Sammelband »Stücke 1« erhalten Sie auch in gedruckter Form mit hochwertiger Ausstattung in Ihrer Buchhandlung oder direkt unter www.haymonverlag.at.
INHALT
Vorbemerkung von Felix Mitterer
Kein schöner Land
VORBEMERKUNG zu »Stücke 1«
Alle Stücke in dieser Gesamtausgabe sind in der Originalfassung abgedruckt, das heißt, in stilisierter Tiroler Umgangssprache, ausgenommen drei, bei denen ich aus bestimmten Gründen die Hochsprache gewählt habe. Dies sind »Die Kinder des Teufels« (spielt im Salzburg des 18. Jahrhunderts, soll aber auf exemplarische Weise einen Hexenprozeß darstellen), »Sibirien« (kann überall auf der Welt spielen) und »Ein Jedermann« (spielt in der Hochfinanz). Ich erwähne dies deshalb, weil es von den meisten meiner Stücke auch weitgehend an die Hochsprache angenäherte Fassungen gibt. Diese schrieb ich, weil auch immer wieder Theater an Aufführungen interessiert sind, deren Ensemblemitglieder aus allen Ecken und Enden des deutschsprachigen Raumes kommen und deshalb die Stücke nicht in einer einigermaßen einheitlichen Umgangssprache spielen können.
Die Art und Weise, wie ich den Dialekt niedergeschrieben habe, war nicht immer gleich, die Unterschiede sind in dieser Ausgabe beibehalten. Hauptsächlich variiert die Sprache je nach dem beschriebenen Milieu (archaisch etwa in »Die Wilde Frau«, heutig in »Besuchszeit«) oder je nach den auftretenden Personen (Herkunft, Beruf, Stand) und wird bei Aufführungen von Schauspielern aus unterschiedlichen Gegenden ohnehin wieder unterschiedlich gesprochen. In zwei Fällen (»Abstellgleis« in »Besuchszeit« und »Kein schöner Land«) gab es bei der späteren hochsprachigen Fassung auch kleine inhaltliche Veränderungen, die ich jetzt bei der endgültigen Publizierung der Gesamtausgabe beibehalten wollte. Hier sind die entsprechenden Passagen in den Dialekt zurückübertragen. In jedem Fall habe ich auf gute Lesbarkeit geachtet, was mir bei Theaterstücken — im Gegensatz zu Dialektgedichten — wichtig scheint.
Jedem der zwölf Stücke habe ich eine Vorbemerkung vorangestellt, die von der jeweiligen Entstehungsgeschichte und meinen Intentionen erzählt. Mein Wunsch war es aber vor allem, zu jedem Stück Szenenfotos von verschiedenen Aufführungen hinzuzufügen. Dies deshalb, weil Literatur fürs Theater erst auf der Bühne ihre Breitenwirkung entfalten kann, und das soll hier zumindest dokumentiert werden. Außerdem geht es mir darum, die Arbeit der Theatermacher zu würdigen, diejenigen zu zeigen, die ein Stück erst wirklich zum Leben erwecken. Auch ist es interessant zu sehen, wie verschieden ein Stück inszeniert werden kann. Die Auswahl der Aufführungsfotos erfolgte (abgesehen von der meist ausführlicher vorgestellten Uraufführung) mehr oder weniger zufällig, manchmal waren auch keine Bilder zu bekommen oder nur nichtssagende. Wichtig war mir, einen großen Querschnitt durch die verschiedenen Theater zu zeigen, die meine Stücke spielen, eingeschlossen Aufführungen von Laienbühnen, denen ich besonders zugetan bin.
Innsbruck, am 1. November 1992
Felix Mitterer
KEIN SCHÖNER LAND
Als ich 1980 für die Fernsehserie »Die 5. Jahreszeit« recherchierte, stieß ich im Gemeindeblatt von St. Anton auf einen Artikel von Ing. Hans Thöni, der das Schicksal des Rudolf Gomperz behandelte. Gomperz war jüdischer Abstammung, geboren 1878 in Wien, und er liebte die Berge über alles. 1904 arbeitete er als Ingenieur beim Bau der Bagdadbahn, holte sich dabei die Malaria und kam 1905 nach St. Anton, um dort in der frischen Gebirgsluft sein Leiden auszukurieren. Der Ort gefiel im derart gut, daß er sich hier ansiedelte und in den Folgejahren maßgeblich am Aufbau des Fremdenverkehrs mitwirkte. Er heiratete eine — arische — Frau aus Bayern, die Söhne Hans und Rudolf wuchsen in den 30er Jahren auf und entwickelten sich zu begeisterten Nazis. 1938, nach dem Anschluß, wurde Rudolf Gomperz aller Ämter enthoben und so behandelt, wie man eben Juden damals behandelte. Fast alle Bewohner von St. Anton, die ihm doch alles zu verdanken hatten, wandten sich nun von Gomperz ab. Um die Söhne zu retten, gab Frau Gomperz an, sie seien einem ehebrecherischen Verhältnis mit einem Arier entsprungen. Das wurde nach einigen Querelen akzeptiert, die Söhne durften begeisterte Nazis bleiben, Hans fiel als Soldat der deutschen Wehrmacht, Rudolf trat in die SS ein und erschoß sich nach dem Krieg. Rudolf Gomperz mußte am 20. Jänner 1942 St. Anton verlassen und nach Wien reisen. Es war der Tag der Wannseekonferenz in Berlin, wo die »Endlösung der Judenfrage« beschlossen wurde. Gomperz verschwand in irgendeinem Konzentrationslager im Osten und tauchte nie mehr auf.
Das traurige Schicksal dieses Mannes berührte mich so sehr, daß ich beschloß, eines Tages darüber zu schreiben. 1986 fragten mich Peter Mitterrutzner und Erich Innerebner, ob ich nicht ein Stück für eine geplante Coproduktion des Südtiroler Ensembletheaters mit dem Tiroler Landestheater schreiben wolle. Da es in Tirol nie eine Auseinandersetzung mit der NS-Zeit gegeben hatte, schlug ich dieses Thema vor und machte mich an die Arbeit.
»Kein schöner Land« ist nun aber kein Dokumentarstück geworden, denn das Theater eignet sich schlecht fürs Dokumentarische. Vor allem ist dies dann der Fall, wenn ein Ereignis erst relativ kurze Zeit zurückliegt und es noch lebende Beteiligte gibt, auf die man aus persönlichen und juristischen Gründen Rücksicht nehmen muß. So ist der Fall Gomperz zwar Anlaß und Vorbild für das Stück, aber Personen, Namen, Berufe und zum Teil auch Ereignisse sind anders dargestellt. Ich habe auch mit Zeitzeugen gesprochen und Gerichtsprotokolle aus der Kriegs- und Nachkriegszeit studiert und in der Folge noch zwei Hauptpersonen eingeführt, die auch von den Nazis ermordet wurden: einen Geistlichen, einen geistig Behinderten. So ist dies eine Geschichte über Opportunismus, Feigheit, Mitläufertum, Eigennutz und politische Verblendung geworden. Die Opfer sind »die Anderen«. Und diese »Anderen« — die Außenseiter, die Ausgestoßenen — sind ein durchgehendes Thema meiner literarischen Arbeit. Ein großer Teil der Menschen hat ständig Angst vor »den Anderen«, hegt ständig Aggressionen gegen sie, ganz gleich, auf welche Art sie anders sind (und es beginnt ganz harmlos): andere Frisur, andere Kleidung, anderes Gehabe, andere Neigungen, andere Ansichten, andere Sprache, andere Hautfarbe, andere Religion, andere Sitten und Gebräuche. Und so geschieht selbst das Absurdeste, daß nämlich im Umkehrschluß ein bisher beliebter, geachteter- und verdienter Mitbürger plötzlich zum Schurken und Volksschädling gestempelt und zuletzt ermordet wird, weil sich herausstellt, daß er Jude ist.
PERSONEN:
Stefan Adler (55), Viehhändler
Maria (45), seine Frau
Hans (25), beider Sohn
Anna (20), Tochter
Rudolf Holzknecht (50), Wirt und Bürgermeister
Olga (45), seine Frau
Erich (20), beider Sohn
Sepp Hopfgartner (50), Oberlehrer und Ortsgruppenleiter
Toni (18), sein Sohn
Franz Gruber (60), Pfarrer
Rosa (70), seine Schwester und Häuserin
Gendarmeriepostenkommandant
Landrat (40), Deutscher
1. Kripobeamter (später Gestapo)
2. Kripobeamter (später Gestapo)
1. Heimwehrmann
2. Heimwehrmann
1. Hitlerjunge
2. Hitlerjunge
SS-Arzt, SS-Hauptsturmführer (beide stumm)
ZEIT: 1933-1945
ORT: Ein Dorf in den Tiroler Bergen
BÜHNE:
Das Dorf. Links das Haus des Viehhändlers Stefan Adler (sichtbar nur Wohnstube), rechts das Gasthaus des Bürgermeisters (sichtbar nur die Gaststube), dazwischen Dorfplatz und ansteigende Gasse. Ein hohes Wegkreuz. Dahinter die Berge. Es ist immer Nacht bzw. Abend- oder Morgendämmerung.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!