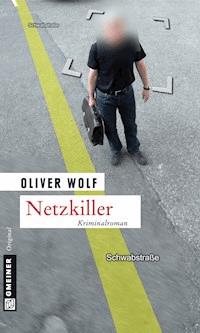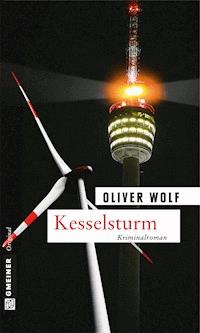
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kriminalbeamte Bürkle und Ronda
- Sprache: Deutsch
Nicht genug, dass die neue Landesregierung den Bau von Windkraftanlagen in und um Stuttgart in Auftrag gibt und damit in der Bevölkerung für Unruhe sorgt. Nun halten auch noch brutale Morde die Stadt in Atem. Alles deutet auf einen Serienmörder hin. Die Ermittler Antonia Ronda und André Bürkle heften sich an die Fersen des Täters. Eine tödliche Hetzjagd beginnt …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Oliver Wolf
Kesselsturm
Kriminalroman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2013 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung und E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © pp77 – Fotolia.com
und © fotofuerst – Fotolia.com
ISBN 978-3-8392-4204-9
Prolog
Ronda schaltete den Hauptstromschalter für ihre Wohnung aus und öffnete die Wohnungstür. Eine metallisch klingende Frauenstimme ertönte, die langsam von drei rückwärts zählte. Bei eins schloss Ronda die Tür. Mit einem leisen Zischen versiegelten winzige Airbags im Türrahmen die Wohnung gegen die Kälte, die eisig durch das Treppenhaus kroch.
Als sie aus dem Haus trat, spürte sie einen trockenen, kalten Luftzug in ihrem Gesicht. Ein rhythmisches Rauschen vermischte sich mit dem leisen Surren der vorbeifahrenden Fahrzeuge. Hoch aufragende Windräder, die überall an den Hängen der ehemaligen Weinberge standen, erzeugten dieses sanfte Rauschen, das in der Stadt allgegenwärtig war. Denn seit die neueste Energiebeteiligungsverordnung erlassen war, wuchsen nicht nur die großen Windräder wie Pilze aus dem Boden, auch die Innenstadt wurde dominiert von kleineren Windrädern, Windturbinen, die den Düseneffekt der engen Gassen zur Energiegewinnung ausnutzten, sowie von Solarpaneelen an Stellen, wo früher Leuchtreklamen Passanten entgegen geschrien hatten.
Ronda ging die wenigen Meter von ihrer Wohnung zur Filiale einer Genossenschaftsbank, bei der sie Kundin war. Sie wollte dringend Guthaben auf ihre Einkaufskarte laden, nur leider war der Automat offensichtlich außer Betrieb, denn er spuckte ihre Karte jedes Mal unverrichteter Dinge wieder aus.
Vor der Bank überschlug Ronda, wie viel sie noch auf der Karte hatte.
Für einen kleinen Einkauf im Supermarkt sollte es genügen, entschied sie kurzerhand. Sie aktivierte ihren Schrittzähler, den sie immer am Gürtel trug, verband ihn per Bluetooth mit ihrem Smartphone und ging los.
Es war ein guter Kilometer bis zum Supermarkt; das allein sollte ihr schon die Milch fürs Frühstück einbringen. Seit nämlich Ökologiepunkte für Lebensmittel vergeben wurden, waren Entfernungen, die zu Fuß statt mit dem Auto zurückgelegt wurden, so wertvoll wie bares Geld.
Ronda betrat den Supermarkt.
Neben verschiedenen Fertigprodukten kaufte sie Tiefkühlkost für die schnelle Küche, für die sie Bürkle mit Sicherheit verfluchen würde. Bei all ihren Einkäufen achtete sie jedoch peinlichst darauf, woher die Waren kamen. So waren nämlich Erzeugnisse aus dem Ausland – und handelte es sich lediglich um europäische Mitgliedsstaaten – um ein Vielfaches teurer als inländische Produkte; wurden doch seit einiger Zeit aufgrund der höheren CO2-Bilanz mehr Abgaben verlangt. So war eine Meeresfrüchtepaella aufgrund der hohen CO2-Bilanz zur Beschaffung von Fisch, Muscheln und anderen Meereslebewesen im Stuttgarter Raum weitaus teurer als ein einheimischer Sauerbraten oder die Fertigcurrywurst für die Mikrowelle. Auch wurde beinahe nur noch Milch von einheimischen Bauern verkauft, da Milch aus Polen oder anderen osteuropäischen Ländern im Preisniveau Beluga-Kaviar glich.
Ronda legte ihre Waren auf das Fließband an der Kasse und reichte der Kassiererin ihre Bankkarte, die diese durch das Lesegerät zog.
»Reicht nicht«, sagte die Kassiererin knapp.
»Was reicht nicht?«, fragte Ronda entgeistert.
»Ihr Guthaben«, erwiderte die grauhaarige Angestellte.
»Wie viel ist denn drauf?«, fragte Ronda. Sie meinte, die bohrenden Blicke der Menschen in der Schlange hinter ihr zu spüren.
»Drauf ist schon was, aber Sie haben eine Sperre«, erwiderte die Frau.
Ronda brach der Schweiß aus. »Eine Sperre?«, fauchte sie. »Was soll das? Auf der Karte ist Geld; das weiß ich ganz genau.« Sie sprach nun so laut, dass es die Menschen auch weit hinter ihr in der Schlange hören konnten. »Außerdem habe ich Punkte auf meinem Schrittzähler, die Sie noch draufrechnen können. Also bitte …«, sie schlug mit der flachen Hand auf das Warenband, »… ziehen Sie die Karte durch und fertig.«
Scheinbar unbeeindruckt von Rondas Gefühlsausbruch drehte sich die Kassiererin von ihr weg. »Herr Frank, Kasse 4 bitte. Herr Frank, die Vier bitte«, ertönte ihre quäkende Stimme durch die Lautsprecher des Supermarktes.
Kurz darauf erschien ein etwa 30-jähriger Mann in Anzug und Krawatte – alles abgestimmt auf die Farben des Supermarktes –, tuschelte kurz mit seiner Mitarbeiterin und nahm anschließend Ronda beiseite.
»Mein Name ist Frank, ich bin hier der Filialleiter. Frau, äh …« Er schaute auf die Bankkarte, welche ihm die Kassiererin gegeben hatte. »… Ronda, wir können Ihnen die ausgesuchten Waren heute nicht mehr verkaufen. Ihre Bankkarte ist leider gesperrt.«
»Was heißt gesperrt?«, fragte Ronda sichtlich erregt.
»Nun ja. Offensichtlich haben Sie in den letzten Tagen Ihr Feinstaublimit überschritten, und das wirkt sich, wie Ihnen doch sicher klar ist, auf Ihre Liquidität bezüglich importierter Waren aus.«
»Scheiße noch mal, und wie soll ich jetzt was essen?«
»Frau Ronda, bitte zügeln Sie sich. Ich versuche, nachsichtig mit Ihnen umzugehen. Wenn Sie sich jedoch nicht beruhigen, muss ich Sie des Marktes verweisen.«
»Und was … ?«, setzte Ronda laut an.
Frank hob die Hand.
»Und was soll ich jetzt essen?«, fuhr Ronda leiser fort. »Sie können mir doch nicht einfach das Essen verwehren, nur weil ich einen Wochenendausflug mit dem Auto unternommen habe.«
»Nein«, Frank schüttelte den Kopf. »Das ist mitnichten meine Absicht.«
Klugscheißer, dachte Ronda.
»Sie können sich sehr gerne von den Waren aus heimischer Erzeugung, die in der CO2-Gruppe A klassifiziert sind, bedienen. Es geht doch nur um Importprodukte.«
»Oh Mann, da blickt ja kein Mensch mehr durch. Außerdem! Was soll bitte an Fertigcurrywurst oder Brot Importware sein?«
»Das Brot, das Sie sich ausgesucht haben, wird in Polen gebacken und hierher gefahren. Das Fleisch der besagten Currywurst kommt aus Russland, der Curry aus Indien und die Tomaten für die Tomatensoße aus Spanien.«
»Aber …« Weiter kam sie nicht.
»Aber ja«, sagte Frank wie zu einem Kind. »Auch die Hühnerbrust fällt seit der neuesten Umweltreform unter Importware. Selbst wenn sie aus Niedersachsen stammt. Das sind immerhin über 500 Kilometer.«
»Und was soll ich jetzt essen?«
»Ganz einfach. Wir bieten speziell für unsere Kunden, die vielleicht nicht so bewandert sind mit frisch zubereiteten Waren, eine kostenlose Informationsbroschüre an, in der Sie Schritt für Schritt erfahren, wie Sie aus heimischem Mehl Nudeln produzieren können oder wie Sie dieses frische knackige Gemüse dort drüben in einen leckeren Eintopf verwandeln können.« Er klang sehr herablassend. »Blättern Sie einfach kurz durch und entscheiden Sie, mit welchem Gericht Sie Ihren Weg in einen umweltverträglichen und ökologisch ausgewogenen Umgang mit unserer Erde beginnen möchten.« Er begann zu lachen. Zuerst war es nur ein leises Kichern, das sich jedoch schnell zu einem herzhaften Lachen ausweitete. Dabei kniff er die Augen zusammen. Tränen quollen zwischen den Lidern hervor. Immer euphorischer wurde das Lachen. Plötzlich drehte sich die Kassiererin zu Ronda um und lachte sie mit einer verzerrten schadenfrohen Fratze an. Das Lachen schwoll zu einem Dröhnen an, als auch die anderen Menschen im Raum einstimmten. Es wurde so laut, dass es Ronda in den Ohren klingelte.
Sie rannte zur Ausgangstür, die sich jedoch nicht öffnete. Hastig drehte sie sich um. Die lachende Meute schritt langsam auf sie zu, als wären sie alle Zombies in einem amerikanischen B-Movie.
Ronda hämmerte mit den Fäusten gegen die Glastür. »Aufmachen«, schrie sie panisch. »Aufmachen, ich bin Polizistin.«
Sie wandte sich um. Starr vor Angst presste sie sich mit dem Rücken gegen das kalte Glas. Jeden Moment würde sie der Filialleiter, der die lachende Meute anführte, erreicht haben.
»Nnnneeeeeiiiiinnnn!«
Ronda saß kerzengerade in ihrem Bett. Sie war schweißgebadet. Ganz leise pochte das Lachen aus dem Traum noch gegen ihre Schädeldecke.
Ein eiliger Blick auf den Wecker verriet ihr: Es war 19.34 Uhr.
»Oh Mist!«
Teil 1
I
Germanien
243 n.Chr.
Mein Geist ist schwach und lahm. Die verbliebenen Kräfte meines Körpers schwinden mehr und mehr – ich sterbe. Bevor mein Körper Nerthus, der Göttin der Erde, übergeben wird, bete ich, dass mir genug Zeit bleibt, alles zu erzählen.
Dies ist meine Geschichte.
Ich bin Geofin vom Stamm der Sueben. Mein Vater war Meinhold – einstiger Anführer unserer Sippe. Meine Mutter Diotrun war Seherin und als heilige Frau weit über die Grenzen unseres Dorfes hinaus bekannt.
Die Ehe ging ich mit Teutobald ein, dem Sohn des Händlers.
Teutobald war ein guter Mann. Er war hell im Geiste und tapfer. Auch wenn er es zeit seines Lebens ablehnte zu kämpfen, wusste ich, dass er im Notfall sein Leben für meines opfern würde. Wir führten eine glückliche Ehe. Er bestellte unsere Felder, und ich kümmerte mich um unser Heim und half meiner Mutter bei der Heilung von Krankheiten oder Verletzungen unserer Dorfbewohner.
Unsere Sippe ließ sich in einem sanften Tal an einem Fluss nieder. Die Gegend war fruchtbar und warm. Der Boden ließ verschiedenste Feldfrüchte gedeihen, und die steilen Hänge des Flusses waren zum Weinanbau vortrefflich geeignet. Die dichten Wälder zu allen Seiten unseres Dorfes beschenkten uns mit einer reichen Auswahl an Wild und schützten uns zudem vor Überfällen von anderen Stämmen oder den Römern.
Die Römer – Fluch und Segen zugleich. Seit vielen Monden leben wir nun in Frieden mit ihnen und betreiben regen Handel. Was jedoch nicht immer so war.
Unzählige Lieder erzählen von blutigen Kriegen zwischen Römern und unseren Stämmen, davon dass Tausende von Männern auf beiden Seiten gestorben sind, verstümmelt aus den Kämpfen zurückkamen oder von den Römern versklavt wurden. Diese Kämpfe aber sind lange her, sodass die Erinnerungen daran verblasst sind.
Viele Römer waren uns wohlgesonnen und begegneten uns freundschaftlich. Manche nannten uns aber auch Barbaren und behandelten uns wie Tiere. Es gab Geschichten von Römern, die des Nachts in Dörfer eindrangen, um junge Mädchen zu rauben. Nahezu keines der Mädchen wurde jemals wieder gesehen. Diejenigen, die zurückkamen, berichteten davon, dass sie die Gier der Römer nach fleischlicher Lust befriedigen mussten. Jede Nacht suchte sich der Herr, der sie gekauft hatte, eine andere aus, um sie mit in sein Gemach zu nehmen. Dort mussten sie Dinge über sich ergehen lassen, die einem Mann ihres Volkes niemals in den Sinn gekommen wären.
Überfälle unsererseits gab es auch zur Genüge. Junge Männer, angezogen von dem feudalen Leben der Römer, schlichen sich des Nachts über die Grenze des Erdwalls, den die Römer durch unser Land gezogen hatten. Dort raubten sie Kelche, Schmuck und Waffen. Oft kam es vor, dass einer oder mehrere der jungen Männer ihre Kühnheit mit dem Leben bezahlten. Wurden sie gefasst, hängten sie die Römer an gekreuzten Hölzern auf und überließen sie den Göttern. Bewacht von Soldaten war es uns nicht möglich, den Brüdern zu helfen. Es war uns auch nicht gestattet, die Leichen der Männer nach ihrem Tod zu verbrennen, wie es unser Brauch gebietet.
Befolgten wir jedoch die Regeln der Römer, hatten wir nur wenig zu befürchten. Wir blieben auf Abstand und versorgten die Römer mit den Ernten unserer Felder sowie mit Vieh.
Mein Mann Teutobald war sehr geschickt im Umgang mit den Römern. Er wusste, wonach die römischen Krieger verlangten, und stillte ihren Bedarf treffend und reichlich. Durch die Münzen und andere Kostbarkeiten, die er so mit nach Hause brachte, hatten wir ein gutes Leben. Teutobald war stets sehr gut zu mir. Er war zärtlich, fürsorglich und gutherzig. Niemals sprach er ein böses Wort. Außerdem verstand er sich darauf, mich zum Lachen zu bringen. Ich war sehr glücklich, dass mir die Götter solch einen Mann geschenkt hatten. Ich liebte es, mich an seinen breiten Schultern anzulehnen. Wenn seine großen Hände meinen Körper umschlangen, fühlte ich mich geborgen wie der Fuchs in seinem Bau.
Im Laufe der Zeit, als die Kräfte meiner Mutter zu schwinden begannen, übernahm ich mehr und mehr ihre Aufgaben. Sie lehrte mich die heilige Kunst der Kräuterkunde und zeigte mir, wie die Zeichen der Natur zu deuten sind. Schnell war ich imstande, die benötigten Kräuter gegen Hautrötungen, Brandverletzungen oder Durchfall selbst zu erkennen und zu sammeln.
So auch an einem schönen Tag im hohen Maien vor acht Sommern.
Das Grün der Hügel war kräftig. Die Bäume wiegten ihre Blätter im sanften Wind, der auch durch die Halme des Getreides auf dem Feld strich. Die Luft war geschwängert vom Duft der Blumen und dem feuchten Gras. Es war die Zeit der Liebenden, um die Kraft der Natur für ihre eigene Leibesfrucht in sich aufzunehmen.
Ich war, als sich die Sonne bereits über den südwestlichen Hügeln befand, gerade auf dem Rückweg von meiner Suche nach Kräutern. Die graubraune flache Tonschale, die ich mit mir trug, war gefüllt mit wohlriechenden, feinen Blättern. Von einer Kuppe aus schaute ich auf unser Dorf, welches eingebettet in sanfte Hügel friedlich vor mir lag. Der Fluss schlängelte sich in unzähligen Windungen durch das Tal. Zur westlichen Seite erstreckte sich eine weite Ebene. Am Ende dieser Ebene konnte man den Schutzwall der Römer erahnen. Er zog sich gerade wie der junge Trieb einer Weide von Süd nach Nord. Mein Mann, der in seinem Leben bereits sehr viel von der Welt außerhalb unseres Dorfes gesehen hatte, erzählte mir einmal, dass einen halben Tagesmarsch südlich von hier der Wall eine scharfe Biegung nach Osten vollführt, um sich von dort aus wie eine Natter über schroffe Hänge und Erhebungen zu schlängeln. Die Römer nennen diese Schlange den Limes. Eine nicht enden wollende Wand – höher als der größte Suebe. Davor eine undurchdringliche Reihe aus ebenso hohen Holzpfählen. Hinter dem Wall hatten die Römer hohe schmale Häuser aus Holz und Stein errichtet. Zur Überwachung des Erdwalls, sagten die Älteren.
Unser Dorf bestand aus acht mit Stroh bedeckten Häusern. Das Gebäude in der Dorfmitte gehörte meinen Eltern. Mein Mann und ich lebten am Rande der Siedlung direkt an unseren Feldern. Es waren drei an der Zahl, wovon wir nach alter Tradition immer nur zwei bestellten, damit genug Zeit blieb, um den Nachbarn in der Not zur Hand gehen zu können. Umringt war das Dorf von einem hüfthohen Zaun aus Holzpflöcken, die mit dünnen Zweigen verflochten waren. Egal, wann man sich dem Dorf näherte, sah man stets Kinder in den Feldern spielen und Männer arbeiten.
Doch nicht an diesem Tag. Etwas war anders.
Es wunderte mich, dass Rauch aus den Häusern aufstieg, obwohl es in der Sonne warm war, sodass die Kleider am Körper klebten.
Es war niemand zu sehen.
Ich schaute mich um. In den Weinbergen war kein Mensch bei der Arbeit.
Schnellen Schrittes lief ich den Hang hinunter. Ich ging eilig den Pfad entlang zum Eingang unseres Dorfes. Es war kein Laut zu hören. Es schien, dass selbst die Vögel in ihrem Gesang verstummt wären.
Keuchend erreichte ich den Zaun.
Dann sah ich es.
Die Häuser waren in ihrem Inneren allesamt in Brand gesteckt worden. Das Vieh, welches zu dieser Tageszeit in einem hölzernen Gatter am Rand des Dorfes gehalten wurde, war tot – abgeschlachtet.
Schockiert ließ ich die Schale fallen und lief so schnell ich konnte zu unserem Haus. Auch in ihm loderten hohe Flammen.
Ich rief nach meinem Mann, bekam aber keine Antwort. Wirr vor Angst nahm ich all meinen Mut zusammen und ging in das Innere. Der Rauch des Feuers krallte sich wie die Tatze eines Bären in meinen Hals. Meine Augen konnten nur noch Umrisse im Nebel erkennen. In der Ecke, in der wir normalerweise unser Nachtlager hatten, lag Teutobald. Sein nackter Oberkörper glänzte feucht. Ich stürzte zu ihm und rüttelte an seinen Schultern. Sein Kopf, der zuvor auf einer Seite gelegen hatte, kippte zur anderen. In seinem Schädel klaffte ein großes Loch. Graue Masse quoll zähflüssig hervor.
Ein Stich wie von einem Dolch durchfuhr meinen Körper.
Entsetzt rief ich laut seinen Namen.
Dann nahm ich seine Hände und begann, ihn aus dem immer stärker brennenden Haus zu ziehen.
Das Feuer hatte zwischenzeitlich die dicken Holzpfähle erreicht, welche das Dach hielten. Nicht mehr lange und es würde auf uns stürzen. Die Außenwände aus Holz und Lehm standen bereits in Flammen.
Sein Körper war schwer, sodass ich große Mühe hatte, meinen geliebten Mann ins Freie zu ziehen. Vor Anstrengung atmete ich keuchend. Bei jedem Atemzug brannte die Hitze des Feuers in meinem Körper. Es roch nach verbrannten Haaren und verkohltem Fleisch.
Draußen zog ich Teutobalds leblosen Körper einige Schritte vom Haus weg. Angstvoll blickte ich auf ihn herab. Ich hatte bereits genug Leichen gesehen, um zu erkennen, dass für ihn jede Hilfe zu spät war. In seinem Oberkörper steckte eine dicke Lanze. Ein Bein war bis auf ein wenig Fleisch vom Körper getrennt. Seine Hände waren von Schwerthieben verstümmelt.
Er musste gekämpft haben bis zum letzten Atemzug.
Die Trauer um meinen Mann überkam mich wie ein Sturm. Meine Augen füllten sich mit Tränen, die mir bald heiß über die Wangen liefen.
Ich ließ mich neben seinem Kopf auf die Knie fallen und brüllte meinen Schmerz hinaus in die Welt wie ein wildes Tier, das verletzt am Boden liegt. Dann ließ ich meinen Kopf auf die Brust meines Mannes sinken. Ich beobachtete, wie meine Tränen feine Bäche auf seiner Haut bildeten, gemischt mit seinem Blut.
Das Prasseln des Feuers rings um uns holte meinen Geist langsam in die Realität zurück. Es war noch keine Zeit zu trauern. Das Schicksal meiner Eltern war ungewiss, und das der anderen Dorfbewohner auch.
Quälend langsam hob ich meinen Kopf, um mich von Teutobalds geschundenem Körper zu trennen. Ein unsichtbares Band schien mich jedoch regelrecht an ihn zu binden. Dennoch schaffte ich es aufzustehen. Ich blickte mich kurz um und stürmte in das Haus meiner Eltern, woraus ebenfalls beißender Qualm drang. Mein Vater lag im Eingang – vielmehr das, was von ihm übrig war. Ihm fehlte der Arm, mit dem er normalerweise sein Werkzeug hielt. Sein Kopf war kaum mehr als Solcher zu erkennen. Vermutlich durch eine große schwere Klinge war er in der Mitte der Länge nach gespalten.
In einer Ecke sah ich meine Mutter. Sie lag ausgestreckt auf dem Rücken. Der weite Chiton, der Überwurf mit Ärmeln, ihres Kleides fehlte. Der enge Chiton war ebenso wie die Chamisia, das Unterkleid, zerrissen und über die Hüften hochgezogen. Wotan allein wusste, was ihr angetan worden war. Über ihren Hals zog sich eine klaffende Wunde.
Auch sie war tot.
Brennende Wut überkam mich, sodass ich Mühe hatte, die Fassung zu bewahren.
Ich zog zuerst meinen Vater aus seiner brennenden Behausung. Danach eilte ich sofort zurück, um meine Mutter aus dem Feuer zu retten.
In sicherer Entfernung zu den zwischenzeitlich brüllenden Flammen legte ich die leblosen Körper der drei Personen, die mir in meinem Leben am meisten bedeutet hatten, nebeneinander ab.
Obwohl ich dem Zusammenbruch nahe war, zwang ich mich dazu, die Suche nach eventuellen Überlebenden fortzusetzen. So eilte ich zum Haus des Schmiedes, der Teutobald und mich einst verheiratet hatte. Das Dach seines Hauses war bereits eingestürzt. Aus den Trümmern hörte ich das dämonische Brüllen des Feuers nach weiterer Nahrung. Ich wusste, in dieser Hölle gab es kein Leben mehr. Falls sie nicht rechtzeitig fliehen konnten, waren auch der Schmied und seine Familie tot.
Ein Haus nach dem anderen ging ich ab, sah aber überall nur Feuer, Rauch und Tod. Dem Weinbauern und seiner Frau waren die Häupter vom Rumpf getrennt worden. Danach hatten die Bestien, die hier gewütet hatten, beide Körper an einen Baum gebunden. Die Köpfe hatten sie vertauscht mit Stöcken auf die Rümpfe gesteckt, sodass nun auf dem nackten geschundenen Leib der zierlichen Bauersfrau der massige Kopf ihres Gatten ruhte.
Niemals zuvor hatte ich derart viel Zerstörung und Gewalt gesehen.
Ohne Unterlass arbeitete ich bis weit nach Sonnenuntergang. Jeden Körper, den ich fand, brachte ich zu dem Platz, an dem ich meinen Mann und meine Eltern niedergelegt hatte. Das Feuer der brennenden Häuser spendete mir ein geisterhaft loderndes Licht, um meine Arbeit zu vollenden. Nachdem ich die letzte Leiche zu dem Platz nahe der Mitte des Dorfes gezogen hatte, spürte ich die Erschöpfung, die bisher von meinem Tatendrang unterdrückt worden war. Meine Glieder brannten vor Anstrengung, und mein Rücken schmerzte. Die Haut meiner Arme und Beine war an vielen Stellen verbrannt. Meine Kleidung war zerrissen. Ruß und Blut beschmutzten meinen Leib von oben bis unten. Meine Kräfte waren am Ende – mein Geist taub durch all das Leid, das ich gesehen hatte. So brach ich an der Stelle, an der ich stand, zusammen. Ich weinte um meinen lieben Mann, um meine Eltern, um die Freunde meiner Sippe – um die Kinder, die ebenfalls nicht verschont worden waren. Und ich weinte, weil ich das erste Mal in meinem Leben ganz allein war. Zeit meines Lebens hatte ich meine Eltern gehabt, die für mich sorgten. Später hatten sie mich den schützenden Händen meines lieben Mannes übergeben. Sie alle waren nun nicht mehr. Es gab niemanden, der mir meinen Weg weisen konnte. Niemand, der mir riet, was gut und was schlecht war. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Wohin sollte ich gehen, wo schützenden Unterschlupf in der Nacht finden?
Bald schon würden Wölfe und Bären das Fleisch der Toten wittern. Dann würden sie kommen, um das, was noch von meinen Lieben übrig war, zu zerfetzen und zu verschlingen.
Es blieb mir nur eine Möglichkeit. Ich musste sie bestatten, so schnell es ging.
Hastig begann ich, Holz aufzustapeln. Darauf legte ich die Leichen. Auf die Toten schichtete ich weiteres Holz. Mit einem brennenden Stock aus einem der Häuser steckte ich das Gebilde in Brand. Nur langsam begannen die Flammen an den Ästen zu lecken. Die Kleidung der Toten qualmte, wollte aber nicht brennen. Als wenn die Götter mir die frühe Bestattung verwehren wollten, erlosch das Feuer nach einiger Zeit ganz.
Ich war gezwungen, weitere Äste sammeln zu gehen, um die Flammen wieder anzufachen. Damit beide Arme für das Holz frei waren, ging ich ohne eine Fackel los in den Wald. Jedoch war es so finster, dass ich die Hand vor Augen nicht sehen konnte. Die Dunkelheit hüllte mich vollkommen ein.
Plötzlich ergriff mich panische Angst.
Ich hatte die Bestattung nicht vollendet. Also war es möglich, dass die Seelen der Toten noch nicht von deren Körpern freigegeben worden waren. Eine Geschichte, von der uns die Dorfälteste einmal erzählt hatte, kam mir in den Sinn.
Als sie eine junge Frau gewesen war, hatte sie sich mit ihrer Mutter gemeinsam um einen Bruder gekümmert, der die Hitze hatte. Allen war bewusst, dass er sterben würde. Auch die Seherin hatte keine Hoffnung mehr für ihn. Sein Todeskampf dauerte einige Tage, als das Keuchen und Wimmern plötzlich verstummte. In ihrer tiefen Trauer vergaß seine Mutter, alle Töpfe und Schalen umzudrehen, damit sein Geist nicht hineinfallen konnte. Man brachte den leblosen Körper zur Dorfmitte, wo er drei Tage und zwei Nächte aufgebahrt werden sollte. Nach der ersten Nacht war er auf einmal nicht mehr da. Das ganze Dorf suchte nach ihm, bis man ihn schließlich im angrenzenden Wald fand, umherirrend. Es hatte vier Männer mit schweren Knüppeln bedurft, den Geist aus dem Körper zu befreien.
Ich stand zitternd inmitten einer kleinen Lichtung, auf die der Mondschein fiel. Vor Angst konnte ich mich nicht bewegen. Meine Augen suchten jeden Winkel des schwarzen Waldes ab. Meine Ohren nahmen sämtliche Geräusche der Umgebung wahr. Bei jedem Rascheln fuhr ich schreckhaft zusammen.
Es gab nur einen Ausweg. Ich musste beenden, was ich angefangen hatte. Um Teutobalds willen musste ich ihn bestatten, um ihn in Erinnerung zu behalten, wie ich ihn kannte. Neuer Mut flammte in mir auf. Aber die Angst wich nur sehr langsam aus meinen Gliedern.
Als mein Körper meinem Geist wieder gehorchte, ging ich gebückt weiter. Einen Zweig nach dem anderen sammelte ich ein, bis ich das Gewicht fast nicht mehr tragen konnte.
Da das Feuer bis weit in den Wald zu riechen war, musste ich mich nur an dem beißenden Gestank von verbranntem menschlichem Fleisch und verkohltem Holz orientieren, um meinen Weg zurückzufinden.
Als die Sonne bereits wieder hinter den östlichen Bergen erschien, stand der Holzhaufen endlich lichterloh in Flammen. Ich betete zu den Göttern, dass sie sich der Seelen der Verstorbenen annahmen. Bis zum Mittag des folgenden Tages saß ich vor dem lodernden Haufen aus Holz, Knochen und Fleisch. Ein tiefer Schmerz brannte in meiner Seele. Erst jetzt bemerkte ich, dass ich die Leichen so schnell verbrannt hatte, dass mir keine Zeit geblieben war, Abschied von Teutobald zu nehmen.
Lange Zeit saß ich stumm da und trauerte. Immer stärker gesellte sich ein anderes, quälendes Gefühl zu meiner Trauer – Wut.
Wer hatte meiner Sippe das angetan? Weshalb war niemand am Leben gelassen worden? Plötzlich verspürte ich einen Durst nach Blut. Ich verlangte Rache für das, was meiner Familie angetan worden war. Nur, wer waren die Bestien, die in unserem Dorf gewütet hatten? Da kam mir ein Gedanke – die Lanze in Teutobalds Brust. Sie konnte mir vielleicht den Weg zu seinen Mördern weisen.
Wie eine Irre grub ich mich durch die Asche der Begräbnisstätte. Meine Finger ertasteten verschiedenste Gegenstände. Römische Münzen, Kleiderschnallen und andere nicht brennbare Dinge kamen zum Vorschein. Ich grub tiefer. Hier waren die menschlichen Überreste teilweise noch sehr weich, da das Feuer sich nicht so tief gegraben hatte. Ekel stieg in mir auf. Ich musste den Drang, meinen Magen auf die Totenstätte zu entleeren, mit aller Kraft unterdrücken. Dann bekam meine Hand etwas Hartes, Heißes zu fassen. Es war lang und spitz zulaufend. Ich zog fest daran, um es aus dem Grab zu befreien. Und tatsächlich, es war die Spitze der Lanze. Sie war fast so lang wie mein Unterarm und hatte an einem Ende eine runde Öffnung für das Holz, mit dem man die Waffe führt. Zur Spitze hin war das Eisen platt und ähnlich geformt wie ein Buchenblatt.
Eilig lief ich zum Fluss, um das Eisenstück von Ruß und Schmutz zu säubern. Ich kniete mich an das Flussbett und begann, mit dem Umhang meines Kleides die Lanze zu reinigen. Dann hielt ich sie mir dicht vor die Augen.
Etwas war in die Oberfläche eingeritzt. Ich konnte die Schrift jedoch nicht lesen. Die Zeichen unseres Stammes kannte ich, aber diese Art von Schrift hatte ich nie zuvor gesehen.
Sicherlich konnte mir eine Seherin aus einem benachbarten Dorf sagen, um welche Schriftzeichen es sich dabei handelte. Meine Mutter hatte mir einst erzählt, dass Sueben etwa zwei Tagesreisen von unserem Dorf entfernt lebten.
Zwei Tagesreisen. Ich hatte weder etwas zu essen noch eine Kuh, die mich tragen oder mir Milch spenden könnte. Außerdem war ich in meinem Leben nie so weit fortgegangen. Mir wurde klar, dass mir eine einsame Reise voller Gefahren bevorstand. Trotzdem war ich entschlossen, diejenigen, die meine Familie ermordet hatten, zu finden und meine Lieben zu rächen.
II
Ludwigsburg – Bahnhof
Gegenwart
Claudia stand am Bahnsteig 2 des Ludwigsburger Bahnhofes. Sie wartete auf ihre Freundin Franka, die, wie so oft, zu spät kam. Die S 4 nach Stuttgart würde in wenigen Minuten einfahren. Von Franka war jedoch bisher weit und breit keine Spur. Nervös schaute Claudia immer wieder auf die Uhr. Wo blieb sie nur?, dachte sie. Sie waren bereits das letzte Mal, als sie zu einer Demonstration nach Stuttgart fuhren, zu spät gekommen und hatten sich daher ganz hinten am Ende des Zuges einreihen müssen; bei den ganzen fußkranken Rentnern und Langweilern, die still vor sich hin wankten und ihrem Unmut lediglich durch Sticker, T-Shirts oder Transparente Ausdruck verliehen. Die Macher gingen voran. Dort wurde gepfiffen, gejohlt und gestritten. Nicht, dass Claudia auf Streit mit den Passanten aus wäre oder sich auch nur im Geringsten für das Demonstrationsthema interessierte; sie und ihre Freundin wollten einfach ein wenig Action erleben. Und wenn schon mal ganz Deutschland nach Stuttgart schaute, dann wollten sie dabei sein. Party-Demonstranten – so nannten sie ihr Verhalten selbst. Diese Haltung teilten wenige der Demonstranten. Die meisten waren Feuer und Flamme für die Sache und brauchten nur ganz leicht angestupst zu werden, um ihren Unmut lautstark zum Ausdruck zu bringen. Dabei ging es doch nur um ein paar blöde Windräder, die in Stuttgart aufgestellt werden sollten. Claudia konnte das Theater nicht verstehen. Klar sahen die Dinger nicht toll aus, aber sie störten auch nicht. Und wenn man dadurch irgendwann mal ein Atomkraftwerk abschalten konnte, war doch allen geholfen. So zumindest dachte sie sich das. Andere machten aus der ganzen Geschichte dasselbe Drama, das bereits bei ›Stuttgart 21‹ abgelaufen war. Anwohner beschwerten sich über das verschandelte Stadtbild und den Lärm, Denkmalschützer klagten über die Vernichtung von historischen Stätten und Naturschützer gingen auf die Barrikaden, weil sie irgendwelches Getier in Gefahr sahen, welches einzig an den Stellen, an denen die Windräder stehen sollten, seine Brutplätze hatte. Sollten sie doch lieber gegen Atomkraftwerke demonstrieren anstatt sich an die Fundamente der Windräder zu ketten, dachte Claudia. Die Gesellschaft war nun mal von Energie abhängig, und da war es doch nur verständlich, dass sich die Regierung über die Energiebeschaffung Gedanken machte. Keiner wollte in der Nähe eines Atomkraftwerks leben. Ebenso wollte aber auch niemand Windkraftanlagen in seiner Nähe haben. In der Nordsee oder in Ostdeutschlands flachen Gebieten mit viel Wind konnte man sich von Baden-Württemberg aus die Anlagen gut vorstellen. Aber vor der eigenen Tür? Niemals.
Schon ziemlich ignorant, fand sie.
In diesem Moment kam Franka die Treppe aus der Unterführung hochgelaufen. Völlig außer Atem blieb sie neben Claudia stehen. Anstatt sie zu begrüßen, schaute Claudia sie grimmig an.
»Ja, sorry, Mann, ich hab’s mal wieder verpeilt. Ich bin nicht rechtzeitig fertig geworden«, keuchte Franka.
Claudia setzte eine gespielt finstere Miene auf. Nach einer Sekunde Schweigen zwischen den beiden wurde ihr Gesicht weicher. Dann umarmten sie sich und küssten sich auf beide Wangen.
»Hey, du siehst gut aus. Schicke Hose. Ist die neu?«, fragte Claudia.
»Ja, hab ich mir heute gekauft. Deswegen hat’s auch gedauert. Hab ein bisschen länger gebraucht, bis ich da drin war.« Franka drückte ihren Rücken durch und streckte demonstrativ ihren Bauch nach vorn. Sie kicherten laut.
Die S-Bahn näherte sich polternd. Das Gelächter der beiden jungen Frauen wurde von den quietschenden Bremsen und rumpelnden Metallrädern übertönt.
Nachdem sich die Zugtüren zischend geöffnet hatten, stiegen sie ein. Gleich neben dem Eingang war ein Vierersitz frei. Die Mädchen setzten sich einander gegenüber ans Fenster.
Claudia, die es gewohnt war, mit der Bahn zur Arbeit zu fahren, war verwundert über den spärlich besetzten Zug. Wenn sie morgens in Freiberg einstieg, musste sie normalerweise bis Ludwigsburg stehen. An diesem Abend aber waren gerade mal etwa 30 Personen im Abteil.
Franka schaute Claudia besorgt an. Dann säuselte sie: »Du siehst ganz schön fertig aus, meine Liebe. Lange Nacht gehabt?« Dabei umspielte ein verschmitztes Lächeln ihre Lippen. Claudia lehnte sich zurück, legte ihren Kopf an die Sitzlehne und atmete kräftig aus.
»Wenn’s nur so wäre. Ich hab zurzeit total viel Stress im Geschäft. Glaubst du das, da hab ich mein Ziel dieses Jahr schon erreicht, und jetzt wollen die, dass ich noch mehr mache. Dieses Ziel gilt nicht mehr, heißt es. Es zählen nur noch Schlagzahlen.« Sie gestikulierte wild mit ihren Händen. »Der Markt gibt mehr her, als Sie machen, Frau Seidler«, sagte sie mit gespielt tiefer Stimme. »Die sind doch nicht ganz dicht. Ich hab dieses Jahr noch nicht mal zwei Wochen Urlaub gemacht, und jetzt haben die mir meinen Novemberurlaub gestrichen.«
Claudia war Außendienstlerin bei einem großen Finanzmakler. Ihr Job war es, Neukunden für das Unternehmen zu werben – worin sie sehr gut war. Franka war Studentin für Kulturmanagement an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg und hatte von dem, was Claudia erzählte, keine Ahnung.
»Was meinst du mit Schlagzahlen?«, fragte sie deshalb.
»Wir müssen jede Woche eine bestimmte Anzahl an Neukunden gewinnen. Egal wie. Hauptsache, Freitagmittag haben genug unterschrieben.«
»Und was ist, wenn du es nicht schaffst?«
»Dann ist Samstag auch noch ein Tag, wie mein Chef immer sagt.«
»Na, der hat Nerven. Der weiß wohl nicht, dass du dich Freitagabend in einen männerfressenden Vamp verwandelst und Samstag vor 13 Uhr nicht aufstehst«, sagte Franka gespielt entrüstet.
Erneut lachten beide.
Franka gab Claudia immer das Gefühl, hübsch und begehrt zu sein. Claudia selbst hielt sich für unattraktiv. Vielleicht sogar ein bisschen bieder.
Sie war 1,69 Meter groß und hatte schulterlange, glatte braune Haare, die wie mit einem Lineal gezogen alle auf gleiche Länge geschnitten waren. Ihr Gesicht war schmal und mit einer spitzen Nase versehen. Darauf thronte eine ovale randlose Brille. Ihre Figur bezeichnete sie selbst immer als knochig. Sie war extrem dünn, hatte kleine Brüste und einen flachen Hintern.
Ganz im Gegensatz zu ihrer Erscheinung war ihr Mundwerk alles andere als zurückhaltend. Sie war nicht vorlaut oder frech, aber sie redete gern. Außerdem hatte sie das Talent, aus einfachen Dingen reißerische Geschichten zu konstruieren. Zudem war sie ungemein schlagfertig, wofür sie von Franka bewundert wurde. Daher rührte auch ihr Erfolg im Vertrieb. Nach Ansicht ihrer Freunde wäre sie dazu fähig, dem Teufel ein Feuerzeug zu verkaufen.
Franka war, was das Aussehen anging, genau das Gegenteil von Claudia. Sie war klein, füllig und spielte gerne mit ihren Reizen. Sie trug mit Vorliebe weit ausgeschnittene Shirts oder Blusen und dazu hautenge Hosen. Ihr Gesicht war rund, die Wangen hatten eine gesunde rosa Farbe. Sie hatte große grüne Augen und volle Lippen. Allerdings war sie lange nicht so wortgewandt wie Claudia. Sie drückte sich derart plump aus, dass sie von vielen für grob oder dümmlich gehalten wurde. Und sie sprach im Normalfall immer genau das aus, was sie gerade dachte. Was ihr schon des Öfteren Schwierigkeiten eingebracht hatte.
Die S-Bahn hielt in Kornwestheim an, und die Türen öffneten sich. Herein kam ein dürrer Kerl mit langen schwarzen Haaren, schätzungsweise 20 Jahre alt. Am Haaransatz war zu erkennen, dass er seine Haare schon länger nicht mehr gefärbt hatte. Ein Streifen dunkelblond war deutlich sichtbar. Er war komplett in Schwarz gekleidet. Schwarze Hose, schwarzer Pullover mit der weißen Aufschrift ›Ja, ich spiele Gewaltspiele‹ und ein schwarzer Ledermantel.
»Schau dir mal den Typen an. Der geht hundert Pro auf einen Friedhof und beißt Hühnern bei lebendigem Leib den Kopf ab«, flüsterte Franka.
Claudia verzog angewidert das Gesicht.
Das musste er gehört haben, da er sich im Vorbeigehen den Mädchen zuwandte. Dabei funkelte er Franka böse an. In einiger Entfernung zu den beiden Mädchen stellte er sich vor eine Tür.
»Hast du das gesehen? Der trägt hellblaue Kontaktlinsen«, zischte Claudia. »Der Kerl ist mir unheimlich.« Dabei schüttelte sie sich, als wenn ihr plötzlich kalt geworden wäre.
»Der glotzt voll zu uns rüber«, flüsterte Franka. Sie ließ den jungen Mann nicht aus den Augen.
»Starr da nicht so hin«, fuhr Claudia ihre Freundin an.
Franka zuckte mit den Schultern. »Schau ihn dir doch an. So einen Kerl muss man doch beobachten. Wer weiß, was dem im Kopf rumgeht.«
Widerwillig drehte sich Claudia zu dem jungen Mann um.
»Der Typ ist in der Schule sicher immer von seinen Mitschülern …« Claudia brach mitten im Satz ab, als der Junge etwas Schwarzes, Langes unter seinem Mantel hervorzog. Sie hielt den Atem an. Gebannt starrte sie auf die schwarze Hülle, die aussah, als ob sich ein Gewehr darin befände. Vor ihrem inneren Auge spielte sich ein Film ab, den sie selbst in der jüngsten Vergangenheit erlebt hatte.
Dann sah sie, wie er von dem schwarzen Rohr den weißen Kunststoffdeckel abnahm und ein eingerolltes Stück Papier herauszog.
Langsam ließ sie die Luft aus ihren Lungen entweichen.
»Wie dumm«, sagte sie mehr zu sich selbst.
»Was ist dumm?«, fragte Franka.
Claudia winkte seufzend ab. »Ach nichts. Ich hab mich gerade zu Tode erschreckt, nur weil der Grufti eine Plakatrolle aus seinem Mantel gezogen hat. Ich dachte, es wär ’ne Waffe.«
»Dir geht immer noch die Sache von vor zwei Monaten nach, ja?«
»Ist ja auch irgendwie verständlich, oder?«
Zwei Monate zuvor hatte Claudia in einer Geschäftsstelle des Unternehmens Akquisetelefonate bei potenziellen Neukunden durchgeführt. Sie saß in ihrem Büro, welches durch einen kurzen Flur mit einem weiteren Büro verbunden war. Plötzlich hörte sie, wie eine ihrer Kolleginnen panisch schrie. Kurz darauf splitterte Holz. Männergebrüll dröhnte durch die Räume. Dazwischen kreischende und heulende Frauenstimmen, gefolgt von dem ohrenbetäubenden Geräusch von zersplitterndem Glas. Dumpfe Schläge ließen den Boden unter ihren Füßen erzittern. Bevor sie auch nur an Flucht denken konnte, stand ein großer Mann in der Tür zu ihrem Büro. In seinen Händen hielt er eine große Axt. Zwischen ihr und dem Mann befanden sich nur ihr Schreibtisch und der Flachbildschirm ihres Computers. Erschrocken rollte sie mit ihrem Bürostuhl zurück. Im selben Moment krachte die Axt auf den Monitor. Die Wucht des Aufpralls zertrümmerte den Bildschirm. Plastiksplitter schwirrten wie Geschosse durch die Luft und zerkratzten ihr das Gesicht. Die Axt verkantete sich im Tisch. Claudia sprang auf und versuchte, irgendwie aus dem Büro zu kommen. Der Mann bemerkte ihren Plan und bekam sie im letzten Moment am Arm zu fassen. Mit der freien Hand riss er die Axt aus dem Tisch. Die blitzende Klinge hielt er ihr an den Hals. Mit dem Schaft der Axt drückte er gegen ihren Körper und presste sie so an sich. Ihr stieg sein nach Alkohol und Zigarettenrauch stinkender Atem in die Nase. Sein Körper roch, als wenn er sich seit längerer Zeit nicht gewaschen hätte.
»Was wollen Sie?«, kreischte sie.
»Ich will mein Geld. Ihr Schweine sollt mir mein Geld zurückgeben, sonst bring ich hier alle um!«, brüllte der Mann. Er hatte einen starken Akzent, vermutlich ein Osteuropäer.
Dann stürmte die Polizei den Flur. Zwei Beamte postierten sich direkt hinter dem Türrahmen zu ihrem Büro. Sie richteten ihre Dienstwaffen auf Claudia und den Mann.
»Polizei, Waffe runter!«, rief einer der Beamten.
»Ich will mein Geld, ihr Schweine!«, wetterte der Mann erneut.
»Legen Sie die Axt weg und lassen Sie die Frau frei. Dann können wir über alles reden«, sagte der Polizist ruhiger als zuvor.
Claudia wusste später nicht mehr, wie lang es gedauert hatte, bis der Mann die Axt schließlich hatte sinken lassen. Sie konnte sich aber genau daran erinnern, wie er in Tränen ausgebrochen war und sich widerstandslos von den Polizisten hatte verhaften lassen.
Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Mann um einen selbstständigen Paketfahrer handelte, der sein Erspartes in einen scheinbar todsicheren Fonds investiert hatte, der später jedoch den Bach runtergegangen war. Das Geld war weg und damit seine einzigen Ersparnisse. Claudia war im Anschluss an den Überfall eine Zeit lang in psychologischer Behandlung gewesen, hatte den Vorfall laut ihrer Ärztin aber gut weggesteckt. Manchmal jedoch überkamen sie immer noch Panikattacken.
Die Bahn polterte über die sich scheinbar endlos aneinanderreihenden Weichen kurz nach dem Stuttgarter Nordbahnhof.
Franka schaute Claudia besorgt an. In ihren Augen war sie nach dem Vorfall viel zu früh zur Arbeit zurückgekehrt.
»Musst du noch oft daran denken?«, fragte sie ihre Freundin.
»Jeden Tag«, antwortete Claudia leise. Ihr Blick ging durch das Fenster ins Leere. Die beiden Frauen schwiegen.
Durch das Geruckel der Bahn wurde Franka auf ihrer Bank hin und her geschaukelt. Plötzlich hatte sie ein seltsames Gefühl in der Magengegend. Es war heiß und kalt zugleich.
Sie schaute Claudia an, die ihr mit weit aufgerissenem Mund gegenüber saß. Verwirrt blickte sie sich im Wagen um. Die Bahn war zwischenzeitlich im Hauptbahnhof eingefahren. Die Türen waren geöffnet. Einige Fahrgäste verließen oder betraten den Waggon. Andere schauten mit Panik verzerrten Gesichtern auf sie. Frankas Blick suchte den Jungen, über den sie sich gerade noch wegen seines Aussehens lustig gemacht hatte. Sie konnte ihn nirgends finden.
Sie sah wieder Claudia an, die jetzt beide Hände auf den Mund presste. Franka wollte Claudia fragen, was los sei, sie brachte aber keinen Ton über die Lippen. Stattdessen spürte sie, wie etwas Warmes aus ihrem Mund quoll. Reflexartig wollte sie ihre Hand an den Mund halten, um es aufzuhalten. Sie konnte ihre Arme jedoch nicht bewegen.
Sie bemerkte, dass Claudia schreckensbleich auf ihren Unterleib starrte. Langsam senkte Franka den Kopf. Alles war rot. Ihr rosa Oberteil, die neue Hose, sogar die Schuhe und die Sitzbank glänzten nass.
Mit einem Mal spürte sie einen Schmerz im Bauch, als wenn ihr jemand mit einer glühenden Zange die Eingeweide herausreißen würde. Niemals zuvor hatte sie solche Schmerzen verspürt. Ihr ganzer Körper begann unkontrolliert zu zittern. Der Schmerz raubte ihr sämtliche Gedanken. Ihr Gehirn war nicht mehr fähig, festzustellen, was passiert war. Das Brennen in ihrem Unterleib wand sich wie ein lodernder Wurm durch ihren Körper. Er fraß sich durch ihre Lunge und ihr Herz bis in ihr Gehirn, wo er ihre Sinne zur Explosion brachte.
III
Wie oft muss ein Herz brechen, bis es zu Eis erstarrt? Brechen konnte es, das wusste er nur zu gut. Wie oft schon war er enttäuscht, übergangen, nicht ernst genommen worden. Die Leistung anderer war immer besser gewesen als seine eigene. Egal, was er auch tat, er war nie gut genug gewesen.
Bereits früh in seiner Kindheit hatte er außergewöhnlich gut Klavier spielen können. Er war sicher kein Wunderkind, aber doch besonders. Er spielte Mozart, Chopin und Schubert – und immer schwang ein Hauch seiner eigenen Interpretation der Stücke mit. Auf Seniorenfeiern, Schulfesten und offiziellen Stadtveranstaltungen wurde er als kleiner Star herumgereicht. Die Menschen waren fasziniert von seinem Spiel und oft tief berührt von der Fülle an Emotionen, die er in seine Darbietung legte.
Seine Eltern hingegen waren immer mehr daran interessiert gewesen, wie umwerfend der Junge einer Bekannten in seinem Anzug aussah, wenn er zu seinen Treffen von Jungpolitikern ging. Der wird es richtig weit bringen, hatte er sich oft von ihnen anhören müssen. Dass sie selbst ein Kind mit vielleicht viel größerem Potenzial in ihren eigenen vier Wänden hatten, hatten sie scheinbar nicht bemerkt.
Ja, ein Herz kann brechen – sehr oft sogar. Aber was geschieht danach?, fragte er sich. Erstarrt es wirklich zu Eis? Wie furchtbar es sich anfühlt, wenn das Herz gebrochen wird, das wusste er genau. Unzählige Male hatte er den Schmerz gespürt. Wobei das Wort ›Schmerz‹ den Zustand, in dem er sich dann befand, nicht ganz umfasste. Es war mehr eine seelische Bewusstlosigkeit, die ihn in diesen Momenten ergriff. Und was ist der Mensch ohne Seele? Nur noch eine leere Hülle. Die Hülle kann arbeiten, essen, trinken, schlafen und laufen. Sie kann aber nicht singen, tanzen, lachen oder lieben.
Was ist das Leben dann noch wert? Wird man gefühlskalt, distanziert oder unbarmherzig?
Und nun war er der Racheengel der gebrochenen Herzen geworden. Bei diesem Gedanken musste er unvermittelt lachen. Was für ein Schmalz triefender Vergleich.
Nein, er war nur der Helfer, den er nie hatte. Derjenige, der zur Stelle war, wenn jemand wegen seelischer Bewusstlosigkeit unfähig war, zu handeln.
War er noch Mensch oder schon eine Maschine? Er schüttelte den Kopf. Nein, eine Maschine war er nicht. Ansonsten hätte er gerade nicht gelacht. Aber wenn er keine Maschine war, dann dürfte er auch nicht gefühlskalt und unbarmherzig sein. Er verspürte aber bei dem, was er tat, keine Gefühle – keine Reue oder gar Mitleid; zumindest nicht den Tätern gegenüber. Es musste ganz einfach erledigt werden, und er fühlte sich dazu berufen. Fühlen, das war es, was den Menschen von der Maschine unterschied. Also war er keine Maschine, sondern ein Mensch mit Seele, der zwischen Gut und Böse, Falsch und Richtig unterscheiden konnte.
IV
Die Klänge der Gitarre waren hart wie Metall. Der Bass brachte die Hosenbeine der Zuhörer zum Flattern. Das Schlagzeug, das mit brachialem Druck die Mägen der Menschen vor der Bühne weichklopfte, gab den Takt der Musik vor.
André Bürkle war in seinem Element. Er stand, mit seiner Gitarre um den Hals gehängt, in der Mitte der Bühne direkt hinter seinem Mikrofonständer. Rechts neben ihm stand der Keyboarder, der tragende Klänge unter die ansonsten harten und abgehackten Rhythmen der Band setzte. Links neben Bürkle stand der Bassist. Die große elektrische Bassgitarre wirkte in seinen Händen in Relation zu seiner Körpergröße überdimensioniert.
Der Schlagzeuger unterbrach mit einem schnell abgestoppten Schlag auf ein Becken das Stück. Das einzige Instrument, das weiterspielte, war die Gitarre.
Mist, dachte Bürkle. Wieder den Break verpasst.
Er konnte sich diese Pause einfach nicht merken. Wobei er bei den Proben zu dem Song selbst den Vorschlag gemacht hatte, am Ende des Riffs zwischen Refrain und Vers eine Pause einzubauen. Bei dem gespielten Lied handelte es sich um den alten Dio-Klassiker ›Holy Diver‹.
Begeistert von den vielen Zuhörern, die sich für seine Band interessierten, schweifte sein Blick über die Menge. Er war überwältigt von den vielen Menschen, die gekommen waren um ihre Musik zu hören. Insgesamt fasste der Raum an diesem Abend etwa 130 Besucher. Ausgelegt war der Keller lediglich für 100 Personen. Dementsprechend groß war das Gedränge. Es herrschte eine ausgelassene und fröhliche Stimmung. Alle sangen und tanzten, lachten oder genossen einfach die Musik.
Bürkle spürte einen gewissen Stolz, als er sich umschaute. Gemeinsam mit seiner Band Roxxy organisierte er einmal jährlich dieses Konzert im Schlosskeller der Stadt Marbach am Neckar. Nun schon zum sechsten Mal. Und immer waren die Konzerte ausverkauft.
Schnell gab er sich wieder völlig seiner Musik hin. Seine Finger flogen regelrecht über die Saiten der weinroten Paul-Reed-Smith-Gitarre. Er ging leicht in die Knie und lehnte sich ein Stück zurück.
Plötzlich durchfuhr ihn ein stechender Schmerz, der von seiner linken Schulter ausging. Einen Wimpernschlag später ebbte der Schmerz jedoch wieder ab – wie jedes Mal. Nur das eine Lied noch, dachte Bürkle. Dann war Pause, und er konnte seiner lädierten Schulter ein wenig Ruhe gönnen. Das Publikum applaudierte begeistert, nachdem sie den Schlussakkord gespielt hatten. Der Keyboarder gab über sein Mikrofon die Pause bekannt, wofür er ein enttäuschtes »Oohh« aus den Reihen der Zuschauer erntete.
Etwas ungelenk streifte sich Bürkle den Gurt der Gitarre über den Kopf. Dann ging er von der Bühne und durch die Menschenmenge. Einige klopften ihm begeistert auf die Schulter. Es herrschte rundum eine gelöste und ausgelassene Stimmung. Bürkles Hals war wie ausgetrocknet. Dummerweise hatte er zu Beginn des Konzertes vergessen, Wasser mit auf die Bühne zu nehmen. Deshalb steuerte er geradewegs auf die Bar zu.
»Hey, Jo, mach mir mal ein schönes kaltes Weizen«, rief er dem jungen Barkeeper zu.
Der zwinkerte ihm freundlich zu und machte sich sofort am Kühlschrank unter dem Tresen zu schaffen. Eine junge Frau mit goldblonden Haaren, die neben dem Barkeeper stand, verzog ihr Gesicht zu einem breiten Grinsen, als sie Bürkle sah. Dabei reckte sie begeistert beide Daumen in die Höhe, als wenn sie sagen wollte ›läuft super heute‹.
Bürkle wollte der überaus gut aussehenden Frau gerade etwas zurufen, als er hinter sich eine vertraute Stimme hörte: »Würde Ihren Stimmbändern nicht eher ein heißer Tee mit Honig gut tun?«
Er drehte sich um. Hinter ihm stand eine hochgewachsene Frau. Sie trug hochhackige, elegante Lederschuhe, einen hellbraunen Wildlederrock, der ihr bis zu den Knien reichte, eine weiße Bluse und eine zum Rock passende taillierte Jacke.
Nicht schlecht, dachte Bürkle.
»He, ich bin Rock’n’Roller. Tee wäre mein Tod«, gab er übertrieben cool zurück.
Sie schaute ihn mit hochgezogenen Augenbrauen an. Ein verschmitztes Lächeln umspielte ihre Lippen.
»Antonia, es freut mich, dass Sie gekommen sind«, sagte Bürkle zu der jungen Frau.
»Ich kann mir doch nicht entgehen lassen, wenn mein Kollege sein legendäres Konzert im Schlosskeller zu Marbach gibt«, sagte sie und lehnte sich an den Bartresen. »Mir wurde gesagt, dass hier Roxxys bestes Konzert des Jahres gespielt wird.«
»So? Sagt man das?« Bürkle schaute verlegen zu Boden.
Komplimente waren etwas, mit dem er schwer umgehen konnte. Schnell wechselte er das Thema: »Möchten Sie etwas trinken? Geht selbstverständlich aufs Haus.«
»Wenn Sie mich so fragen, ich würde auch ein kaltes Weizenbier nehmen«, sagte Ronda.
»He, Jo, mach noch ein Weizen. Geht auf mich«, rief Bürkle abermals über die Theke. Der junge Mann mit den kurz geschorenen Haaren und dem Lippenpiercing hob kurz den Zeigefinger, um zu fragen, ob er ein Glas haben möchte. Durch die laute Pausenmusik war es schwer, sich in dem Raum über weitere Entfernungen zu unterhalten.
Bürkle nickte.
Der gehobene Zeigefinger bog sich in die Horizontale und zeigte auf Ronda. Kurz darauf reckte der Barkeeper, begleitet von einem zustimmenden Kopfnicken, den Daumen in die Höhe.
Bürkle rollte mit den Augen und winkte ab.