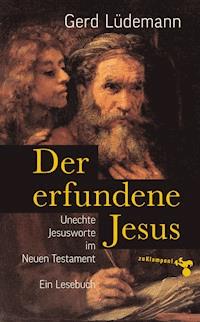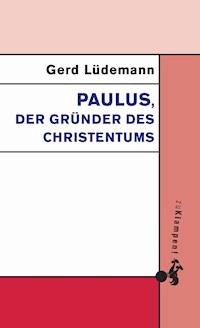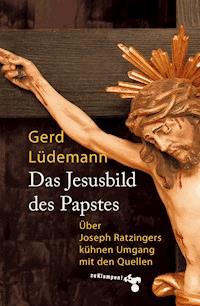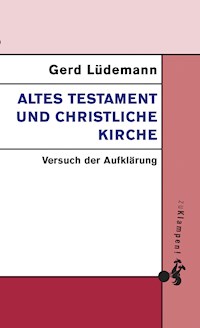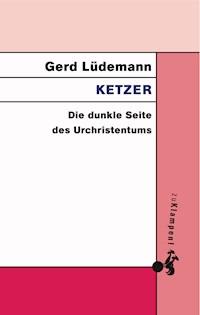
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: zu Klampen Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Das frühe Christentum zeichne sich durch große Harmonie aus und Ketzer seien erst viel später aufgetreten: so die weitverbreitete Meinung in Kirche und Wissenschaft. Eine unhaltbare Sicht und nichts weniger als Wunschdenken damaliger Ketzerbestreiter wie vieler heutiger Theologen. Unter Verwendung aller verfügbarer Quellen zeigt Gerd Lüdemann, dass häufig nicht die Rechtgläubigkeit der Ketzerei, sondern die Ketzerei der Orthodoxie vorausging. Machtfragen standen meist im Mittelpunkt des Interesses, und keine Seite schreckte vor Gewalt oder Fälschungen zurück.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 591
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gerd Lüdemann
Ketzer
Die dunkle Seite des Urchristentums
2., verbesserte Auflage
© 2016 zu Klampen Verlag ∙ Röse 21 ∙ 31832 Springe
www.zuklampen.de
Umschlaggestaltung: GROOTHUIS. GESELLSCHAFT DER IDEEN UND PASSIONEN MBH für Kommunikation, Marketing und Gestaltung
Satz: Germano Wallmann ∙ Gronau ∙ www.geisterwort.de
1. digitale Auflage: Zeilenwert GmbH 2016
Dieses Buch ist zuerst 1996 im Radius Verlag unter dem Titel
Ketzer. Die andere Seite des frühen Christentums erschienen.
ISBN 978-3-86674-478-3
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ‹http://dnb.dnb.de› abrufbar.
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Vorwort
Verständigung mit der Leserschaft
Kapitel 1: Einleitung, Methode und Interesse
Kapitel 2: Irenäus von Lyon und Tertullian von Karthago, die wichtigsten Ketzerbestreiter aus der christlichen Frühzeit
Kapitel 3: Wie aus Ketzerbestreitern Ketzer wurden oder: Die Jerusalemer Judenchristen in den ersten beiden Jahrhunderten
Kapitel 4: Der einzige Ketzer aus der ältesten Zeit oder: Ein menschlicher Paulus
Kapitel 5: Ketzereien um das Pauluserbe
Kapitel 6: Der Erzketzer Markion und seine Zeit
Kapitel 7: Ketzereien im johanneischen Schrifttum
Kapitel 8: Die Entstehung des apostolischen Glaubensbekenntnisses
Kapitel 9: Die Entstehung des neutestamentlichen Kanons
Kapitel 10: Das Christentum der ersten beiden Jahrhunderte, Jesus und wir
Anhänge:
1. Justin, Dialog mit dem Juden Tryphon 46,1–2; 47,1–5
2. Der 3. Korintherbrief
3. Der Rheginusbrief aus Nag Hammadi
Beigaben zur Forschungslage:
1. Die Aufnahme von Walter Bauers Buch über Rechtgläubigkeit und Ketzerei
2. Die Jerusalemer Judenchristen
3. Paulus
4. Falsche Verfasserangaben im frühen Christentum
5. Die Pastoralbriefe
6. Der 3. Korintherbrief
7. Markion
8. Johanneische Schriften
9. Das apostolische Glaubensbekenntnis
10. Die Entstehung des neutestamentlichen Kanons
Literaturverzeichnis
Anmerkungen
Vorwort
Auf vielfachen Wunsch lege ich hiermit die 2. Auflage meines Buches »Ketzer. Die andere Seite des frühen Christentums«. (1. Aufl. 1995) vor. Ich nutze dabei die Gelegenheit, einen neuen Untertitel einzuführen. Er lautet nun: »Die dunkle Seite des Urchristentums« und betont so dessen Anteile am Irrationalen in den ersten beiden Jahrhunderten n. Chr.
Für den Druck habe ich die 1. Auflage durchgesehen sowie Literatur ergänzt und gestrichen. Abgekürzt zitierte Titel sind im Literaturverzeichnis jeweils vollständig nachgewiesen.
Die Arbeit ist in mancher Hinsicht ein Fachbuch mit einem reichen Anmerkungsapparat, der jetzt unter dem Haupttext steht. Ich habe die Schrift so abgefasst, dass interessierte Nicht-Theologen die Gedanken nachvollziehen und sich ein eigenes Urteil bilden können. Angesichts der rechtlichen Bindung der deutschen universitären Theologie an das Dogma der Kirche ist das auch bitter nötig.
Walter Höfig danke ich für eine kritische Durchsicht des Textes.
Gerd Lüdemann
Verständigung mit der Leserschaft
Der Gegenstand dieses Buches beschäftigt mich seit der Promotion in Göttingen im Jahr 1975 über Simon den Magier1. Von ihm ist zuerst in Apg 8 die Rede. Er gilt als erster christlicher Ketzer. In der Folgezeit habe ich das Thema in mehreren Monographien und Aufsätzen weiter vertieft.2
Einzelne Kapitel entstanden während der Mitarbeit am McMaster-Forschungsprojekt über »Normative Selbstdefinition im frühen Christentum und Judentum« in Hamilton/Ontario (1977–1979), andere bildeten die Grundlage von Vorträgen in der June Ramsey Sunday School Class der First Presbyterian Church in Nashville/Tennessee und wurden später in Vorlesungen sowie Seminaren an der Vanderbilt Divinity School und in Göttingen weiter ausgearbeitet.
Die z. T. heftigen Auseinandersetzungen in Kirche, Theologie und Öffentlichkeit um mein Buch »Die Auferstehung Jesu. Historie, Erfahrung, Theologie«3 sind der Kontext, dem dieses Werk angehört. In der genannten Kontroverse wurde eine schwerwiegende Unwissenheit4 der Kritiker im geschichtlichen Bereich deutlich, gleichzeitig aber auch ein Auseinanderbrechen von Glaube und Wissenschaft. Aus Interesse an der historischen Wahrheit und am Christentum selbst schien es nötig, nach der Auferstehung einen weiteren Pfeiler von Kirche und Theologie, und zwar die Heilige Schrift und ihre Autorität, unter die Lupe zu nehmen.
Ausgangspunkt dieser Untersuchung ist die bereits von Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781) in seinem Streit mit dem Hamburger Hauptpastor Johann Melchior Goeze (1717–1786) entwickelte Einsicht, dass christlicher Glaube und christliche Kirche bereits bestanden, bevor es eine heilige Schrift des Neuen Testaments gab.5 Demnach ist »das Neue Testament … ein Werk der katholischen Kirche, und die Berufung auf neutestamentliche Schriften als an sich glaubensverbindlich … ein Dogma der katholischen Kirche. Daraus mag … jeder den Schluss ziehen, den er für gut und richtig hält.«6
Demgegenüber kann man den Eindruck gewinnen, dass dies in Kirche und Theologie zwar bekannt, aber in seinen Konsequenzen nicht erfasst und der Öffentlichkeit verschwiegen worden ist.
Es steht aber nun einmal fest: Die Heilige Schrift ist eindeutig Menschenwort (und nicht Gotteswort), von Menschen zu einer Zeit zusammengestellt, als das Christentum seine Anfänge bereits hinter sich gelassen hatte. Sie ist die Sammlung der siegreichen Partei, die die Dokumente der unterlegenen Gruppen aussortiert, unterdrückt und schließlich vernichtet hat.7
Gerade unter diesem Gesichtspunkt sind die aufsehenerregenden Funde im oberägyptischen Nag Hammadi von 1945, welche über die jüngste Diskussion um die Schriftrollen vom Toten Meer8 in den Hintergrund getreten und seit 1977 vollständig in englischer Übersetzung zugänglich sind9, ein unentbehrliches Korrektiv, um bei gleichzeitiger Berücksichtigung der schon vorher vorhandenen Quellen eine unparteiliche Sicht der christlichen Anfänge zu gewinnen. Während die Forschung sich vor dem Nag-Hammadi-Fund fast ausschließlich damit begnügen musste, aus polemischen Traktaten der Kirchenväter die von ihnen bekämpften Lehren zu erschließen, hat sich die Lage nunmehr gründlich geändert. Die »Ketzer« sprechen für sich selbst, und wir erhalten Gelegenheit, ja, sind in die Pflicht genommen, unsere Vorstellungen von den christlichen Ursprüngen zu prüfen und zu korrigieren.10
Fast möchte man in Anlehnung an Friedrich Nietzsche sagen, dass wir uns durch diese Funde in Bezug auf die Geschichte des Urchristentums wieder im Jugendzeitalter der Wissenschaft befinden und der Wahrheit wie einer schönen Fee, die uns geradezu verzaubert, nachgehen können. »(W)ie anders reizt dies an, als wenn alles Wesentliche gefunden ist und nur noch eine kümmerliche Herbstnachlese dem Forscher übrigbleibt (welche Empfindung man in einigen historischen Disziplinen kennenlernen kann).«11
Ich habe das vorliegende Buch aber auch publiziert, um den Blick auf Jesus zu lenken, und zwar aus der Überzeugung heraus: Das Christentum aller Zeiten muss sich zu Jesus von Nazareth in eine Beziehung setzen können, wenn es glaubwürdig sein will. Dies gilt für die Anfänge der christlichen Religion, die an Jesus zu messen sind, ebenso wie für alle späteren Entwicklungen. Diese Berufung auf Jesus kann heute allerdings nicht ohne Folgen sein, sondern verlangt der theologischen Wissenschaft und der Kirche nach Jahrzehnten massiver Beeinflussung durch Kerygma- bzw. dialektische Theologie Veränderungen ab.12
Im Folgenden geht es aber auch darum, eine andere, unbekannte Seite des Christentums nachzuzeichnen. Ich möchte neugierigen Christen ihr Eigenes als ein Fremdes zeigen, um so zum eigentlich Christlichen hinzulenken.
Kapitel 1: Einleitung, Methode und Interesse1
Die Geschichte des Urchristentums2 will den historischen Ablauf der ersten beiden christlichen Jahrhunderte darstellen. Sie behandelt die durch Jesu Auftreten eingeleitete erste Phase der Kirchengeschichte. Ihr Ende3 liegt dort, wo der Konsolidierungsprozess der frühchristlichen Gruppen abgeschlossen ist, dogmatische und ethische Normen über richtig und falsch, gut und böse sowie der Kanon entwickelt worden sind, mit der Entstehung des monarchischen Episkopats eine Machtstellung der frühchristlichen Gemeinden bzw. ihres Bischofs gegenüber Gegnern ausgebildet ist und sich Sanktionen wirklich durchsetzen lassen.4 Diese Abgrenzung lässt sich weiter historisch damit begründen, dass gegen Ende des 2. Jh.s ein Versiegen der mündlichen, mit Jesus genetisch zusammenhängenden Traditionen festzustellen ist und sich wissenschaftliche christliche Theologie – wenn sie mehr als bloße Rekonstruktion von Vergangenheit ist – durch Rückbezug auf Jesus ihrer Ursprünge vergewissern5 muss.6 Das trifft selbst angesichts des Befundes zu, dass nicht geringe Teile der frühchristlichen Literatur, wie z.B. die Briefe des Ignatius von Antiochien7, ohne Rückgang auf den historischen Jesus auskommen, denn dieser bleibt – geschichtlich gesehen – der entscheidende Auslöser der christlichen Bewegung.8
In dieser Phase des frühen Christentums wurden die Weichen für das gestellt, was man später als christlich ansah. In ihr schälte sich das Christentum als eigene Erscheinung heraus. Für sie gilt, was Johann Salomo Semler (1725–1791) zuerst entdeckt9 und Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781) weiter vertieft hat, dass es in dieser Zeit schon christlichen Glauben und eine christliche Kirche gegeben hat, bevor überhaupt ein Neues Testament existierte.10 Insofern behält die Geschichte des Urchristentums eine herausragende Bedeutung gegenüber den nachfolgenden Epochen. An ihr können grundlegende christliche Prinzipien erkannt werden, und nur in dieser Phase des Christentums finden sich Jesustraditionen, die nicht ausschließlich literarisch (etwa durch Evangelien) vermittelt sind. Diese Frühzeit des Christentums ist rein historisch zu erforschen – fast könnte man sagen, sie sei zunächst unsere Bibel –, ist doch das Schriftprinzip11 durch die Auflösung des Inspirationsdogmas für die wissenschaftliche Theologie ein für allemal zur vergangenen Größe geworden.
Dies sei in enger Anlehnung Wolfhart Pannenbergs Aufsatz »Die Krise des Schriftprinzips« aus dem Jahr 1962 erläutert.12 Unter Berufung auf den exegetisch eindeutigen Wortsinn der Schrift habe Luther den Kampf gegen das päpstliche Lehramt aufgenommen, und zwar in der Überzeugung, seine eigenen exegetischen Ergebnisse seien identisch mit der »›Sache‹ der Schrift, wie sie in der Person und Geschichte Jesu Christi zusammengefaßt und in den Dogmen der Kirche entfaltet ist«. (S.14). Diese Gewissheit lag seinem hermeneutischen Grundsatz von der Selbstevidenz oder Klarheit der Schrift zugrunde.13
»Die Lehre von der Klarheit der Schrift führte notwendig zu der Forderung, daß jeder theologische Satz durch historisch-kritische Schriftauslegung zu begründen sei«. (S.14f). Gleichwohl habe die historisch-kritische Exegese die Grundlagenkrise heraufbeschworen, vor der wir heute ständen. War für Luther der Wortsinn der Schriften noch identisch mit ihrem historischen Gehalt, so sei hingegen für uns beides auseinandergerückt; »das Bild der verschiedenen neutestamentlichen Verfasser von Jesus und seiner Geschichte kann nicht mehr ohne weiteres als identisch mit dem tatsächlichen Hergang der Ereignisse gelten … Luther konnte noch seine eigene Lehre mit dem wörtlichen Inhalt der biblischen Schriften gleichsetzen. Für uns hingegen ist der historische Abstand jeder heute möglichen Theologie vom urchristlichen Zeitalter unübersehbar und zur Quelle der uns am meisten bewegenden theologischen Probleme geworden«. (S.15).
Anders gesagt: Die Kluft zwischen historischem Faktum und seiner Bedeutung, zwischen Historie und Verkündigung, zwischen Geschichte Jesu und dem vielfältigen Bild von seiner Geschichte im Neuen Testament14 macht es unmöglich, die Inspiriertheit der ntl. Schriften ernsthaft weiter zu vertreten oder gar Wort Gottes und Heilige Schrift gleichzusetzen.15
Abgrenzungen und positive Konstruktion
Aus diesen Einsichten ergeben sich drei polemische Abgrenzungen und entsprechende Konsequenzen für den Ansatz des vorliegenden Buches:
Die erste Abgrenzung bezieht sich auf eine Wort-Gottes-Theologie, nach der »eine methodisch zu erhebende autoritative Offenbarung dem christlichen Lehrvortrag einen objektiven Grund verleihe.«16 Hier werden dogmatische Inhalte vorausgesetzt, die der geschichtlichen Frage gar nicht mehr zugänglich sind, und jegliche historische Untersuchung sieht sich zur Hilfswissenschaft herabgestuft. Denn solche verobjektivierende Theologie gerät früher oder später in den Bann des Supranaturalismus und überspringt damit nicht nur die Geschichtlichkeit antiker Menschen, von denen die biblischen Schriften verfasst wurden, sondern auch die Geschichtlichkeit heutiger Zeitgenossen, die das Wort von damals vernehmen. Für solche dogmatische Theologie ist das schillernde, funkelnde Leben, das zu erfassen sich die historische Betrachtung bemüht, dann nur noch farb- und bedeutungslos.
Die zweite Abgrenzung betrifft eine Kerygmatheologie17, nach der Theologie im wesentlichen Schriftauslegung ist.18 Ihre Vertreter lehnen es ab, schwerpunktmäßig auf die Geschichte hinter den Texten zu sprechen zu kommen19, in der die ntl. Verkündigung wurzelt. Dies sei historisch vielleicht interessant, theologisch aber illegitim, da »alle den Text hinterfragende Rekonstruktion nur so lange ihr Daseinsrecht behält, als sie sich der den Text respektierenden Interpretation kompromißlos unterordnet.«20 Statt der Aufgabe einer historischen Rekonstruktion wollen sie sich bewusst der Anrede und dem Anspruch der ntl. Zeugen stellen und beziehen hieraus das Unterscheidungskriterium zwischen Theologie und Historie.21 Nicht zufällig hat diese Richtung auch keine eigentliche Geschichte des Urchristentums hervorgebracht.22
Die dritte Abgrenzung richtet sich gegen eine Forschungsrichtung, die historisch-kritische Arbeit mit einer heilsgeschichtlichen Sicht verbinden will. So setzt z.B. Leonhard Goppelt23 voraus, dass allein die »heilsgeschichtliche« Schau das Verhältnis von Christentum und Judentum zutreffend in den Blick bekommen könne. Aber so historisch Goppelts Werk auch angelegt und so lehrreich »die Entwicklung des Verhältnisses von Christentum und Judentum bis zum Werden der katholischen Kirche am Ende des 2. Jh.s«. (S.15) gezeichnet ist – sein Vf. postuliert eine heilsgeschichtliche Kontinuität, eine Erfüllung des alten Bundes in Christi Werk (S.319) und damit eine bloße Ersatztheorie.
Z. B. heißt es: »Tatsächlich ist die Ablehnung des Evangeliums durch Israel als Volksgemeinde die letzte entscheidende Wende seiner Geschichte und die … letzte Ursache der zweiten Tempelzerstörung«. (S.311). Eine solche für alle Juden der Folgezeit niederschmetternde Sicht ist doch nur ein dogmatisch-triumphalistisches Postulat christlicher Theologie und keineswegs Ergebnis historischer Forschung, sosehr anzuerkennen bleibt, dass hier wenigstens anders als in der Kerygmatheologie die Erforschung der Geschichte der ersten beiden Jahrhunderte als Aufgabe erkannt und über die Grenze des Kanons hinausgegangen wurde.24
Das Kanonprinzip25 führt im Übrigen ja trotz aller Differenzierungsversuche (z.B. »Kanon im Kanon«) praktisch dazu, den in ihm eingeschlossenen Schriften eine größere Würde zuzuschreiben (vgl. die Anzahl der zu den einzelnen kanonischen Schriften verfassten Kommentare im Vergleich zu denen über nichtkanonische Schriften) und die Geschichte zu einer Geschichte der Sieger zu machen. In dieser Hinsicht behält Gustav Krüger Recht:
»Die Existenz einer neutestamentlichen Wissenschaft oder einer Wissenschaft vom Neuen Testament als einer besonderen theologisch-geschichtlichen Disziplin ist ein Haupthindernis erstens einer fruchtbaren, zu gesicherten und allgemein anerkannten Ergebnissen führenden Erforschung des Urchristentums, also auch des Neuen Testaments selbst, und zweitens eines gesunden theologisch-wissenschaftlichen Unterrichtsbetriebes.«26
Denn es ist ein Gebot geschichtlicher Gerechtigkeit, zunächst alle uns aus der Anfangsphase des Christentums erhaltenen Schriften zu akzeptieren und nicht von vornherein geschichtliches Verstehen durch die dogmatische Setzung einer heiligen Schrift zu verhindern. Das ist aber heute leider der Fall, da die zeitgenössische theologische Literatur zum großen Teil parteilich, d.h. kirchlich bzw. klerikal ausgerichtet ist.27
Diese Klerikalisierung wird erstens dadurch begünstigt, dass Althistoriker und Altphilologen sich hierzulande, von Ausnahmen abgesehen, im Allgemeinen nicht an der Exegese beteiligen, und zweitens dadurch, dass Nicht-Getauften der Zugang zur theologischen Universitätslaufbahn verschlossen ist. Man beachte zusätzlich, dass Menschen ohne Taufschein nicht die staatliche (!) theologische Diplomprüfung an den theologischen Fachbereichen ablegen dürfen und z.B. Juden nicht den theologischen Doktorgrad über ein ntl. Thema an einem theologischen Fachbereich erwerben können. Drittens wird vielfach vorausgesetzt, die Theologie sei eine kirchliche Wissenschaft.28 Diese weitverbreitete Auffassung hat die Forschung mehr behindert als gefördert.29
Demgegenüber gilt ein Satz, der zunächst brutal klingt: »(E)ine Wissenschaft vom christlichen Glauben ist so wenig christlich, wie die Wissenschaft vom Verbrechen verbrecherisch ist.«30 Denn Theologie als Wissenschaft ist zunächst einmal unkirchlich31, indem sie nach der Wahrheit sucht.
Im Übrigen bejaht protestantisches Christentum die radikale Wahrheitsforschung aus vollem Herzen, und »so viel weiss man bei allen kirchlichen Richtungen von evangelischem Christenthum, dass es da ein Ende hat, wo die Furcht vor der Wahrheit anfängt, zu herrschen.
Eine Kirche, die sich um der Seligkeit willen gegen die Forschung nach der Wahrheit absperrt, gründet zwar tief in der menschlichen Natur, aber nicht in Jesus Christus. Sie ist überhaupt nicht christliche Kirche.«32
Viertens zielen die meisten exegetischen Beiträge heutzutage künstlich auf den theologischen Sinn, den Skopus der ntl. Texte. Die Kanonfrage bleibt stillschweigend unerörtert, so als ob ihr Sinn auch ohne solide historische Grundlagen zu finden wäre. Sie setzen oft unbewusst voraus, die Vernunft sei durch die Offenbarung bzw. durch das Kerygma zu belehren und zu begrenzen. Das bedeutet dann »in der Praxis nichts anderes als Klerikalismus. Denn Vernunft gilt entweder ganz oder gar nicht.«33
In diesem Zusammenhang wird oftmals betont, dass Exegese eine Sache des Gehorsams sei.34 Aber wenn schon Predigtsprache einfließt, dann würde ich eher Wolfgang Schenk darin folgen, dass Exegese »zuerst und vor allem Sache der Liebe (sc. ist), die jeden Menschen und jeden Text ausreden und das sagen läßt und zu verstehen sucht, was er selbst meint, ohne ihn damit zu überfahren.«35
Es ist in der Tat so, dass viele Werke heutiger Exegese blutleer wirken und über der Ermittlung der Absicht des Textes, dem Vergleich der einzelnen Evangelien untereinander und einer säuberlichen Trennung von Redaktion und Tradition vergessen machen, dass die frühchristlichen Schriften einer Bewegung entstammen, die – vor Vitalität nur so strotzend – innerhalb von eineinhalb Jahrhunderten das ganze Römische Reich fast überrannt hat. Ein Anflug von Unwirklichkeit liegt so über den meisten Arbeiten zum Neuen Testament.36 Vielfach zieht man es vor, dunkle religiöse Abstraktionen zu gebrauchen, statt in den historischen Einzelheiten konkret zu werden.37 Man kann sich deshalb des Eindrucks nicht erwehren, dass die herkömmlich angewandte Methode die Texte ihrer Kraft beraubt.
Andererseits ist mit Gerhard Ebeling zu fragen, »ob nicht die weit verbreitete entsetzliche Lahmheit und Abgestandenheit der kirchlichen Verkündigung, ob nicht ihr Unvermögen, den Menschen der Gegenwart anzureden, ob nicht ebenso die Unglaubwürdigkeit der Kirche als solcher in hohem Maß damit zusammenhängt, dass man sich davor fürchtet, die Arbeit der historisch-kritischen Theologie in sachgemäßer Weise fruchtbar werden zu lassen.«38 Dabei braucht man die Bejahung der historisch-kritischen Methode gar nicht in einen inneren Zusammenhang mit der Rechtfertigungslehre zu bringen (so Ebeling), sondern wird sie als profanes, christliches Gebot der Wahrhaftigkeit bzw. der »Sittlichkeit des Denkens«. (Friedrich Albert Lange, 1828–1875) auffassen.
Meine Arbeit setzt in ihrer Darstellung urchristlicher Geschichte absichtlich »unten« an, d.h., ich bemühe mich um eine Humanisierung der Geschichte des Urchristentums, damit heutige Zeitgenossen sich in ihr wiedererkennen. So hat bereits der erste Kanzler der Universität Göttingen, Johann Lorenz von Mosheim (1694–1755), von der Aufgabe der Kirchengeschichtsschreibung ähnlich gedacht.39
Dieser »Vater der neueren Kirchengeschichtsschreibung« hält z.B. die Bekehrung der vielen Menschen vom Heidentum zum Christentum nicht für eine Folge der Wunder – wie damalige supranaturale Kirchengeschichtsschreibung weismachen wollte –, sondern für die Folge der Furcht vor Strafen und der Hoffnung auf ein glückliches Leben im Jenseits. Die so gehandhabte pragmatische Methode hat bei Mosheim eine ungeheure Vermenschlichung des kirchenhistorischen Prozesses zur Folge gehabt. Eine solche quasi anthropologische Kirchengeschichtsbetrachtung bedeutete auch für die Geschichte des Urchristentums eine kopernikanische Wende40, denn fortan war auch hier ein Rekurs auf den heiligen Geist oder den erhöhten Christus als supranaturale Größen unmöglich gemacht worden41, umso mehr, als im »Sinne Mosheims … die Kirchengeschichte ein innerweltlicher und insoweit durchschaubarer eher pragmatischer Geschehenszusammenhang«42 ist.
Allerdings rechnet eine so verstandene Kirchengeschichtsschreibung43 nicht mit einem besonderen Einwirken Gottes zu einzelnen Zeitpunkten der Geschichte. Den in diesem Zusammenhang oft zu hörenden Einwand44, jede Geschichtsschreibung habe ihre Voraussetzungen, und so setze die theologische Kirchengeschichtsschreibung voraus, dass Gott in den Geschichtslauf eingreife, halte ich für verfehlt. Natürlich ist jede Geschichtsschreibung subjektiv gefärbt. Doch ist daraus lediglich die Forderung abzuleiten, sich dieser Voraussetzung bewusst zu werden45, nicht aber unter der Hand quasi zu einem deus ex machina Zuflucht zu nehmen.
Auch wird gefordert: Wer die Geschichte des Christentums erforsche, müsse gläubig, konfessionell sein. Doch schließt eine solche Forderung die Augen vor dem wirklichen historischen Geschehen.
Der Historiker, der beständig ein dogmatisches Gewicht in die Waagschale legt, um seinen historischen Gegenstand zu wägen, entbehrt des eigentlichen geschichtlichen Verständnisses, das vor allem erforschen, entdecken, aufspüren, prüfen und verstehen will und – wenn überhaupt – erst in zweiter Linie wertet. Z. B. ähneln die Beurteilungen der Kirchenväter nach einem bestimmten dogmatischen Maßstab eher einem nachträglichen Herumdoktern, dem nicht mehr Sinn beizumessen ist als dem Unternehmen eines Arztes, der heutzutage die alten Griechen und Römer von den Krankheiten heilen will, an denen sie gestorben sind. Ein solches Unternehmen kann nur als Ausbund von papierener Gelehrsamkeit bezeichnet werden.46
Echte Geschichtsforschung will vor allem ihrem Gegenstand gerecht werden, ihn lebendig beschreiben, statt ihn nach von außen bezogenen Kriterien zu richten. Das schließt aber die Beschreibung des inneren Problemgehalts, der internen Spannungen des Betrachteten nicht aus, sondern ein.
Die Wissenschaft lebt in und von ihren Methoden, aber das heißt nicht, dass sie in diesen Methoden aufgeht und dass »sie ohne weiteres ihr ihren Wert verleihen. Denn es gibt gute und schlechte Methoden, und nur die kritischen sind gut, vor allem diejenigen, deren Bevorzugung die Wissenschaft ihre Selbstkritik verdankt.«47 Eine allgemeingültige Methode, die für jede Quelle passt, gibt es nicht. Sie ist in der Geschichtsforschung auch gar nicht zu erwarten, da diese nicht mit einer vorher feststehenden Meinung an den Stoff herantritt, sondern aus dem Gegenstand selbst erwächst und sich selbst ständig daraufhin überprüft, ob sie dem Objekt gerecht wird.
Dabei ist nichts lähmender für die historische Kritik, als die Lösung der geschichtlichen Probleme außerhalb ihrer oder gar in einem Eingreifen Gottes zu suchen. Es muss ein selbstverständlicher methodischer Grundsatz sein, das Unbekannte zunächst aus dem Bekannten herauszufinden. Wir setzen bei den Tatsachen ein48, um von dort auf weniger Sicheres zurückzuschließen.49
Meine im Anschluss an Franz Overbeck50 entwickelte Idee einer profanen Kirchengeschichte mündet ein in die Forderung: Entheiligt und gereinigt von allen kirchlich-theologischen Sonderbestimmungen und Erkenntnisprivilegien, »in reiner Weltlichkeit und, wie die wörtliche Übersetzung des Wortes profan lautet, in ›Ruchlosigkeit‹ soll der kirchenhistorische Prozeß verfolgt werden.«51
Damit ist noch nichts über die Wahrheit oder Unwahrheit, über die Wirklichkeit oder Unwirklichkeit des zu beschreibenden Objektes ausgesagt. »Die profane Kirchengeschichte beruht nicht auf der Annahme, daß das religiöse Leben der Menschen ein Irrtum sei, wohl aber setzt sie voraus, daß es möglichst ohne Vorurteile erforscht werden müsse.«52
Allerdings meine ich, dass, wenn Gott sich in Jesus von Nazareth den Menschen gezeigt hat, die profane Kirchengeschichtsdarstellung als ehrliche Wahrheitsforschung ihrem Gegenstand nicht entgegenstehen wird. Im Anschluss an Erich Seeberg gesagt: »Ich möchte meinen, daß die geschichtliche Arbeit imstande ist, ein geschichtliches Bild vom Christentum zu erzeugen, das gewissermaßen wie ein Urbild selbst produktiv wirkt.«53
Nun ist klar, dass zur Verarbeitung des riesigen historisch-literarischen Materials – auch in den ersten beiden christlichen Jahrhunderten – über die bereits gegebene Bestimmung einer Geschichte des Urchristentums hinaus die Aufgabe sinnvollerweise von einer bestimmten Fragestellung aus zu erfolgen hat. So könnte der leitende Gesichtspunkt z.B. der Kult bzw. der Gottesdienst oder die Liturgie sein54, ein anderer die Theologie55, ein weiterer die religionsgeschichtliche Frage, wie sich in den ersten beiden Jahrhunderten die Hellenisierung des Christentums als einer ursprünglich jüdischen Religion vollzog.56 Zugleich ist auf die Wichtigkeit der lokalen Frühgeschichte hinzuweisen (Rom57, Korinth58, Ephesus59, Philippi60, Antiochien61, Alexandrien62 usw.).
Die letzte Ketzergeschichte des Urchristentums entstammt der Feder des Jenenser Professors Adolf Hilgenfeld aus dem Jahre 188467 und ist gewissermaßen Ausläufer einer Vielzahl von Ketzerhistorien, die allerdings z. T. die ganze Kirchengeschichte umspannen.68 Sein Werk orientiert sich daran, welche Gruppen von der katholischen Kirche als Häretiker angesehen wurden, und beginnt nach einem Überblick über die antihäretischen Schriften der ersten Jahrhunderte mit Simon, dann folgen Menander, Satornil, Basilides usw.69
Diese Vorgehensweise, die in etwa der seiner Vorgänger entspricht, strebe ich hier nicht an. Ich orientiere mich im Folgenden vielmehr an der Fragestellung des Göttinger Patristikers und Neutestamentlers Walter Bauer, der im Jahre 1934 ein wahrhaft denkwürdiges Werk veröffentlichte: »Rechtgläubigkeit und Ketzerei im ältesten Christentum«. In der Einleitung dieses leidenschaftlich geschriebenen Buches führt Bauer aus:70
»Es ist für uns heute doch wohl keinem Streit mehr unterworfen, daß die neutestamentlichen Schriften wissenschaftlich nicht zu verstehen sind, wenn man vom Ende des kanonbildenden Prozesses auf sie als auf heilige Bücher zurückblickt und sie nun als Bestandteil der überirdischen Heilsurkunde mit allen daraus sich ergebenden Eigenschaften wertet. Wir haben uns längst angewöhnt, sie aus ihrer Zeit heraus zu begreifen, die Evangelien als mehr oder weniger gelungene Versuche, das Leben Jesu zu erzählen, die Paulusbriefe als Gelegenheitsschriften, an bestimmte, unwiederholbare Sachlagen gebunden mit örtlicher wie zeitlicher Beschränkung ihres Geltungsbereiches. So müssen wir auch den ›Ketzern‹ gegenübertreten. Auch sie wollen wir aus ihrer Zeit heraus erfassen und messen sie nicht an einer werdenden oder gar der späterhin fertiggewordenen Kirchenlehre als dem Normalmaßstab …
Um alle modernen Stimmungen und Urteile von vornherein auszuschließen, gehe ich von der Auffassung aus, welche die alte Kirche bereits im 2. Jahrhundert bezüglich der Ketzer und ihrer Lehren hegt, und prüfe sie auf ihre Haltbarkeit in der Hoffnung, bei solchem kritischen Verfahren einen Weg zum Ziel zu finden. Der kirchliche Standpunkt umfaßt etwa die folgenden Hauptgesichtspunkte:
1. Jesus offenbart die reine Lehre seinen Aposteln, teils vor seinem Tode, teils in den vierzig Tagen vor der Himmelfahrt.
2. Nach seinem endgültigen Scheiden teilen die Apostel die Welt unter sich und jeder bringt dem Lande, das ihm zugefallen, das unverfälschte Evangelium.
3. Auch nach dem Tode der Jünger breitet sich dieses weiter aus. Doch erwachsen ihm jetzt Hemmungen innerhalb der Christenheit selbst. Der Teufel kann es nicht lassen, Unkraut in das göttliche Weizenfeld zu säen; und er hat Erfolg damit. Von ihm verblendet geben gewisse Christen die echte Lehre preis. Die Entwicklung vollzieht sich in folgender Weise: Unglaube, Rechtglaube, Irrglaube. Dafür, daß man den Unglauben unmittelbar mit dem vertauschen könne, was die Kirche Falschglauben nennt, zeigt sich kaum irgendwo auch nur eine Ahnung. Nein, wo es Häresie gibt, muß zuvor Orthodoxie bestanden haben. ›Alle Ketzer‹, sagt etwa Origenes, ›kommen zuerst zur Gläubigkeit; später weichen sie dann von der Glaubensregel ab.‹…
4. Natürlich ist der rechte Glaube unüberwindlich. Trotz aller Bemühungen des Satans und seiner Werkzeuge drängt er Unglauben und Irrglauben zurück und greift siegreich immer weiter um sich. An dieser Überzeugung Kritik zu üben, ist der Wissenschaft nicht schwer gefallen. Sie weiß, daß mit Jesus noch nicht die Kirchenlehre da war; ebenso daß die Zwölf Apostel keineswegs die Rolle gespielt haben, die man ihnen aus Rücksicht auf die Reinheit und Offenbarungsmäßigkeit des Dogmas zuweist. Auch weigert sich eine Geschichtsbetrachtung, die diesen Namen verdient, hier die Gegensätze von Wahr und Unwahr, Böse und Gut in Anwendung zu bringen. Von der den Ketzern nachgesagten sittlichen Minderwertigkeit läßt sie sich nur schwer überzeugen … Dann jedoch kommt früher oder später ein Punkt, an dem die Kritik erlahmt. Allzu leicht … beugt sie sich der kirchlichen Meinung über das Früh und Spät, das Ursprünglich und Abhängig, das Wesentlich und Unwichtig für die Urgeschichte des Christentums. Ist mein Eindruck zutreffend, so geht die ganz überwiegend geteilte Auffassung auch heute dahin, daß schon für die Anfangszeit die Kirchenlehre – natürlich nur auf irgendeiner Stufe der Entwicklung – das Primäre darstellt, die Häresien dagegen irgendwie eine Abwandlung des Echten sind. Ich will nicht sagen, daß diese Anschauung falsch sein müsse, aber ich kann sie ebensowenig für selbstverständlich oder gar für bewiesen und sichergestellt ansehen. Vielmehr liegt hier ein Problem vor, um das man sich mühen muß.«71
Bauers Methode wurzelt ganz im Historismus, der von einer Autonomisierung des historischen Bewusstseins72 geprägt ist. Sie setzt die Gültigkeit historischer Fakten voraus und scheut sich nicht, wissenschaftliche Erkenntnisse mit kirchlichen Behauptungen kritisch zu konfrontieren.73 Bauer ist demnach ebenfalls Vertreter einer profanen Kirchengeschichtsschreibung,74 deren Aktualität und Fruchtbarkeit im Folgenden zu erweisen sein wird.
Die Übernahme seines Ansatzes bedeutet nicht, dass ich mit den Einzelergebnissen seiner Arbeit stets übereinstimme. So waren am Ende des 2. Jh.s die ketzerischen Lehren bzw. das, was die offizielle Kirche als häretisch ansah, nicht unbedingt identisch mit dem, was gewisse Kreise ein Jahrhundert zuvor als ketzerisch betrachteten.75
Auch sind diejenigen Gruppen, die am Ende des 2. und am Ende des 1. Jh.s Ketzerhüte verteilten, in ihrer Theologie nicht automatisch miteinander gleichzusetzen. Wohl aber bedeutet Bauers Fragestellung, die ausgehend vom Ende des 2. Jh.s für die frühe Zeit die Ausdrücke »Ketzerei« und »Rechtgläubigkeit« zunächst rein formal gebraucht, einen fruchtbaren Gesichtspunkt, um der Vielfalt von »Christentümern« in den ersten beiden Jahrhunderten und ihrer Kämpfe untereinander gewahr zu werden. »Rechtgläubigkeit« bezeichnet dann, für die frühe Zeit gebraucht, nur den Anspruch, den rechten Glauben zu besitzen, der ihn anderen, die davon abweichen, abspricht und sie sogleich der Ketzerei bezichtigt. Ferner ist offenbar in manchen Gebieten das, was später als ketzerisch galt, der »Rechtgläubigkeit« vorangegangen.
Diese Erkenntnis Bauers bewährt sich besonders hinsichtlich der ältesten judenchristlichen Gemeinde Jerusalems, deren Nachfahren zu Ketzern erklärt wurden. Sie dürfte aber auch für andere christliche Gruppen zutreffen.
Schließlich stellt sich im Anschluss an Bauers Werk die Aufgabe, darzustellen, wie sich trotz oder gerade wegen der Pluralität christlicher Gruppen in der Frühzeit später eine »rechtgläubige« katholische Kirche mit festen Formen und Institutionen entwickeln konnte, von der die »Ketzerei« endgültig ausgeschieden wurde. Da jedoch seit der Publikation seines Werkes in der zweiten Auflage (1964) der gesamte Handschriftenfund von Nag Hammadi zugänglich ist76, ferner die sog. ntl. Apokryphen mehr beachtet werden77 und überhaupt das 2. Jh. verstärkt das Interesse der Forschung gefunden hat78, ist eine neue Rekonstruktion frühchristlicher Ursprünge sinnvoll, dies um so mehr, als die Herausbildung dessen, was als Neues Testament bekannt ist, in diesem 2. Jh. erfolgte.79 M. a. W., in dieser Zeit – nicht schon im 1. Jh. – schälte sich die grund-legende Entscheidung über die Zusammensetzung der heiligen Schrift der katholischen Christen und über ihre »richtige« Auslegung heraus, die einschneidende Konsequenzen für nichtkatholische Gruppen hatte. Pointiert gesagt: In der Zeit von der ersten christlichen Generation bis zum Ende des 2. Jh.s fielen wichtigere Entscheidungen für die gesamte Christenheit als vom Ende des 2. Jh.s bis heute.
Zum Aufbau des vorliegenden Buches
Das nun folgende Kapitel beschäftigt sich mit zwei ketzerbestreitenden Werken aus dem Ende des 2. bzw. dem Anfang des 3. Jh.s, den fünf Büchern »Gegen die Häresien« des Bischofs Irenäus von Lyon und der »Prozesseinrede gegen die Häretiker« aus der Feder Tertullians von Karthago. Beide Werke haben wesentlich zur »Widerlegung« der von der katholischen Kirche ausgeschiedenen Ketzereien beigetragen und mit ihrem Geschichtsbild, dass angeblich allseits die Orthodoxie der Ketzerei voranging, christliche Theologie fast 2000 Jahre lang zur Selbsttäuschung verleitet und die kritische Forschung davon abgehalten, die christlichen Ursprünge, so wie sie wirklich waren, zu rekonstruieren. Indem ich die Arbeitsweise dieser beiden einflussreichen Ketzerbestreiter genau untersuche und ihre Grenzen aufzeige, will ich ein Stück des Schleiers lüften, der nach wie vor über den ersten beiden christlichen Jahrhunderten liegt.
In Kapitel 3 geht es um die Jerusalemer Judenchristen der ersten beiden Jahrhunderte. Die Überschrift lautet: »Wie aus Ketzerbestreitern Ketzer wurden oder: Die Jerusalemer Judenchristen in den ersten beiden Jahrhunderten«. Sie orientiert sich daran, dass der älteste sichtbare Kampf gegen Andersdenkende von den ersten Christen in Jerusalem ausging. Sie waren es, die faktisch den Begriff der Ketzerei in die Kirche gegen Paulus eingeführt haben, während sich dieser durch eine relativ große Offenheit gegenüber andersdenkenden Christen auszeichnete. »Die noch in den Anfängen stehende Verfestigung der Gedankenbildung im Verein mit der apostolischen Weitherzigkeit, die allen alles werden kann, um alle zu gewinnen, lassen ihn eine Duldsamkeit entfalten, die kaum einen Ketzer kennt.«80
Über die Apostel vor sich schreibt Paulus: »Ob nun ich oder jene, so predigen wir, und so seid ihr zum Glauben gekommen«. (1Kor 15,11).
Angesichts von Widersachern zeigt er sich versöhnlich und bemerkt:
(15) »Einige zwar predigen Christus auch aus Neid und Streit, einige aber auch mit guter Absicht;
(16) die(se) aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin;
(17) die (anderen) aber verkündigen Christus aus Selbstsucht, nicht aufrichtig, in der Meinung, meine Fesseln zu verunglimpfen.
(18) Was tut’s? Nur dass auf jede Weise, sei es zum Schein oder wahrhaftig, Christus verkündigt wird, und darüber freue ich mich.«. (Phil 1,15–18a)
Selbst die Auferstehungsleugner in Korinth (1Kor 15,12) versucht Paulus zu überzeugen, ohne sie aus der Gemeinde auszuschließen. Nur bei einem Verstoß wie dem sexuellen Verkehr zwischen Stiefsohn und Stiefmutter (1Kor 5,1ff) und gegenüber judenchristlichen Widersachern, die in seine heidenchristlichen Gemeinden eingedrungen waren, wird Paulus rabiat. Im letzten Fall spricht er ein konditionales Verdammungsurteil (Gal 1,8f.; vgl. Phil 3,2) als Reaktion81 auf seine eigene Verketzerung hin aus, und im ersten wird »die Übergabe an den Satan« durch die ausdrückliche Aussage der Rettung im Endgericht eingeschränkt.82 Paulus als dem einzigen Ketzer der ältesten Zeit ist daher Kapitel 4 dieses Buches gewidmet.
Die übrigen Kapitelüberschriften ergeben sich daraus, was zum Ketzertum als Gesichtspunkt der Darstellung gesagt wurde, fast wie von selbst. Kapitel 5 stellt die sachlich in zwei Flügel gespaltenen Pauluserben dar, die sich beide ausdrücklich auf den Apostel beriefen, unter Benutzung seines Namens Briefe verfassten bzw. fälschten und von denen der eine Flügel den anderen verketzerte.
Kapitel 6 wendet sich aus sachlichen Gründen im unmittelbaren Anschluss daran Markion zu, dem großen Reformator des 2. Jh.s, der den ersten ntl. Kanon, bestehend aus LkEv und Paulusbriefen (beide jeweils in ihrem »ursprünglichen« Inhalt), zusammenstellte, aber bald als Erstgeborener des Satans verketzert wurde. Kapitel 7 handelt von den chronologisch vor Markion liegenden Ketzereien im johanneischen Schrifttum, wobei die durch einen Glücksfall im 2Joh und 3Joh dokumentierte Spaltung des johanneischen Kreises besondere Aufmerksamkeit erfährt.
Nachdem so an konkreten Personen und Situationen Schlaglichter auf die »Ketzereien« im Urchristentum geworfen worden sind und ihre Geschichte nacherzählt worden ist, wendet sich Kapitel 8 der Frage der Entstehung des apostolischen Glaubensbekenntnisses und Kapitel 9 dem Problem der Ausbildung des ntl. Kanons zu. Damit ist wieder der historische Ausgangspunkt des Buches, der katholische Standort des Irenäus und Tertullians, erreicht und ein Beitrag zur Entstehung der katholischen Kirche geleistet. Von dort richtet sich in Kapitel 10 der Blick zurück auf die Anfänge, Jesus von Nazareth, um das Verhältnis seiner Lehre, seiner Taten und seiner Hoffnungen zu dem, was nach ihm kam, zu klären.
Kapitel 2: Irenäus von Lyon und Tertullian von Karthago, die wichtigsten Ketzerbestreiter der christlichen Frühzeit
I. Irenäus1
Irenäus stammt aus Kleinasien; hier erblickte er vor 142n.Chr. das Licht der Welt. In seiner Jugend war er Hörer des Bischofs Polykarp von Smyrna (Izmir). Später wurde er Presbyter in Lugdunum (Lyon), überbrachte im Jahr 177n.Chr. ein den Montanismus betreffendes Schreiben seiner Gemeinde nach Rom und folgte nach 178n.Chr. Pothinus als Bischof von Lyon nach. Zwei seiner Schriften sind in Übersetzung erhalten, das Anfang des letzten Jh.s entdeckte Alterswerk »Aufweis der apostolischen Verkündigung«2 (in armenischer Sprache) und eine aus dem Ende des 4. Jh.s stammende lateinische Version seines fünfbändigen Ketzerwerkes »Entlarvung und Widerlegung der fälschlich so genannten Gnosis«. (= Haer)3, dessen griechisches Original sich an zahlreichen Stellen wiedergewinnen lässt4, da spätere Ketzerbestreiter wie Hippolyt von Rom5, Epiphanius von Salamis6 und Theodoret von Kyros7 ebenso wie der Kirchenhistoriker Euseb von Cäsarea8 daraus umfangreiche wörtliche Zitate mitteilen.
Zur Anlage von Irenäus’ Werk »Gegen die Häresien«
Das erste Buch will die Lehren der Ketzer ans Licht ziehen und enthält viel wertvolles Traditionsmaterial. Im zweiten Buch setzt sich Irenäus zum Ziel, »in langen Hauptstücken ihre ganze Lehre zu widerlegen«. (Vorrede 2) und handelt beispielsweise von Gott, dem Schöpfer (II 1–13), unter gleichzeitiger Abweisung anderslautender gnostischer Lehren. Das dritte Buch setzt neu zur Widerlegung der Ketzer auf der Grundlage der überlieferten Schriften der Kirche ein und bespricht zunächst die vier Evangelien (III 1) und die Lehre der Apostel (III 12ff), wobei dazwischen immer wieder thematische Exkurse eingeschoben werden (z.B. III 8 über Mt 6,24; III 10: Lk und Mk über den Gott des Alten Testaments). Das vierte Buch wendet sich den Reden Jesu zu und das fünfte hauptsächlich den Briefen des Paulus mit einem Ausblick auf die neue Erde bzw. das Ende der Welt (V 28–36). In den Vorreden zu den fünf Büchern und in einzelnen Überleitungen und Rückblicken verknüpft Irenäus seine Aussagen miteinander. Doch bleibt das Ganze relativ unübersichtlich. Man gewinnt den Eindruck, dass der Bischof sehr viel vorgeformtes Material übernommen hat, z.B. auch atl. Auslegungen seitens seiner Vorgänger.
Das Interesse des Irenäus
Irenäus’ Theologie ist die eines Kirchenmannes. Er führt seinen antiketzerischen Kampf einerseits zur Verteidigung des Schöpfergottes und andererseits zum Schutz der einfachen Kirchenchristen. Einige Proben, in denen der Bischof selbst spricht, mögen das verdeutlichen.
»Es gibt Leute, die geben die Wahrheit aus der Hand und bringen falsche Lehren auf und ›endlose Genealogien, die nur Streitfragen mit sich bringen‹, wie der Apostel sagt, ›statt der Erbauung Gottes zu dienen, die sich im Glauben verwirklicht‹ (1Tim 1,4). Mit listig eingeübter Überredungskunst verführen sie die Ahnungslosen in ihren Vorstellungen und fangen sie ein, indem sie leichtfertig mit dem Herrenwort umgehen und das, was richtig gesagt ist, falsch ausdeuten. Viele stürzen sie dadurch ins Verderben, dass sie sie unter Vortäuschung besonderer Erkenntnis vom Schöpfer und Ordner des Alls abbringen, als ob sie ein höheres und größeres Wesen vorzeigen könnten als den Gott, der Himmel und Erde und alles darin gemacht hat (Ex 20,11; Ps 146,6: LXX 145,6; Apg 4,24; 14,15). Auf gewinnende Art bringen sie die Arglosen durch trickreiche Reden dazu, sich auf die Suche zu machen; auf gar nicht gewinnende Art aber richten sie sie zugrunde, indem sie ihr Denken zu Blasphemie und Frevel gegen den Weltschöpfer machen, so dass sie nicht mehr in der Lage sind, Falsch und Wahr voneinander zu unterscheiden.«. (Haer I, Vorrede 1)9
»Denn solcherart ist bloß das Geschäft von Lügnern, Verführern und Heuchlern, wie es die Valentinianer sind. An die Menge nämlich richten sie mit Rücksicht auf die, welche von der Kirche kommen, und die sie auch gemeine Ekklesiastiker nennen, Vorträge, um die Einfältigeren einzufangen und anzulocken, indem sie immer aufs neue unseren Vortrag nachahmen, und beklagen sich dann über uns, dass wir uns ohne Grund von ihrer Gemeinschaft zurückhielten, da sie doch Ähnliches lehrten wie wir, und dass wir sie Häretiker nennen, obwohl sie dasselbe lehrten und dieselbe Lehre hätten«. (Haer III 15,2).10
Irenäus sieht also die ihm als bischöflichem Hirten anvertraute Herde durch ketzerische Agitation in seiner eigenen Gemeinde bedroht und besteht auf rigoroser Trennung, weil die Ketzer trotz gegenteiliger Beteuerung etwas ganz anderes als die Kirche lehrten.
Die folgende Polemik gegen Markus, einem gnostisch-christlichen Lehrer aus der Mitte des 2. Jh.s, belegt anschaulich, wie der Kontakt zwischen »Ketzern« und »Gläubigen« zustande kam. Irenäus berichtet:
»Einer unserer Diakone in Asien hat ihn (sc. Markus) in sein Haus aufgenommen und erlebte folgendes Unglück. Seine Frau, die sehr schön war, wurde von diesem Magier an Geist und Leib verdorben und ist ihm lange Zeit nachgelaufen. Schließlich konnten die Brüder sie unter großer Mühe bekehren. Sie tat dann die ganze Zeit Buße und klagte und weinte über die Schande, die ihr der Magier angetan hatte«. (Haer I 13,5).
Diese Polemik mit ihren sexuellen Untertönen ist ebenso typisch wie ungerecht, beleuchtet aber gleichzeitig das Wirkungsfeld des von Irenäus angegriffenen Ketzerhauptes Markus.11
An der soeben zitierten Stelle setzt Irenäus seine Polemik fort, indem er wiederum die fast automatische Durchschlagskraft einer sexuellen Anklage nutzt:
»Auch einige seiner Schüler ziehen wie er durch die Gegend und haben schon viele Frauenzimmer betrogen und verdorben. Sie ernennen sich selbst zu Vollkommenen, als ob niemand sie an Größe der Erkenntnis erreichen könnte, wen du auch nennst. Kein Paulus, kein Petrus, kein anderer Apostel. Sie wollen mehr als alle wissen und haben die Größe der Erkenntnis der unsagbaren Kraft getrunken. Sie sind in der Höhe noch über aller Kraft. Deswegen haben sie auch die Freiheit, alles zu tun, ohne irgendwelche Angst wegen irgendetwas haben zu müssen … Mit solchen Reden und Praktiken haben sie auch hierzulande bei uns im Rhonegebiet viele Frauen getäuscht. Mit verbranntem Gewissen (vgl. 1Tim 4,2) tun die einen öffentlich Buße, die anderen genieren sich deshalb, ziehen sich still zurück und haben die Hoffnung auf das Leben bei Gott (vgl. Eph 4,18) aufgegeben, wobei manche nun ganz abgefallen sind, andere aber noch schwanken und erlebt haben, was das Sprichwort sagt, dass sie nämlich weder draußen noch drinnen sind.«. (Haer I 13,6f.)
Als die Angegriffenen das und andere Ausführungen zu liturgischen Riten und Formeln der Erlösung (vgl. Haer I 21) lasen, haben sie heftig protestiert, wie Hippolyt ca. 20 Jahre später berichtet12:
»Der selige Presbyter Irenäus hat sich mit großem Freimut an ihre Widerlegung gemacht und hat diese Waschungen und Erlösungen (sc. ihres Lehrers Markus, wie z.B. die pneumatische Hochzeit und die Salbung der Sterbenden mit Olivenöl) auseinandergesetzt, indem er ihr Tun ausführlich schilderte. Da nun einige von ihnen das lasen, leugneten sie, derartige Lehren überkommen zu haben. Sie werden ja immer angeleitet zu leugnen.«. (Ref VI 42)13
Wesentlich ist die Erkenntnis, dass Irenäus und seine Nachfolger Polemiker größten Stils sind und ihre Gegner ungerecht behandeln. Irenäus’ Werk ist das typische »Beispiel einer unübersichtlichen und ermüdenden Ketzerbestreitung, die aus Mangel an geistiger Überlegenheit nach jedem Argument greift, mit dem sich die Gegner verunglimpfen, verdächtigen und karikieren lassen.«14
Für Irenäus ist »die fälschlich so genannte Gnosis« ein Sammelname einer Reihe untereinander geradezu entgegengesetzter Gruppen.15 So schreibt er in der Vorrede zu Haer II: In Buch I habe er zunächst die Erfindungen der Valentinianer (und hier besonders der Ptolemäer) als Lügenrede erwiesen. Die anderen Ketzer seien praktisch deren Vorfahren, und alle gingen auf Simon, den Magier, zurück. Indem Irenäus die Valentinianer angreift, meint er, zugleich die anderen zu treffen. Man vgl. ferner Haer II 31,1: »Nachdem also die Valentinianer widerlegt worden sind, ist auch die gesamte Menge der Ketzer zu Fall gebracht.«
In seinem ersten Buch hatte er offenbar ein älteres antiketzerisches Werk verarbeitet, das alle Häretiker von Simon Magus ableitet (vgl. Haer I 23,1: Simon, »von dem alle Ketzereien abstammen«). In dem von Irenäus benutzten Werk eines Vorgängers folgen auf Simon sein Schüler Menander, dann Saturnin, Basilides, Karpokrates, Kerinth, Ebioniten, Nikolaiten, Kerdon, Markion. Da der Apologet Justin um 150n.Chr. in I Apol 26 auf ein nicht erhaltenes antiketzerisches Werk verweist und dort die Reihenfolge Simon – Menander – Markion erscheint, wird vielfach Justins verlorene Schrift für die Vorlage von Irenäus, Haer I 23ff gehalten. Doch ist sogleich einschränkend zu bemerken, dass in keinem Fall die Ebioniten Teil einer antihäretischen Schrift Justins gewesen sein können, da die meisten von ihnen in den Augen des aus Palästina (Neapolis) gebürtigen Apologeten Justin noch keine Ketzer waren (Dial 46f. – zu diesem Text s. unten S.86–90). Außerdem dürften die Nikolaiten, von denen wir Apk 2,14–15 hören – sie aßen Götzenopferfleich und »trieben Unzucht« –, hinzugewachsen sein, da sie entgegen der »Überschrift« des vorirenäischen Ketzerwerkes nicht von Simon, sondern von Nikolaos abgeleitet werden: »Die Nikolaiten haben Nikolaos als ihren Lehrer (also nicht Simon, Vf.), einen von den Sieben, die von den Aposteln als die ersten Diakone eingesetzt wurden.«. (Haer I 26,3)
Der antiketzerische Abschnitt bei Irenäus, Haer I 23–28 ist so aufgebaut, dass die meisten Ketzer zumindest eine Einzelheit von dem vertreten, was Simon bereits gelehrt hat.16 Besonders auffällig sind die Übereinstimmungen zwischen Simon Magus (I 23,1–4) und den Basilidianern (I 24,3–7) sowie den Karpokratianern (I 25,1–6)17:
Schöpfung der Welt durch rebellische Engel (I 23,5; 24,1
f.; 25,3);
Fehlen eines einzelnen Schöpfers;
Unkenntnis des Urwesens durch die feindlichen Mächte (vgl. zusätzlich I 26,1);
Seelenwanderung;
Kriegsmotiv;
Scheinkreuzigung (vgl. zusätzlich I 26,1);
Propheten als Gesandte der Engel;
paulinisch-kyrenäische Gesetzeslehre;
Libertinismus (vgl. zusätzlich I 26,3; 27,3 [?]; 28,2 – ferner I 6,3; 13,6
f; 31,2);
Magie und Idolatrie (vgl. außerdem I 13,5);
Gleichgestalt der Anhänger mit dem Meister.
Damit wird förmlich historisch »bewiesen«, dass sie wirklich von Simon abstammen. Trifft das zu, dann sind die fraglichen Lehren schon daraus als Ketzereien ersichtlich, dass eben jener Simon eine Abfuhr durch Petrus erhalten hat. Dies zeige unzweifelhaft der Bericht der kanonischen Apg (Kap. 8), den Irenäus selbst vor dem Ketzerkatalog ausschreibt (Haer I 23,1), freilich ohne die Bitte Simons an die Apostel zu erwähnen, sie mögen für ihn beten, Apg 8,24: »Bittet ihr den Herrn für mich, dass nichts von dem über mich komme, was ihr gesagt habt!«
Der Vf. der Apg war also gegenüber dem Erzhäretiker Simon noch milder als 100 Jahre später Irenäus. Der Grund dafür liegt vor allem in der verschiedenen kirchenhistorischen Lage. Irenäus setzt strikt die Trennung von Orthodoxie und Ketzerei voraus, beim Vf. der Apg ist die Lage noch nicht so verfestigt. Er führt einen begrenzten Dialog mit konkurrierenden synkretistischen Gruppen. Dies zeigt sich nicht nur an der Simon-Perikope (Apg 8), sondern auch an der relativ offenen Gestaltung der Abschnitte über Elymas (Apg 13,6–12) und die Söhne des Skeuas (Apg 19,13–17). Elymas’ Blindheit ist nur begrenzt (13,11), und die Söhne des Skeuas flohen nackt (19,16). Der Autor »vermag … die Kritik des Synkretismus durchzuführen, ohne dessen Repräsentanten schon prinzipiell preiszugeben.«18
Irenäus beschreibt mit einer technisch zu nennenden Terminologie die Abhängigkeit der verschiedenen Häretiker untereinander. Simon hat in Menander einen Nachfolger, Markion ist der Nachfolger des Kerdon. Alle referierten Gnostiker, die auch Simonianer genannt werden (Haer I 29,1), sind Schüler und Nachfolger Simons (Haer I 27,4). Im Vorwort zu Buch II heißt es: »Wir haben die Lehre ihres Stifters Simon und aller jener, die ihm nachfolgten, aufgezeigt.«
Norbert Brox hat aus dem Vorkommen dieser technischen Terminologie geschlossen, dass es bei den Gnostikern »eine feste Vorstellung … von Lehrtradition«19 gebe. Demgegenüber wird man umgekehrt damit rechnen müssen, dass diese Ausdrucksweise aus dem Kampf des Irenäus bzw. seiner Vorgänger gegen »die fälschlich so genannte Gnosis« zu begreifen ist. Man übertrug das eigene Traditionsprinzip auf die Gegner und führte ebenso wie die eigenen kirchlichen Lehren auch alle gnostischen Phänomene auf Personen in der apostolischen Zeit zurück. So fand man den Ursprung der gegnerischen Lehren in der Verkündigung des Apg 8 bezeugten Simon Magus, und der zeitgenössische Konflikt konnte in der normativen Zeit der Apostel als schon längst entschieden gelten, hatte doch der Apostelfürst Petrus jenen Simon abgewiesen.
Zur Theologie des Irenäus
Irenäus’ Theologie, die stark von seinem Kampf gegen Irrlehrer geprägt ist, lässt sich in folgenden Punkten zusammenfassen:
Erstens sind der Schöpfer der Welt und der Vater Jesu Christi ein und derselbe.
Zweitens fasst Christus das »All«, den »Menschen« mit allem, was hinzugehört, zusammen. Er »rekapituliert« es, greift die gesamte Unheilsgeschichte auf und macht sie damit ungültig. Auf diese Weise ist die letzte Einheit von Schöpfung und Erlösung gesichert.
Drittens haben die Bischöfe und kirchlichen Lehrer den Zusammenhang mit den Aposteln in gerader Folge bewahrt.
»Durch keine anderen wissen wir von dem Plan unserer Erlösung als durch jene, dank derer die Heilsbotschaft zu uns gelangte. Diese haben sie damals zunächst mündlich verkündet, danach aber überlieferten sie uns dieselben nach Gottes Willen in Schriften, die ›Fundament und Säule (1Tim 3,15) unseres Glaubens werden sollten«. (Haer III 1,1).
Viertens ist neben der Schrift auch die apostolische Verkündigung als »Regel der Wahrheit« Norm der Auslegung (vgl. Haer II 35,4), wobei der Kanonbegriff in einem dialektischen Verhältnis zum Schriftenkanon selbst steht. Theoretisch würde sogar gelten: »Hätten nämlich die Apostel nichts Schriftliches uns hinterlassen, dann müsste man eben der Ordnung der Tradition folgen, die sie den Vorstehern der Kirchen übergeben haben«. (Haer III 4,1).20
II. Tertullian21
Tertullian war nach dem Zeugnis des Hieronymus (vir. ill. 53) Presbyter in Karthago. Doch ist die Richtigkeit dieser Notiz zweifelhaft. Sein Geburts- und Todesjahr sind unbekannt und kaum annähernd zu bestimmen. Allerdings geben einige Schriften Hinweise auf ihre Entstehungszeit und erlauben daher, Tertullians schriftstellerische Tätigkeit etwa auf die Jahre 196–220 zu begrenzen sowie die Schriften zeitlich zu ordnen. Montanist22 ist er spätestens 207 geworden. Konflikte mit der Kirche und besonders dem römischen Bischof waren fast vorprogrammiert, doch fanden seine Schriften aus sämtlichen Lebensperioden damals eine interessierte Leserschaft, so dass sie sich in großer Zahl bis in die Neuzeit hinein erhalten haben. Wann, wo und warum er zum Christentum übergetreten ist, wissen wir nicht; nur dass er früher Heide war, ist von ihm selbst bezeugt.23
Tertullians antiketzerischer Kampf. Sein Charakter
In der Schrift »Prozesseinrede gegen die Häretiker«. (De praescriptione haereticorum) übertrug der juristisch gebildete Römer Tertullian das juristische Prozessmittel, dem Gegner durch Einrede die Rechtsfähigkeit zu bestreiten, in den theologischen Bereich. »Er versteht darunter die Geltendmachung des formellen Rechts, vor der sachlichen Erörterung die Bedingung des Streites festzusetzen.«24 Demnach ist die Schrift das rechtmäßige Eigentum der Kirche. Die Ketzer sind gar nicht befugt, sie zu gebrauchen; ihnen muss man von vornherein die Rechtsfähigkeit absprechen, weil die katholische Kirche unmittelbar von den Aposteln sowohl ihre Lehre als auch die Heilige Schrift zu einem Zeitpunkt empfangen hat, da es die Ketzer noch gar nicht gab. Tertullian schreibt hier:
»Wenn sie Häretiker sind, so können sie keine Christen sein, da sie die Lehren, welchen sie nach eigener Wahl anhangen und weshalb sie sich den Namen Häretiker gefallen lassen müssen, nicht von Christus erhalten haben. Als Nichtchristen erlangen sie daher keinerlei Eigentumsrecht an den christlichen Schriften. Man könnte sie mit Recht fragen: Wer seid ihr denn eigentlich? Wann und woher seid ihr gekommen? Was macht ihr auf meinem Grund und Boden, da ihr nicht zu den Meinigen gehört? Mit welchem Recht, Markion, fällst du denn eigentlich meinen Wald? Wer erlaubt dir, Valentin, meine Quellen anders zu leiten? Wer gibt dir, Apelles, die Macht, meine Grenzen zu verrücken? Das Besitztum gehört mir! Wie könnt ihr übrigen hier nach eurem Gutdünken säen und weiden? Mein ist das Besitztum, ich besitze es von jeher, ich habe es zuerst besessen, ich habe sichere Übertragungstitel von den ersten Eigentümern selbst, denen die Sache gehört hat. Ich bin Erbe der Apostel«. (Praescr 37).
Den heutigen Leser beschleicht bei solchen Sätzen das Gefühl, dass jemand um jeden Preis Recht behalten will, wobei der Zweck die Mittel heiligt und Sachlichkeit nicht angestrebt wird. Hier redet der juristisch geschulte Christ Tertullian, der den Prozess zu gewinnen strebt, dem aber die Wahrheit irgendwie abhanden gekommen ist, weil er sie fest zu besitzen meint. Ein Suchen nach der Wahrheit kommt für ihn nicht mehr in Frage, und jene Sucherreligiosität25 der Ketzer, die sich z.B. auf Jesu Wort Mt 7,7/Lk 11,9 (»Bittet, so wird euch gegeben; sucht, so werdet ihr finden; klopft an, so wird euch aufgetan«) stützten, war ihm ein Gräuel. Er schreibt:
»Ich möchte es ein für allemal gesagt haben: Niemand sucht, als wer etwas nicht hat oder es verloren hat. Jene Alte (sc. im Evangelium) hatte eine von ihren zehn Drachmen verloren (Lk 15,8f); deshalb suchte sie; sobald sie sie aber gefunden hatte, hörte sie auf zu suchen. Der Nachbar hatte kein Brot (Lk 11,5–8); deshalb pochte er; sobald ihm aber aufgemacht und es ihm gegeben war, hörte er auf zu pochen. Die Witwe begehrte vom Richter, angehört zu werden (Lk 18,1–8), weil sie keinen Zutritt erhalten hatte; sobald sie aber Gehör erlangt hatte, drang sie nicht länger in ihn. Folglich gibt es ein Ende für das Suchen, Klopfen und Bitten«. (Praescr 11).
»Seit Jesus Christus bedürfen wir des Forschens nicht mehr, auch nicht des Untersuchens, seitdem das Evangelium verkündet wurde. Wenn wir glauben, so wünschen wir über das Glauben hinaus weiter nichts mehr. Denn das ist das erste, was wir glauben: es gebe nichts mehr, was wir über den Glauben hinaus noch zu glauben haben«. (Praescr 7).
Kein Wunder, dass Tertullian zufolge beim Streit mit den Ketzern weiter nichts herauskommt, »als dass man sich den Magen verdirbt oder Kopfschmerzen bekommt«. (Praescr 16).
Doch begnügte sich Tertullian nicht mit dem Argument der Prozesseinrede, sondern bemühte sich auch um eine hier nicht weiter darzustellende, äußerst genaue, umfängliche Widerlegung der Monarchianer, Markioniten und der geläufigen Spielarten der Gnosis.26
Karl Holl hat Tertullians antiketzerische Arbeitsweise so beschrieben:
»Für jede Meinung findet er einen Kontrast, um sie lächerlich zu machen. Er hat auch über dieses Mittel freimütig bekannt:›Wenn man da und dort lacht, so wird man damit nur der Sache hier gerecht werden. Manche Dinge sind es wert, auf diese Weise widerlegt zu werden, damit man ihnen nicht durch die ernsthafte Behandlung Verehrung zollt‹.«27
Es ist daher kein Zufall, dass dieser Charakter, als er Montanist war und gegen die römische Kirche kämpfte, die einst von ihm so hoch gepriesenen kirchlichen Liebesfeiern (Apol 39,16–21) in den Schmutz zog.28 Und als der römische Bischof Kallist grundsätzlich das Recht des Bischofs festschrieb, Todsündern (d.h. Unzuchtsündern) Vergebung zu gewähren, löste das bei Tertullian scharfen Protest aus.29 Bei seinem Charakter nimmt es nicht wunder, dass Tertullian sich zuletzt sogar von den Montanisten getrennt und eine eigene Sekte gegründet hat.30
III. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Irenäus und Tertullian
Während Tertullian die Rechtsgrundlage der Auseinandersetzung zwischen Kirche und Gnosis bestreitet, akzeptiert Irenäus die Gnostiker als Disputanten über die Schrift, da ihre Bekehrung nicht ausgeschlossen sei. Er schreibt z.B.: »Wir wollen … die Reden des Herrn anführen, ob wir nicht vielleicht durch Christi Lehre einige von ihnen überzeugen … können«. (Haer III 25,7). Irenäus will allein mit der Schrift siegreich sein; Tertullian lehnt das ausdrücklich ab. Bei ihm gibt eine »der Schrift und Exegese übergeordnete Instanz … den Ausschlag. Die Schrift bleibt folglich aus dem Disput, und eine Berufung der Gnostiker auf sie wird nicht zugestanden.«31 Er weigert sich also strikt, zum Zweck der Urteilsfindung mit den Ketzern zusammen auf den Text selbst zurückzugehen.
Doch müssen bei beiden Kirchenvätern gleichfalls außertheologische Gesichtspunkte ins Spiel gebracht werden, die ihnen bei ihrer Polemik die Feder geführt haben mögen. Ohne sie würden wir das, was damals wirklich vorging, nicht verstehen.32
Besonders verdächtig schien Tertullian die weitgehende »Demokratisierung« unter den gnostischen Christen. Er schreibt hierüber:
»Ich will nicht unterlassen, auch von dem Wandel der Häretiker eine Schilderung zu entwerfen, wie locker, wie irdisch, wie niedrig menschlich (sic!) er sei, ohne Würde, ohne Autorität, ohne Kirchenzucht, so ganz ihrem Glauben entsprechend. Vorerst weiß man nicht, wer Katechumene, wer Gläubiger ist, sie treten miteinander ein, sie hören miteinander zu, sie beten miteinander – und der Heide auch mit, wenn er etwa dazukommt; sie werfen ihr Heiliges den Hunden und ihre, wenn auch unechten, Perlen den Säuen hin. Das Preisgeben der Kirchenzucht wollen sie für Einfachheit gehalten wissen, und unsere Sorge für dieselbe nennen sie Augendienerei. Was den Frieden angeht, so halten sie ihn auch unterschiedslos mit allen. Es ist in der Tat auch zwischen ihnen, obwohl sie abweichende Lehren haben, kein Unterschied, da sie sich zur gemeinschaftlichen Bekämpfung der einen Wahrheit verschworen haben. Alle sind aufgeblasen, alle versprechen die Erkenntnis. Die Katechumenen sind schon Vollendete, ehe sie noch Unterricht erhalten haben«. (Praescr 41).
Ein besonderes Ärgernis stellten die ketzerischen Frauen dar. Über sie schreibt er im unmittelbaren Anschluss:
»Und selbst die häretischen Frauen, wie frech und anmaßend sind sie! Sie unterstehen sich zu lehren, zu disputieren, Exorzismen vorzunehmen, Heilungen zu versprechen, vielleicht auch noch zu taufen«. (ebd.).
Ein anderer Punkt, der seinen besonderen Widerstand erregte, war der laxe Umgang der Gnostiker mit Autorität und besonders dem Bischofsamt.33 Darüber schreibt er:
»So ist denn heute der eine Bischof, morgen der andere; heute ist jemand Diakon und morgen Vorleser; heute einer Priester und morgen Laie; denn sie tragen die priesterlichen Verrichtungen auch Laien auf«. (Praescr 41).
Eine solche Vorstellung war auch Irenäus unerträglich, der seit 178n.Chr. Bischof der Gemeinde von Lyon und Vienne war. Sein striktes Festhalten daran, dass der Vater Jesu Christi und der Schöpfer der Welt identisch seien, mag auch politisch mitbedingt gewesen sein. Die Vorstellung vom Ordnungsgefüge in der Gemeinde und vom Ordnungsgefüge im Himmel entsprachen einander. Wäre im Himmel Raum für einen unbekannten Gott gewesen, hätte das zugleich die Gefahr bedeutet, dass die Gemeinde ins Wanken geraten könnte. Und eine demokratische Kirche, wie sie bei den Ketzern im Ansatz vorhanden war, widerstritt vollends der Vorstellung eines patriarchalischen Gottes.
Und schließlich vertraten beide Ketzerbestreiter mit Nachdruck die Auferstehung des Fleisches, Irenäus sogar in ihrer chiliastischen Variante.34 Das begründeten sie in ausführlichen Exegesen von 1Kor 15 und relativierten dabei vergeblich 1Kor 15,50 (»Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben«)35, um den von ihnen bekämpften gnostischen Paulusschülern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Hatte dieses unangenehme Pochen auf der fleischlichen Auferstehung Jesu und der Gläubigen sowie – nicht zu vergessen – der Ungläubigen (zum Verdammungsgericht)36 nicht auch eine politische Dimension? Wurde doch mit ihr eine klerikale Autorität erst geschaffen.
Nun wäre es sicher verfehlt, theologische Grundsätze direkt auf politische Überzeugungen zurückzuführen. Die religiöse Wirklichkeit ist komplizierter, und die Annahme einer direkten Bedingtheit der Theologie durch die Gesellschaft ist zu simpel. Immerhin beleuchtet der Hinweis auf die Konsequenzen der Theologie für die Politik eine Dimension, um die es in dem Streit zwischen Tertullian und Irenäus auf der einen und den gnostischen Ketzern auf der anderen Seite auch ging.
Gleichzeitig sieht man daran, dass und wie die entstehende katholische Kirche ein viel leichteres Auskommen mit dem Staat haben konnte (und umgekehrt) als die alles in Frage stellenden Ketzer, die in ihrer religiösen Suche und Neugierde eine stete Gefahr für das geschlossene System eines Irenäus und Tertullian darstellten.
Kapitel 3: Wie aus Ketzerbestreitern Ketzer wurden oder: Die Jerusalemer Judenchristen in den ersten beiden Jahrhunderten
Historische Abgrenzungen. Das Problem der Kontinuität
Äußerlich lassen sich zwei Phasen des Jerusalemer Christentums unterscheiden, die Zeit vor dem Jüdischen Krieg im Jahre 70n.Chr. und die Zeit danach, die den Jerusalemer Christen ein weiteres Verweilen in der jüdischen Metropole kaum mehr erlaubte, weil mit der Zerstörung des Tempels durch Heiden der heilige Ort auf Dauer geschändet worden und so ein Bruch mit der Vergangenheit vollzogen war.
Wie die Jerusalemer Christen die heilige Stadt der Juden verlassen haben, ist umstritten. Eine dogmatisch motivierte Antwort bietet der Kirchenvater Euseb im 4. Jh. Er schreibt darüber Folgendes in seiner Kirchengeschichte (= KG) III 5,2f (die entsprechenden Bibelverse, die Euseb im Blick hat, sind in Klammern gesetzt):
(2) »Als nun nach der Himmelfahrt unseres Erlösers (Apg 1,9) die Juden zu dem Verbrechen an dem Erlöser (sc. als Schuldige an seinem Tode: 1Thess 2,15; Mk 15,6–15) auch noch die höchst zahlreichen Vergehen an seinen Aposteln begangen hatten, als zunächst Stephanus von ihnen gesteinigt (Apg 7,58f), sodann nach ihm Jakobus, der Sohn des Zebedäus und Bruder des Johannes, enthauptet (Apg 12,2f) und schließlich Jakobus, welcher nach der Himmelfahrt unseres Erlösers zuerst den bischöflichen Stuhl in Jerusalem erhalten hatte, auf die angegebene Weise beseitigt worden war1, als die übrigen Apostel nach unzähligen Todesgefahren, die man ihnen bereitet hatte, das Judenland verlassen hatten und mit der Kraft Christi, der zu ihnen gesagt hatte: ›Geht hin und lehrt alle Völker in meinem Namen!‹ (Mt 28,19) zur Predigt des Evangeliums zu allen Völkern hinausgezogen waren, (3) als endlich die Kirchengemeinde in Jerusalem in einer Offenbarung, die ihren Führern geworden war, die Weissagung erhalten hatte, noch vor dem Krieg die Stadt zu verlassen und sich in einer Stadt Peräas, namens Pella, niederzulassen, und als sodann die Christgläubigen von Jerusalem weggezogen waren, und weil damit gleichsam die heiligen Männer die königliche Hauptstadt der Juden und ganz Judäa völlig geräumt hatten, da brach zuletzt das Strafgericht Gottes über die Juden wegen der vielen Freveltaten, die sie an Christus und seinen Aposteln begangen hatten, herein und vertilgte gänzlich dieses Geschlecht der Gottlosen aus der Menschengeschichte.«
Der übergreifende Zusammenhang ist die dogmatische Aussage, dass die Zerstörung Jerusalems eine Strafe Gottes gegen die vielen »Untaten« der ungläubigen Juden gegen Jesus und seine Apostel war.2 In sie flicht Euseb die auf Überlieferung zurückgehende Einzelnachricht3 ein, dass die Christen vor dem Krieg die Weissagung erhielten, Jerusalem zu verlassen und in Pella Wohnung zu nehmen. Damit ist eine klare Trennung erreicht zwischen den Guten, die bisher eine Katastrophe verhindert haben, und den »Bösewichtern«, die in der Stadt bleiben und jetzt, da die heiligen Männer Jerusalem und überhaupt ganz Judäa verlassen haben, bestraft werden können.
Doch erregt hier wie sonst in der Geschichte ein Bericht von einem derart eindeutigen Verlauf das Misstrauen. Folgende Fragen stellen sich:
1. Wie alt ist und von wem stammt die Überlieferung vom Auszug der Urgemeinde nach Pella? Antwort: Sie dürfte auf Aristo von Pella (= Anfang des 2. Jh.s) zurückgehen (vgl. Euseb, KG IV 6,3f) und setzt voraus, dass die Gemeinde in Pella geblieben und nicht nach Jerusalem zurückgekehrt ist.