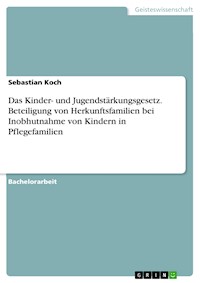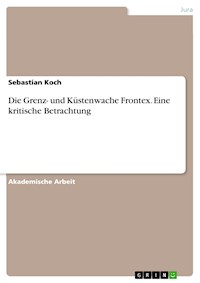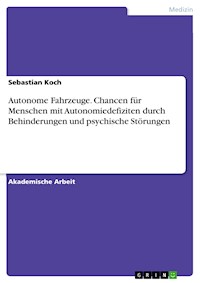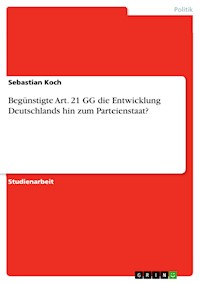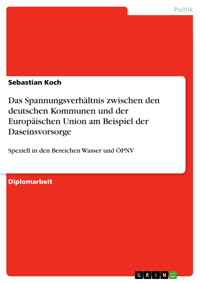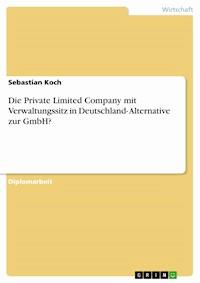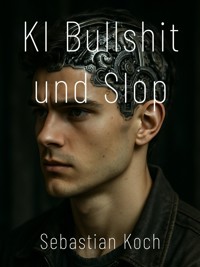
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Die digitale Welt hat sich in den letzten dreißig Jahren von Heimcomputern und einem freien Internet hin zu daten- getriebenen Plattformen und Künstlicher Intelligenz entwickelt. Während Technologie stets Vereinfachung und Effizienz anstrebte, besteht die neue Herausforderung in Maschinen, die ohne Denken reden können – mit weitreichenden Folgen. Das Internet hat sich dramatisch gewandelt: Inhalte werden nicht mehr hauptsächlich von Menschen geteilt, sondern automatisch von Systemen imitiert, die nicht verstehen. Diese Entwicklung, oft als "AI Bullshit" oder "Slop" bezeichnet, verändert fundamental den Konsum von Informationen, die Wissensbildung und die Wahrnehmung der Realität. Das Buch lädt zur Klarheit ein und analysiert, wie der digitale Raum vom kreativen Chaos zur synthetischen Routine wurde, erläutert die Ursachen und zeigt auf, welche Schlüsse Gesell- schaft, Nutzer und Denker daraus ziehen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 53
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
KI Bullshit und Slop
KI Bullshit und Slop
Wie Maschinen und KI unsere Kommunikation verändern – und was das über uns sagt
Sebastian Koch
© 2025
1. Auflage – Sebastian Koch
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Teil I – Ursprung und Entstehung
Kapitel 1 – Das goldene Zeitalter des Internets
Kapitel 2 – Die Geburt der Maschinenautoren
Kapitel 3 – Der Hype: Wenn alles „AI“ ist
Kapitel 4 – Bullshit as a Service
Teil II – Die Mechanik des Bullshits
Kapitel 5 – Die Struktur des Slops
Kapitel 6 – Maschinenlogik und menschliches Verhalten
Kapitel 7 – Die Rolle der Plattformen
Kapitel 8 – Die Ökonomie der Bedeutungslosigkeit
Kapitel 9 – Wenn Systeme sich selbst füttern
Teil III – Der Mensch im Strudel
Kapitel 10 – Kognitive Erschöpfung
Kapitel 11 – Informationsüberfluss und Bedeutungslosigkeit
Kapitel 12 – Der Verlust der Authentizität
Kapitel 13 – Vertrauen, Wahrheit und Orientierung
Teil IV – Auswirkungen und Konsequenzen
Kapitel 14 – Medien im Nebel der Automatisierung
Kapitel 15 – Politik im Schatten der Algorithmen
Kapitel 16 – Bildung im Zeitalter der Maschinen
Kapitel 17 – Gesellschaft im Rausch der Effizienz
Teil V – Zukunft und Ausblick
Kapitel 18 – Die Zukunft der Medienlandschaft
Kapitel 19 – Die Zukunft der Arbeit und Kreativität
Kapitel 20 – Gesellschaft im Übergang
Kapitel 21 – Ausblick: Zwischen Mensch und Maschine
Nachwort
Vorwort
Als Informatiker, der die digitale Welt seit über dreißig Jahren beobachtet, sah ich die Entwicklung von Heimcomputern und dem freien Internet bis zu datengetriebenen Plattformen und der heutigen "künstlichen Intelligenz". Technologie zielte immer auf Vereinfachung und Effizienz ab. Neu ist, dass Maschinen geschaffen wurden, die reden können, ohne zu denken – was weitreichende Folgen hat.
Das Internet hat sich dramatisch verändert : Wo Menschen einst Inhalte teilten, werden heute Abermillionen automatisch von Systemen erzeugt, die darauf trainiert sind zu imitieren, statt zu verstehen. Diese Entwicklung, die als "AI Bullshit" und "Slop" bezeichnet wird, verändert grundlegend, wie Informationen konsumiert, Wissen gebildet und Realität wahrgenommen wird.
Dieses Buch ist eine Einladung zur Klarheit und zeigt, wie der digitale Raum vom kreativen Chaos zur synthetischen Routine wurde, warum dies geschah und was Gesellschaft, Nutzer und Denker daraus ableiten können.
Teil I – Ursprung und Entstehung
Kapitel 1 – Das goldene Zeitalter des Internets
In den frühen Jahren war das Digitale ein Ort der Hoffnung. Man sah darin ein Werkzeug zur Befreiung von Hierarchien, zur Demokratisierung von Wissen und zur Öffnung von Diskursen. Die Architektur war dezentral, transparent und unbürokratisch. Jeder konnte durch Einwahl, Veröffentlichung oder Diskussion Teil des Netzes werden.
1.1 Offenheit als Leitidee
Das Netz erweiterte zunächst akademische und wissenschaftliche Kommunikationskulturen. E-Mail, Usenet und Foren entstanden aus dem Bedürfnis nach Austausch, nicht nach Wettbewerb. Information wurde geteilt, nicht verkauft. Die frühe Kultur war von Vertrauen und der Annahme geprägt, dass Kooperation bessere Ergebnisse liefert. Technisch war das Internet fehleranfällig, langsam und begrenzt, aber das war Teil seiner Identität. Nutzer akzeptierten Unvollkommenheit und verstanden Fortschritt als experimentell. Jede neue Idee war eine Einladung zum Mitdenken. So entstand ein kultureller Raum, in dem Transparenz und Selbstorganisation als Werte galten. Der Quellcode vieler Programme war offen, und Wissen galt als kollektive Ressource. Diese Haltung bildete eine Ethik des Teilens.
1.2 Vom Individuum zur Öffentlichkeit
Mit grafischen Browsern und günstigen Zugängen begann die zweite Phase: das Internet als öffentlicher Raum. Blogs und soziale Netzwerke machten individuelle Perspektiven sichtbar; die Barriere zur Veröffentlichung sank, die Vielfalt stieg. Diese Entwicklung brachte Chancen und Widersprüche: Die Öffentlichkeit wurde nicht mehr von Institutionen, sondern von Algorithmen reguliert. Sichtbarkeit überlagerte Qualität, und das Publikum orientierte sich an Popularität, nicht an Argumentation. Hier wurden die Keime für den späteren „Slop“ gelegt. Mechanismen zur Förderung von Transparenz wurden zu Instrumenten der Optimierung. Wer Klicks zählte, steuerte Aufmerksamkeit und konnte Verhalten formen.
1.3 Vertrauen und Glaubwürdigkeit
Das frühe Netz basierte auf gegenseitiger Kontrolle. Falsche Behauptungen wurden sozial korrigiert: durch Diskussion, Widerspruch und Argumentation. Dieser Mechanismus war langsam, aber robust. Die Wahrnehmung von Glaubwürdigkeit änderte sich mit der Zeit. Die Unterscheidung zwischen Experten und Laien wurde schwieriger, was zu einer Gleichwertigkeit des Ausdrucks führte: Jede Aussage erschien zunächst gleich plausibel. Das stärkte zwar die Pluralität, schwächte aber die Orientierung. Technisch war das Internet ein offenes, kulturell ein chaotisches System. In dieser Offenheit lag sein Reiz und seine Verwundbarkeit.
1.4 Die Geburt der Plattformökonomie
Suchmaschinen, Portale und soziale Netzwerke entstanden, um Ordnung in das Chaos zu bringen, und versprachen Übersicht, Effizienz und Personalisierung. Doch die Vermittler wurden zu Gatekeepern, was neue Abhängigkeiten schuf. Der Schwerpunkt verlagerte sich von Inhalt zu Struktur: Die algorithmische Position im System entschied über Sichtbarkeit. Dies war die stille Revolution des Netzes: die Machtverlagerung von der Autorin zum Algorithmus. Die Plattformen optimierten ihre Modelle nach messbaren Größen wie Klicks, Likes und Verweildauer. Diese Kennzahlen wurden schnell zur ökonomischen Grundlage und schufen den Markt der Aufmerksamkeit.
1.5 Vom Dialog zum Signal
Kommunikation wandelte sich vom Dialog zum Signalverkehr. Anstelle von Argumenten zählten nun messbare Reaktionen (Zustimmung, Ablehnung, Teilen, Ignorieren), die arm an Bedeutung waren. Die Konzentration auf Reaktionsmetriken führte zu einer Verkürzung der Inhalte. Komplexität wurde zum Nachteil, Ambivalenz zum Risiko. Je extremer, emotionaler oder klarer eine Botschaft war, desto besser performte sie. Dies markierte den Übergang vom Netz der Ideen zum Netz der Eindrücke, eine schleichende kulturelle Mutation.
1.6 Das Ende der Naivität
Das „goldene Zeitalter“ war nie wirklich golden, aber es war von der Hoffnung geprägt, dass Technik und Offenheit zu Aufklärung führen würden. Diese Hoffnung wurde durch die Kräfte unterminiert, die sie ermöglichten: Automatisierung, Geschwindigkeit und Effizienz. Heute gilt diese Phase als idealistisch. Sie hinterließ das Ideal der freien Information, das sich heute in einer Umgebung von Automatisierung und Überfluss behaupten muss. Der Übergang von der experimentellen zur industriellen Phase des Internets war unausweichlich. Hier begann der Weg in eine Welt, in der Inhalte Ergebnis von Berechnung, nicht Ausdruck von Erfahrung sind – der Beginn der Geschichte des Slops.
Kapitel 2 – Die Geburt der Maschinenautoren
2.1 Von der Automatisierung zur Autorschaft
Sprache war lange ein Inbegriff menschlicher Einzigartigkeit, die Denken, Erfahrung und Bedeutung verband. Jedes Wort trug eine Spur seiner Herkunft. Mit maschinellen Sprachsystemen lockerte sich diese Kopplung. Automatisierte Textverarbeitung wie Korrekturen und Übersetzungen existiert seit Jahrzehnten und unterstützte die Autorschaft. Der eigentliche Bruch kam mit probabilistischen Sprachmodellen. Künstliche Intelligenz lernte, Sprache zu erzeugen, ohne zu verstehen, indem sie Texte statistisch verarbeitete. Bedeutung wurde durch Wahrscheinlichkeit ersetzt. Die zentrale Frage wandelte sich von Was will der Autor ausdrücken? zu Wie wahrscheinlich ist das nächste Wort?.