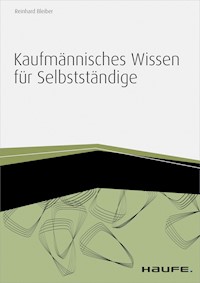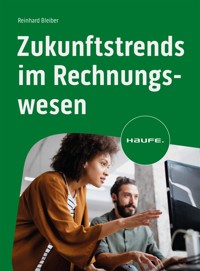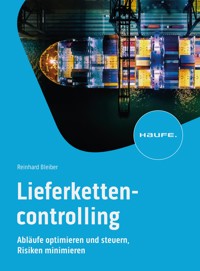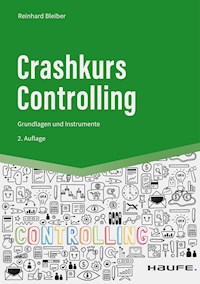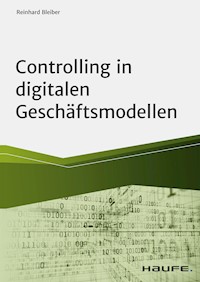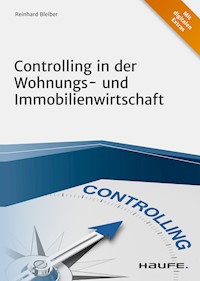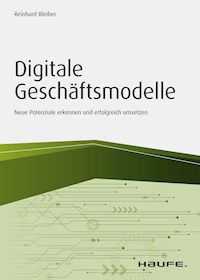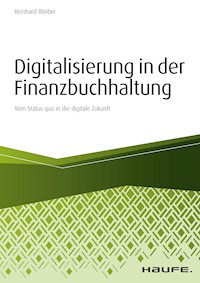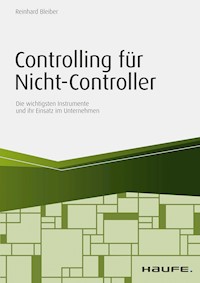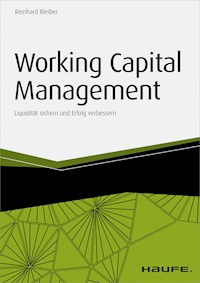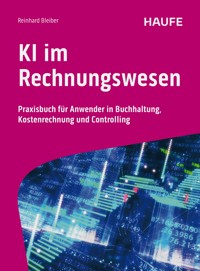
59,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haufe Lexware
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Haufe Fachbuch
- Sprache: Deutsch
Reinhard Bleiber bietet in diesem Buch eine fundierte Einführung in das Thema Künstliche Intelligenz und beleuchtet deren spezifische Anforderungen im Rechnungswesen. Anschaulich zeigt er, wie KI gewinnbringend in Buchhaltung, Kostenrechnung und Controlling eingesetzt werden kann, um Prozesse zu optimieren, Effizienz zu steigern und Fehler zu reduzieren. Zudem erklärt er, wie sich KI-Ergebnisse präzise überprüfen und Anwendungen individuell steuern lassen. Dabei werden sowohl die Potenziale als auch mögliche Risiken aufgezeigt sowie praxisnah dargestellt, wie KI erfolgreich im Rechnungswesen implementiert werden kann. Inhalte: - Grundlagen der Künstlichen Intelligenz - KI in der Buchhaltung: automatisierte Abläufe, Berichterstattung, Risikomanagement, Potenziale identifizieren - KI in der Kostenrechnung: Abläufe, Anwendungsbereiche, Potenziale - KI im Controlling: Planung, Analysen, Berichtswesen - Chancen und Risiken - Implementierung von KI im Rechnungswesen - Ausblick auf die Zukunft
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 490
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
InhaltsverzeichnisHinweis zum UrheberrechtImpressumVorwortAbkürzungsverzeichnis1 Eine erste Annäherung1.1 Warum KI im Rechnungswesen?1.2 KI oder Automatisierung1.3 Entwicklung im Rechnungswesen2 Grundlagen der Künstlichen Intelligenz2.1 Technik2.1.1 Geräte und Systeme2.1.2 Maschinelles Lernen (ML)2.1.3 Neuronale Netze2.1.4 Natural Language Processing (NLP)2.1.5 Hilfssysteme2.2 Daten2.2.1 Datenstruktur2.2.2 Datenquellen2.2.3 Datenvorbereitung2.3 Schnittstelle Mensch/KI2.3.1 Sprache2.3.2 Texte2.3.3 Grafik2.3.4 Training und laufende Korrektur2.4 Recht2.4.1 Recht der KI-Anwendung2.4.2 Recht bei der Nutzung der KI-Anwendung2.5 Ethik2.5.1 Diskriminierungsfreiheit2.5.2 Verzerrungsfreie Entscheidungen2.5.3 Transparenz2.5.4 Manipulationsfreiheit2.5.5 Schutzmaßnahmen3 KI in der Buchhaltung3.1 Automatisierte Abläufe3.1.1 Aktuell und in Zukunft3.1.1.1 Ablaufstrukturen3.1.1.2 Debitorenbuchhaltung3.1.1.3 Kreditorenbuchhaltung3.1.1.4 Lagerbuchhaltung3.1.1.5 Anlagenbuchhaltung3.1.2 Potenziale3.2 Berichterstattung3.2.1 Berichte durch KI3.2.2 Analysen durch KI3.2.3 Kennzahlen interpretieren durch KI3.3 Risikomanagement3.3.1 Potenziale durch KI-Einsatz3.3.1.1 Compliance3.3.1.2 Betrugserkennung3.3.1.3 Kreditrisiken3.3.1.4 Risikoreduktion3.3.2 KI in der Prüfung3.3.2.1 KI-Abläufe in der Prüfung3.3.2.2 KI-unterstützte Prüfung3.3.2.3 KI der Prüfer3.3.3 Risikobewertung3.4 Steuern3.4.1 Steuerliche Prozesse3.4.2 Bewertung3.4.2.1 Bestandsbewertung3.4.2.2 Forderungen3.4.2.3 Rückstellungen3.4.3 Verrechnungspreise3.4.4 Tax Compliance3.4.5 Steueroptimierung3.5 Finanzierung3.5.1 Bankkontakte3.5.2 Permanente Liquiditätsplanung3.5.3 Optimierung der Mittelbeschaffung3.5.3.1 Finanzierungsstrategie3.5.3.2 Eigenkapital3.5.3.3 Fremdkapital3.5.3.4 Innenfinanzierung3.5.3.5 Mittelverwendung3.5.4 Informationspflichten3.6 Potenzial für KI in der Buchhaltung3.6.1 Potenziale identifizieren3.6.2 Potenziale heben4 KI in der Kostenrechnung4.1 Abläufe und KI4.1.1 Automatisierung aktuell4.1.2 Manuelle Aufgaben4.1.3 Datenstrukturen und Quellen4.1.4 Transformation4.2 Anwendungsbereiche4.2.1 Kostenartenrechnung4.2.2 Kostenstellenrechnung4.2.3 Kostenträgerrechnung4.2.4 Abstimmung4.3 Potenziale für den KI-Einsatz in der Kostenrechnung4.3.1 Zusammenarbeit4.3.2 Potenziale erkennen4.3.3 Potenziale heben5 KI im Controlling5.1 Grundsätzliche Übereinstimmung5.1.1 Aufgaben im Controlling5.1.2 Voraussetzungen für KI im Controlling5.1.3 Möglichkeiten der KI5.2 KI in der Planung5.2.1 Gefühl gegen prädiktive Planung5.2.2 Zeithorizonte und KI5.2.3 Abstimmung zwischen den Planenden5.2.4 Abhängigkeiten erkennen und berücksichtigen5.2.5 Szenariorechnungen5.3 Analysen und KI5.3.1 Daten5.3.2 Abweichung Plan/Ist5.3.3 Simulationen und Szenarien5.3.4 Echtzeitüberwachung5.3.5 KPI-Überwachung5.3.6 Risikomanagement5.4 Berichtswesen5.4.1 Business Intelligence und KI5.4.2 Autonomie im Reporting5.5 Potenziale für den KI-Einsatz5.5.1 Potenziale im Controlling identifizieren5.5.2 Potenziale heben5.5.3 Potenzielle Veränderungen6 Chancen und Risiken der KI im Rechnungswesen6.1 Chancen6.1.1 Entlastung der Mitarbeiter6.1.2 Qualität6.1.3 Geschwindigkeit6.1.4 Inhalte6.1.5 Transparenz6.2 Risiken6.2.1 Datenqualität6.2.2 Technik6.2.3 Sicherheit6.2.4 Überforderung6.2.5 Interne Widerstände6.2.6 Externe Widerstände6.2.7 Wissensverlust6.2.8 KI-Bias6.2.9 Haftung6.3 SWOT-Analyse7 Implementierung von KI im Rechnungswesen7.1 KI-Strategie7.1.1 Unternehmen7.1.2 Rechnungswesen7.1.3 Inhalt7.1.4 Verantwortung7.1.5 Roadmap7.2 Auswahl7.2.1 Bereich identifizieren7.2.2 Wirtschaftlichkeit prüfen7.2.3 Technik auswählen7.2.4 Partner auswählen7.2.5 Engagement prüfen7.2.6 Ziele festlegen7.3 Das Projekt7.3.1 Verantwortung7.3.2 Team7.3.3 Zeitplanung7.3.4 Meilensteine7.3.5 Ergebnis7.4 Nachhaltigkeit7.4.1 Organisatorische Nachhaltigkeit7.4.2 Technische Nachhaltigkeit7.4.3 Ökonomische Nachhaltigkeit7.4.4 Soziale Nachhaltigkeit7.4.5 Ökologische Nachhaltigkeit7.5 KI im Standard7.5.1 Offen oder versteckt7.5.2 Einfluss7.5.3 Nutzen8 Zukunft der KI im Rechnungswesen8.1 Integration in Standards8.2 Individuelle Apps8.3 Menschen im Rechnungswesen8.4 Interne und externe Partner8.5 Gesellschaft8.6 Begrenzung möglich und sinnvoll?8.7 Eine Vision für die Rechnungswesen der UnternehmenStichwortverzeichnisBuchnavigation
InhaltsubersichtCoverTextanfangImpressumHinweis zum Urheberrecht
Alle Inhalte dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt.
Bitte respektieren Sie die Rechte der Autorinnen und Autoren, indem sie keine ungenehmigten Kopien in Umlauf bringen.
Dafür vielen Dank!
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Print:
ISBN 978-3-648-18645-9
Bestell-Nr. 12221-0001
ePub:
ISBN 978-3-648-18646-6
Bestell-Nr. 12221-0100
ePDF:
ISBN 978-3-648-18647-3
Bestell-Nr. 12221-0150
Reinhard Bleiber
KI im Rechnungswesen
1. Auflage, November 2025
© 2025 Haufe-Lexware GmbH & Co. KG
Munzinger Str. 9, 79111 Freiburg
www.haufe.de | [email protected]
Bildnachweis (Cover): © blackdovfx, iStock
Produktmanagement: Dipl.-Kfm. Kathrin Menzel-Salpietro
Lektorat: Ulrich Leinz
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Der Verlag behält sich auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor. Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Sofern diese Publikation ein ergänzendes Online-Angebot beinhaltet, stehen die Inhalte für 12 Monate nach Einstellen bzw. Abverkauf des Buches, mindestens aber für zwei Jahre nach Erscheinen des Buches, online zur Verfügung. Ein Anspruch auf Nutzung darüber hinaus besteht nicht.
Sollte dieses Buch bzw. das Online-Angebot Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte und die Verfügbarkeit keine Haftung. Wir machen uns diese Inhalte nicht zu eigen und verweisen lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung.
Vorwort
Wenn man den Diskussionen glauben darf, steht der Menschheit mit Künstlicher Intelligenz eine neue Revolution bevor. Nationale Volkswirtschaften wetteifern darum, wer das erfolgreichste Tech-Unternehmen mit diesem Angebot hervorbringt. Softwarehersteller bemühen sich manchmal zwanghaft, Künstliche Intelligenz in ihre Angebote zu integrieren. Die Nutzer in den sozialen Netzwerken, auf den unterschiedlichsten digitalen Plattformen und in den unternehmerischen Anwendungen versuchen, Künstliche Intelligenz zu verstehen und für ihre Aufgaben einzusetzen. Datenschützer warnen vor umfassender Überwachung, nicht mehr zu schützenden sensiblen Datenbeständen, Deepfakes und gefälschten Bildern. Doch was kommt tatsächlich an, beim Menschen, im Privaten und in der beruflichen Praxis?
Experten sind sicher, dass Patienten in den Arztpraxen und Krankenhäusern profitieren werden. Künstliche Intelligenz wird die Mediziner von der Arbeit in Standardfällen entlasten und in komplexen Fällen unterstützen. Das verbessert die Ergebnisse und verkürzt Wartezeiten. Die Schnittstellen zwischen der digitalen Welt und den Anwendern werden menschlicher. Gespräche, gleichgültig in welcher Sprache, zwischen Mensch und digitalem System sollen sich nicht mehr von zwischenmenschlichen Unterhaltungen unterscheiden. ChatGPTChatGPT, DeepSeekDeepSeek und Co. liefern nicht mehr zunehmend bessere Antworten auf unsere Fragen, sie schaffen Lösungen. So zumindest die Versprechen der Entwickler. Und der Missbrauch der Künstlichen Intelligenz soll durch Künstliche Intelligenz beherrschbar werden.
Richtig erfolgreich wird jede Technologie erst dann, wenn sie kommerziell genutzt werden kann. Dazu gehört eine Vermarktung für den privaten Einsatz, aber auch der wirtschaftlich sinnvolle Einsatz in den Organisationen, Verwaltungen und Unternehmen. Künstliche Intelligenz ist im Grunde nichts anderes als eine zusätzliche digitale Anwendung. Und wie alle digitalen Anwendungen vorher wird auch diese ihren Weg in die berufliche Welt der Menschen finden. Bessere, schnellere und vorverarbeitete Informationen werden notwendig sein, um die rasanten Entwicklungen auf den Märkten erfolgreich annehmen zu können. Standardaufgaben, für eine reine Automatisierung vielfach zu komplex, sollen durch Künstliche Intelligenz ohne menschliche Eingriffe erledigt werden, schneller und besser.
Wir im Rechnungswesen waren schon immer Vorreiter darin, digitale Möglichkeiten sinnvoll einzusetzen. Das wird auch bei der Künstlichen Intelligenz nicht anders sein, unabhängig davon, wie viele der Versprechen sich erfüllen werden. Für eine erfolgreiche Nutzung ist es notwendig, die Künstliche Intelligenz zu verstehen. Bereits heute müssen mögliche Einsatzbereiche identifiziert werden, Organisation und Menschen müssen vorbereitet sein. Dabei hilft dieses Buch.
Lengerich, Oktober 2025
Reinhard Bleiber
Abkürzungsverzeichnis
AGG
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
AI
Artificial Intelligence
API
Application Programming Interface
ASIC
Application-Specific Integrated Circuits
ASR
Automatic Speech Recognition
B2B
Business to Business
B2C
Business to Consumer
BDSG
Bundesdatenschutzgesetz
BI
Business-Intelligence
ChatGPT
Chat generative pre-trained transformer
COCO
Common Objects in Context
CPU
Central Processing Unit
CRM
Customer-Relationship-Management
DMS
Dokumentenmanagementsysteme
E-Bilanz
Elektronische Bilanz
EBIT
Earnings Before Interest and Taxes
EDV
Elektronische Datenverarbeitung
ERP
Enterprise Ressource Planning
EU AI Act
Artificial Intelligence Act der EU
EU-AI-Verord.
EU-Verordnung zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz
EVA
Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe
FIFO
First In, First Out
FPGA
Field-Programmable Gate Array
DSGVO
Datenschutz-Grundverordnung
GuV
Gewinn- und Verlust-Rechnung
GLUE
General Language Understanding Evaluation
GoB
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
GPU
Graphics Processing Units
IDW PS
Institutes der Wirtschaftsprüfer Prüfungsstandard
IT
Informationstechnologie
KI
Künstliche Intelligenz
KPI
Key Performance Indicator
LIFO
Last In, First Out
ML
Maschinelles Lernen
NLP
Natural Language Processing
NPU
Neural Processing Unit
OCR
Optical Character Recognition
Portable Document Format
POS
Point of Sale
RFID
Radio Frequency Identification
ROI
Return on Investment
RPA
Robotic Process Automation
SWOT
Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threads
TPU
Tensor Processing Unit
TTS
Text-to-Speech
WWW
World Wide Web
1 Eine erste Annäherung
Künstliche Intelligenz (KI) ist ein äußerst komplexes Thema. Darum wird in der öffentlichen Diskussion auch kaum über die Techniken und Hintergründe gesprochen. Es erscheint vorteilhafter, über die unstrittig vorhandenen Möglichkeiten dieser digitalen Entwicklung zu berichten. Oder es wird versucht, die ebenso unstrittigen Risiken zu dramatisieren. Beides schreckt ab und führt dazu, dass KI die Menschen unterschiedlich bewegt.
Die Zahl derjenigen, die KI ausschließlich positiv sehen, ist gemessen an der Präsenz in digitalen und analogen Medien sehr groß. Sie erwarten digitale Unterstützung auch in schwierigen Situationen, verlangen Entlastung von unangenehmen Arbeiten und lösen Zeit- und Kapazitätsprobleme mit der digitalen Wunderwaffe. Der Fachkräftemangel in allen Bereichen von Wirtschaft, Verwaltung und Institutionen, die Probleme im Gesundheitswesen oder durch den Klimawandel verursachte Probleme können gelöst werden und verlieren durch KI an Bedeutung.
Eine zweite Gruppe von Menschen fokussiert auf die Risiken der KI. Sie verzweifeln an der notwendigen Datenqualität und der engen Vernetzung riesiger, für sie nicht mehr kontrollierbarer Datenstrukturen. Die Beherrschbarkeit der digitalen Algorithmen erscheint in dieser Gruppe als unmöglich, wird aber dennoch alternativlos gefordert. In der öffentlichen Wahrnehmung spielt vor allem der problematischer werdende Datenschutz im Zentrum.
Beide Gruppen haben nicht vollkommen Unrecht, liegen aber auch nicht vollständig richtig. Die Befürworter wecken Erwartungen, die sich nicht immer realisieren lassen. Die Bedenkenträger können durch ihre gesellschaftspolitische Macht die Entwicklung verzögern und viele Anwendungen durch rechtliche Vorgaben unwirtschaftlich werden oder verhindern.
Seit August 2024 gilt in der EU die KI-VerordnungKI-Verordnung, die ausweislich ihres Artikels 1 die KI fördern soll, aber auch ein hohes Schutzniveau für die Bürger gewährleistet.
Art. 1 KI-VO
(1)
Zweck dieser Verordnung ist es, das Funktionieren des Binnenmarkts zu verbessern und die Einführung einer auf den Menschen ausgerichteten und vertrauenswürdigen künstlichen Intelligenz (KI) zu fördern und gleichzeitig ein hohes Schutzniveau in Bezug auf Gesundheit, Sicherheit und die in der Charta verankerten Grundrechte, einschließlich Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Umweltschutz, vor schädlichen Auswirkungen von KI‑Systemen in der Union zu gewährleisten und die Innovation zu unterstützen.
Diese Bedenken der Politiker in Brüssel gibt es in anderen Wirtschaftsblöcken nicht. In den USA, wo sich viele der Entwickler der KI und deren Anwendungen befinden, sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen bei weitem nicht so restriktiv. Konkurrenz erhalten die Technologen der westlichen Welt aus China, wo Skrupel vor dem Gebrauch von personenbezogenen oder unternehmerisch sensiblen Daten vollkommen unbekannt sind. Die EU muss den Anschluss wahren. Es gibt keine wichtigen Entwickler von KI im Machtbereich der Brüsseler Bürokraten, die EU darf nicht die Nutzung der KI anderen allein überlassen.
Neben den Befürwortern und den Bedenkenträgern der KI-Nutzung gibt es eine dritte Gruppe von Menschen, die Pragmatiker. Sie versuchen nicht, die Entwicklungen zu verhindern oder zu gestalten. Dazu ist ihre Macht nicht ausreichend. Sie akzeptieren, dass es Veränderungen in ihrem privaten und beruflichen Umfeld durch KI geben wird, warten ab und werden sie dann nutzen, sobald sie es für notwendig halten oder es unumgänglich ist. Diese Gruppe kommt, obwohl sie sicher eine Mehrheit ist, in der öffentlichen Diskussion nicht vor.
Die Fachleute im Rechnungswesen werden sich sicher einer dieser drei Gruppen zuordnen lassen. Gerade in ihrem Aufgabenbereich ist jedoch sowohl überschäumende Erwartung als auch vollständige Ablehnung oder stille Akzeptanz wenig erfolgreich. Sie müssen sich einer Zukunft stellen, die zweifellos eine weitere digitale Entwicklung in Buchhaltung, Kostenrechnung und Controlling beinhalten wird. Dabei müssen sie verstehen, dass KI und die darauf aufbauenden Anwendungen mehr sind als die weitverbreitete Automatisierung, die bereits heute unverzichtbare Unterstützung liefert. Und sie werden die besondere Eignung des Rechnungswesens für die neue Form der digitalen Unterstützung erkennen.
1.1 Warum KI im Rechnungswesen?
Bereits vor einigen Jahrzehnten, als das IT-Team noch EDV-Abteilung hieß, war das Rechnungswesen Vorreiter in der digitalen Anwendung. Die ersten betriebswirtschaftlich nutzbaren Standardprogramme beschäftigten sich mit den Aufgaben der Buchhaltung. Die Kostenrechnung hat früh begonnen, auf digital vorhandene Daten im Unternehmen zuzugreifen und dies immer wieder intensiviert. Im Controlling wurden und werden Office-Programme zur Berechnung und Präsentation ebenso genutzt wie Datenbanken und spezialisierte Controlling-Anwendungen. Digitalisierung ist für die Mitarbeiter im Rechnungswesen kein Fremdwort, Digitalisierung ist in Buchhaltung, Kostenrechnung und Controlling seit vielen Jahren ein wichtiger Erfolgsfaktor.
Die KI nutzt die Informationstechnologie, um auf digitale Daten zuzugreifen, sie zu verarbeiten und digitale Ergebnisse auszugeben. Selbst wenn die Dimensionen wesentlich größer sind als zu der Zeit, in der das EVA-PrinzipEVA-Prinzip definiert wurde, ist KI nichts anderes als eine digitale Anwendung, die nach dem Prinzip der Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe von Daten handelt. Darum sprechen die Kriterien, die für eine grundsätzliche Eignung des Rechnungswesens für digitale Hilfsmittel sprechen, auch für eine Eignung der KI-Anwendung.
DatenDaten
Im Rechnungswesen wächst die Menge der zu verarbeitenden Daten stetig. Eine steigende digitale Vernetzung mit unternehmensinternen und externen Stellen lassen Big Data noch größer werden. Die IT wird immer leistungsfähiger, sodass detailliertere Daten entstehen können und das dadurch größere Volumen verwaltet und verarbeitet werden kann. Manuell sind die anfallenden Datenmengen nicht mehr beherrschbar. Digitale Technik ist erforderlich, um die durch die Digitalisierung entstehenden Datenmengen zu neuen Ergebnissen aufzubereiten.
Beispiel
Wer die digitale Entwicklung der letzten Jahrzehnte betrachtet, der kann beobachten, dass sich z. B. die im Controlling verarbeiteten Umsatzzahlen von monatlichen Werten zu Tageswerten veränderten. Das ist aktuell bereits nicht mehr ausreichend. Bei der Analyse von Verkäufen im Internetshop werden Umsatzentwicklungen der Produkte in Stunden- oder Minutentakt erhoben und festgehalten.
Das Vorhandensein detaillierterer Umsatzdaten führt zum Verlangen nach detaillierteren Auswertungen. Die Digitalisierung schafft so die Nachfrage nach noch mehr digitaler Unterstützung. Eine sinnvolle und erfolgreiche Nutzung der riesigen Datenmengen ist dann nur noch mit digitalen Anwendungen – wie Künstlicher Intelligenz – möglich.
Wachsende Datenmengen gibt es in vielen Bereichen der Unternehmen. Was charakterisiert die Daten im Rechnungswesen, so dass sie sich besonders für die Verarbeitung mit KI eignen? Aus der Buchhaltung kommen klare und einheitliche Strukturen der Daten. Es beginnt damit, dass es sich zum größten Teil um numerische Daten handelt, die in Buchhaltung, Kostenrechnung und Controlling verarbeitet werden. Sie sind eindeutig definiert und durch allgemein übliche Anwendungen standardisiert. So kann ein Datenaustausch selbst mit externen Partnern problemlos eingerichtet werden.
Die Struktur der Daten wird durch zwei Quellen bestimmt:
Der Staat hat in vielen Gesetzen und Normen bestimmt, welche Inhalte wichtige Informationen haben müssen. Damit wird sichergestellt, dass der Gesetzgeber seine Ansprüche vor allem gegenüber den Unternehmen auch durchsetzen kann. Das betrifft z. B. die Bewertung von Lagerbeständen oder die Berechnung von Abschreibungen.
Die betriebswirtschaftliche Forschung hat alle im Rechnungswesen bedeutenden Datenstrukturen und -inhalte definiert. Die Definitionen sind bekannt und werden genutzt. Der entsprechende Informationsgehalt wird zwischen Sender und Empfänger der Daten vorausgesetzt.
Ausnahmen
Die Aussage zu der Bestimmung der Datenstrukturen gilt zunächst für die Anwendung in Deutschland. Es gibt Unterschiede, wenn nationale Grenzen überschritten werden. Vor allem nach der internationalen Rechnungslegung können Daten abweichende Inhalte aufweisen. Das gilt z. B. für den Ansatz der immateriellen Wirtschaftsgüter in der Bilanz. Nach deutscher Rechnungslegung sind z. B. Entwicklungskosten nicht zu aktivieren, nach internationaler Rechnungslegung (IFRS) müssen sie aktiviert werden, wenn das Entwicklungsprojekt erfolgversprechend ist. Das führt zu unterschiedlicher Definition auch des ausgewiesenen Gewinns.
Die großen Datenmengen und die klaren Strukturen der Daten machen den Einsatz digitaler Hilfsmittel im Rechnungswesen besonders lohnend.
AufgabenAufgaben
Die Aufgaben im Rechnungswesen werden ebenfalls durch die beiden Quellen – Staat und Wissenschaft – bestimmt. Insbesondere die Abläufe in der Buchhaltung müssen vielen Vorgaben genügen. So bestimmt der Staat u. a. den Aufbau des Kontenrahmens oder den Ablauf bei den Periodenabschlüssen. Die Betriebswirtschaftslehre gibt vor, wie Rabatte, Skonti oder Boni zu behandeln sind. In der Kostenrechnung mit den stark spezialisierten Aufgaben zeigt sich die Reglementierung durch die Wissenschaft besonders. Das Controlling hat auf den ersten Blick einen wesentlich größeren Spielraum. Einheitliche Strukturen der Abläufe dort ergeben sich jedoch allein schon aus den zu erledigenden Aufgaben.
Allein diese eindeutige Bestimmtheit der Abläufe lässt digitale Unterstützung wertvoll sein. Hinzu kommt noch, dass die zu den Aufgaben gehörenden Abläufe im Rechnungswesen eine hohe Wiederholungsrate aufweisen. Zehntausende von Eingangsrechnungen werden jedes Jahr gebucht, Hunderte von Kostenstellen regelmäßig abgerechnet. Das Controlling plant den Absatz aller Verkaufsprodukte je Stunde, Tag, Woche, Monat und/oder pro Jahr. Je öfter eine Aufgabe erledigt werden muss, desto wirtschaftlicher ist die Schaffung digitaler Abläufe.
Die Reglementierung der Abläufe im Rechnungswesen macht den Aufbau digitaler Strukturen einfacher, die notwendigen Wiederholungen lassen Wirtschaftlichkeit entstehen. Hinzu kommt, dass die Ansprüche an die Ergebnisse der Abläufe steigen:
Die wichtigste Forderung ist die nach schnelleren Ergebnissen. Die starre Bindung der Buchhaltung an Monats- und Jahresperioden machen die Forderung nach Informationen in Echtzeit schwer zu erfüllen. Wenn sich die Nachfrage im Onlineshop minütlich ändert, muss ebenso schnell reagiert werden. Das Vertriebscontrolling muss die entsprechenden Ergebnisse liefern. Echtzeit-Reporting ist nur mit hohem Aufwand und vielen Abhängigkeiten und Vorgaben möglich. Manuell kaum zu schaffen, aber mit KI erscheint das möglich.
Detailliertere Ergebnisse sind notwendig, wenn detailliertere Entscheidungsgrundlagen gefordert werden. Die notwendige Schnelligkeit der Entscheidungen im Vertrieb, in der Produktion oder im Einkauf wird möglich, wenn das Rechnungswesen kleinteiligere Informationen liefert. Entscheidungen werden auf niedrigeren Hierarchiestufen getroffen, um die notwendige Geschwindigkeit zu erreichen. Dort beziehen sich die Entscheider auf kleinere Einheiten, wofür passende und damit detailliertere Inhalte benötigt werden.
Die Forderung nach neuen, zusätzlichen Inhalten der Ergebnisse im Rechnungswesen machen zusätzlich Abläufe notwendig. So verlangt der Staat die Abgabe einer E-Bilanz, der Aufbau ist Aufgabe der Buchhaltung. Der Einkauf muss wichtige Lieferketten permanent überwachen, das Risikomanagement ist ein Service des Controllings. Zusätzliche Abläufe werden geschaffen.
Wirtschaftlich sinnvolle digitale Unterstützung macht die weitere Digitalisierung von Abläufen im Rechnungswesen möglich. Höhere Anforderungen an die Ergebnisse aus Buchhaltung, Kostenrechnung und Controlling machen sie notwendig.
IntegrationIntegration
Das Rechnungswesen verarbeitet Daten aus allen Bereichen des Unternehmens. Ein- und Ausgangsrechnungen, Bestandsveränderungen, Verbräuche oder Gehaltszahlungen werden wie viele andere Daten benötigt, um finanzielle Abschlüsse, Kostenanalysen oder Unternehmensplanungen zu erstellen. Dazu kommen weitere Informationen aus externen Quellen, die die Arbeit in Buchhaltung, Kostenrechnung und vor allem im Controlling bestimmten. Diese wachsende Zahl von Werten muss für die Digitalisierung von Abläufen zur Verfügung stehen. Besonders Anwendungen, die KI einsetzen, sind vor allem dann erfolgreich, wenn ihnen großen Datenvolumen angeboten werden können.
Damit Anwendungen mit KI erfolgreich sind, muss ein möglichst unbeschränkter Zugriff auf die Daten aus internen und externen Quellen gewährleistet sein. Dabei spielt auch die Form des Zugriffs eine wichtige Rolle. Er muss digital erfolgen und verzögerungsfrei möglich sein. Eine solche Integration ist im Rechnungswesen schon seit Langem ein gelebter Standard.
In den Unternehmen werden hoch integrierte IT-Systeme eingesetzt, die meist mit standardisierten ERP-Systemen arbeiten. Oft hat diese Software als Kern die Finanzanwendung, immer werden Daten gemeinsam genutzt. Nutzen einige Fachbereiche nicht die gleiche Standardsoftware wie das Rechnungswesen, wird über meist standardisierte Schnittstellen die notwendige Integration ermöglicht. Der Zugriff auf intern vorhandene Daten ist so durch die enge digitale Zusammenarbeit der Fachbereiche gegeben. Werden für die KI-Nutzung zusätzliche Daten benötigt, können diese über die unternehmensinterne Hierarchie bereitgestellt werden.
Mit Blick auf die digitale Anbindung externer Stellen kann die aktuelle IT-Lösung im Rechnungswesen als Vorreiter bezeichnet werden. In der Buchhaltung sind in den vergangenen Jahren enge digitale Verbindungen aufgebaut worden, z. B. mit den Banken, dem Finanzamt und anderen staatlichen Stellen oder mit Beratern. Der Austausch mit Kunden und Lieferanten beschränkt sich hier meist auf Eingangs- und Ausgangsrechnungen. Die Kostenrechnung hat aufgrund ihrer Aufgaben als internes Rechnungswesen in der Regel kaum digitale Kontakte zu externen Stellen. Wachsenden Anteil haben die externen digitalen Daten im Controlling, wo sie über die wirtschaftliche Entwicklung, Vergleichsunternehmen oder aus den globalen Lieferketten beschafft und verarbeitet werden.
Einbahnstraßen
Die digitale Verfügbarkeit der Daten ist keine Einbahnstraße. Je enger die digitale Zusammenarbeit mit dem internen oder externen Partner ist, desto mehr Daten werden in beide Richtungen ausgetauscht. Banken erhalten Zahlungsanweisungen und die Bewertung von Sicherheiten, liefern dafür Zahlungseingänge und Kontoauszüge. Der Lieferant schickt die elektronische Rechnung und erhält im Austausch ein digitales Zahlungsavis. Das Controlling erhält Informationen zur wirtschaftlichen Entwicklung im Branchenverband und meldet die eigenen Werte digital.
Diese intensive Zusammenarbeit des Rechnungswesens mit den Partnern innerhalb und außerhalb des Unternehmens ist nur dann wirtschaftlich, wenn eine starke digitale Integration der Sender und Empfänger vorhanden ist. Dazu wird die hoch integrierte IT-Anwendung im Unternehmen genutzt. Für Verbindungen, die Unternehmensgrenzen überschreiten, gibt es wirksame Standardschnittstellen, über die ein digitaler Zugriff auf Daten erfolgen kann. Das Rechnungswesen nutzt diese bereits in vielfältiger Weise und hat langjährige Erfahrung in der Nutzung, aber auch im Aufbau solcher Verbindungen.
Eine enge digitale Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern wird im Unternehmen auch außerhalb des Rechnungswesens genutzt. Die längere Erfahrung und weite Verbreitung finden sich jedoch vor allem in der Buchhaltung. Zunächst mussten die Buchhalter gezwungen werden, digitalen Datenaustausch z. B. mit den Banken (Online-Banking) oder mit dem Staat (E-Bilanz) zu praktizieren. Heute sind die Vorteile erkannt und die Anwendungen akzeptiert.
SicherheitSicherheit
Als Alternative zur digitalen Unterstützung für Abläufe im Rechnungswesen bleibt die manuelle Lösung. Diese hat allerdings neben dem erheblichen personellen Aufwand und der fehlenden Geschwindigkeit einen weiteren gravierenden Nachteil: die Fehleranfälligkeit. Wenn Menschen Daten erfassen, kommt es unweigerlich zu Fehlern. Wenn Menschen aufgrund ihrer Erfahrungen intuitiv Entscheidungen treffen, kommt es zu Fehlentscheidungen. Das verzögert die Erledigung der Aufgaben, da Korrekturen notwendig werden. Das führt zu fehlerhaften Ergebnissen, wenn die Mängel nicht früh genug erkannt werden.
Im Rechnungswesen werden die finanziellen Auswirkungen jeder Entscheidung im Unternehmen erfasst und ausgewertet. Im Controlling werden Entscheidungsgrundlagen für alle Fachbereiche erstellt, auf den Ergebnissen des Controllings beruht die erfolgreiche Unternehmenssteuerung. Es gibt also ein starkes Interesse daran, Fehler in Buchhaltung, Kostenrechnung und Controlling zu vermeiden. Die Sicherheit der Verarbeitung konnte durch einen großen Anteil an digitalen Anwendungen mit automatisierten Datenübernahmen und Abläufen wesentlich erhöht werden.
Abhängigkeiten
Noch immer haben viele Buchhalter eine gesunde Skepsis gegenüber den digitalen Integrationen. Jede digitale Schnittstelle führt zu zusätzlichen Abhängigkeiten:
Im Rechnungswesen werden Daten aus internen und externen Quellen verarbeitet, die nicht der Kontrolle des Bereiches unterliegen. Es entsteht eine Abhängigkeit der Qualität der Ergebnisse im Rechnungswesen von der Qualität der Daten der Partner.
Jede digitale Schnittstelle zum Austausch von Daten ist abhängig von der digitalen Technik. Das Netzwerk muss funktionstüchtig sein. Die Server im Rechnungswesen und bei den Partnern müssen zur Verfügung stehen. Plattformen für den Austausch müssen verfügbar sein. Auch wenn die Technik bisher einwandfrei genutzt werden konnte, ist das für IT-Laien schwer durchschaubare, komplexe Netz von digitalen Systemen und digitaler Technik anfällig gegen zufällige Fehler oder kriminelle Angriffe.
Auf diese Abhängigkeit muss reagiert werden. Plausibilitätskontrollen stellen die Korrektheit der Daten sicher, Redundanzen können technische Probleme lösen. Das wird durch KI erfolgreich unterstützt.
Das Rechnungswesen hat einen besonderen Anspruch an die Sicherheit der eigenen Anwendung. Ein hoher manueller Anteil an den Abläufen birgt Risiken, digitale Automatisierung ist auch nicht frei von Gefahren. Mit der Zeit sind vor allem in der Buchhaltung Mechanismen entstanden, die mit digitaler Unterstützung ein hohes Sicherheitsniveau schaffen. Mit weiterer Digitalisierung und vor allem der Nutzung von KI kann dies verbessert werden.
RisikomanagementRisikomanagement
Das Rechnungswesen ist in Bezug auf das Risikomanagement in zwei Punkten betroffen. Zum einen muss das finanzielle Risiko des Unternehmens beurteilt, überwacht und gesteuert werden. Zum anderen bietet das Controlling das Risikomanagement als Dienstleistung für die anderen Fachbereiche an. Der Einkauf will über die Risiken seiner Lieferketten informiert sein und bei Veränderungen schnell reagieren. Der Vertrieb wird über Marktrisiken informiert, die Produktionsabteilung braucht beim Umgang mit Risiken der Fertigungsverfahren die Unterstützung des Rechnungswesens.
Beide Einsatzgebiete, das Risikomanagement innerhalb des Rechnungswesens selbst und das Risikomanagement als Dienstleistung des Controllings, sind so wichtig, dass wir beide noch im weiteren Verlauf detaillierter betrachten werden. Doch warum kann gerade das Risikomanagement an sich von der Digitalisierung und vor allem von der KI profitieren? Das hat mehrere Gründe:
DatenvolumenDatenvolumen: Mit KI gelingt es, große Datenmengen aus dem Rechnungswesen und aus externen Quellen miteinander zu kombinieren und für die Risikobeurteilung zu nutzen. So kann z. B. die digitale Anwendung Finanzdaten aus vielen Finanzplätzen der Welt auswerten und damit das Risiko der Refinanzierung eines langfristigen Bankdarlehens errechnen.
DatenvielfaltDatenvielfalt: Die Beurteilung von Risiken wird besser, wenn neben den mathematischen Werten auch Informationen aus dem Umfeld berücksichtigt werden. KI ist in der Lage, heterogene Daten aus unterschiedlichsten Quellen zu beschaffen und einzuordnen. So kann dann z. B. von allgemeinen Nachrichten über politische Unruhen auf das Risiko einer Lieferkette geschlossen werden.
RisikomodelleRisikomodelle: In den riesigen Datenmengen sind Muster versteckt, die auf zukünftige Entwicklungen schließen lassen. KI ist in der Lage, diese zu erkennen. Daraus werden Risikomodelle erstellt, mit deren Hilfe z. B. von der wirtschaftlichen Entwicklung eines Marktes auf die zukünftigen Umsätze dort geschlossen werden kann.
BetrugserkennungBetrugserkennung: Die KI erkennt selbst kleinste Anomalien in großen Datenmengen. Diese können dadurch entstehen, dass Daten manipuliert worden sind. Damit kann auf mögliche Betrugsvorgänge geschlossen werden. Durch KI ist so eine frühzeitige Erkennung von Bedrohungen in den digitalen Anwendungen möglich.
Echtzeit-ReportingEchtzeit-Reporting: Je früher die Erhöhung der Eintrittswahrscheinlichkeit eines Risikos erkannt wird, desto mehr Möglichkeiten der Reaktion bleiben den Entscheidern. Mit KI können die für die Risikoüberwachung notwendigen riesigen Datenmengen permanent überwacht werden. Die Risikomodelle, z. B. für Lieferketten mit Waren aus China, können kurzfristig an erkannte Entwicklungen angepasst werden.
Compliance-ÜberwachungCompliance-Überwachung: Die Unternehmen kämpfen mit einer Flut an Regularien. Werden die Vorgaben nicht eingehalten, drohen zum Teil enorme Strafen. Mit KI wird die permanente und aktuelle Überwachung der Einhaltung aller Regeln z. B. für den Jahresabschluss oder für einen Nachhaltigkeitsbericht realisiert.
ObjektivitätObjektivität: Auch ohne digitale Unterstützung oder KI werden Risiken von den verantwortlichen Menschen im Unternehmen eingeschätzt und überwacht. Dabei fließt sehr viel subjektive Einschätzung in die Beurteilung ein. Durch digitale Anwendungen wird das Risikomanagement objektiver. So basiert dann die Beurteilung der Abhängigkeit der Rohstoffmengen von dem Wetter während der Wachstumsphase auf vielen objektiven Messungen und nicht auf einer subjektiven Einschätzung.
IntegrationIntegration: Die digitale Anwendung KI ermöglicht es, die Überwachung der Risiken in die digitalen Anwendungen für den täglichen Gebrauch zu integrieren. Dadurch wird das Tagesgeschäft von dem Risikomanagement gesteuert. So kann z. B. bei steigendem Risiko für Lieferungen aus Fernost in der Bestellbearbeitung automatisch ein lokaler Anbieter vorgeschlagen werden.
Vieles spricht für den Einsatz von KI im Risikomanagement, gleichgültig welches Einsatzgebiet gerade betroffen ist. Die digitalen Anwendungen sind dabei nicht nur schneller und objektiver, sie sparen auch den erheblichen Personaleinsatz, den eine manuelle oder teilautomatisierte Risikobetrachtung verlangt.
EntwicklungEntwicklung
Mit KI kann die Digitalisierung weiter vorangetrieben werden. Bisher noch nicht geeignete Anwendungen, vielleicht aufgrund der Komplexität, können mit den neuen digitalen Hilfsmitteln erfolgreich digitalisiert werden. Weitere Entwicklungen führen auch im Rechnungswesen dazu, KI zukünftig in den digitalen Anwendungen zu verwenden.
DatenverfügbarkeitDatenverfügbarkeit: Das Angebot an digitalen Daten steigt, weil es technisch immer unkomplizierter und damit kostengünstiger wird, Inhalte zu erheben und zu speichern. Diese Datenbestände können für die Unterstützung der Arbeit im Rechnungswesen verwendet werden. KI ist in der Lage, das wachsende Datenvolumen mit vertretbarem Aufwand nutzbar zu machen. So müssen neu zu integrierende Datenbestände nicht mehr streng definiert sein, was auch ungeordnete Angebote nutzbar macht.
Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach digitalem Datenaustausch mit internen und externen Partnern. Diese verlangen eine entsprechende Verfügbarkeit der Daten aus dem Rechnungswesen. Mithilfe von KI wird die Überlassung kontrolliert und gesichert.
IntegrationIntegration: Das Rechnungswesen wird in allen Abläufen digital unterstützt. Eingesetzt werden dazu meist standardisierte Softwarepakete. Die KI kann in diese vorhandenen digitalen Systeme integriert werden. Dazu werden einzelne Funktionen der Software mit den neuen Möglichkeiten ausgestattet.
Stiller Migration
Dieser Austausch bisheriger digitaler Funktionen durch KI-unterstützte Abläufe erfolgt in der Regel in den gewohnten Software-Updates. Der einzelne Anwender muss dies nicht unbedingt bemerken. Risiken entstehen, wenn bisherige, exakt reglementierte Funktionen durch die Interpretationen einer KI ersetzt werden. Die Ergebnisse müssen anders eingeordnet werden, zumindest zu Beginn. Der leise, versteckte Austausch kann sowohl für die Ergebnisqualität als auch für die Akzeptanz der KI durch die Mitarbeiter im Rechnungswesen problematisch werden. Wir müssen uns mit diesem Thema gegen Ende des Buches beschäftigen.
Neue SicherheitsfeaturesSicherheitsfeatures: Da aktuell immer mehr Vorgänge digitalisiert werden, entstehen immer mehr digitale Urkunden, Nachweise oder Vorgaben. So werden z. B. Eigentumsnachweise für Maschinen oder Gebäude immer digitaler. Das ruft Kriminelle auf den Plan, die sich über die bestehenden Netzwerke Zugriff verschaffen und Manipulationen vornehmen können. Zusätzliche Sicherheit ist notwendig, neue Sicherheitsfeatures entstehen. So kann z. B. der Eigentumsnachweis für eine wichtige Maschine mittels Blockchain-Technologie erfolgen. KI hilft dabei, diese zusätzlichen und zum Teil neuen Sicherheitsfunktionen einzurichten, einfach zu nutzen und zu überwachen.
Mitarbeiter: Der Fachkräftemangel stellt häufig ein nur temporäres Problem dar, dennoch gibt es immer wieder Lücken im Rechnungswesen, wo kompetente Mitarbeiter fehlen. Eine Möglichkeit der Reaktion darauf ist es, die digitale Unterstützung auszubauen. Mit KI erschließen sich dabei viele neue Einsatzfelder, die bisher aufgrund zu komplexer Abläufe und anspruchsvoller Entscheidungen nur wenig IT-Unterstützung erhalten haben.
Regulierungen: Jeder Politiker verspricht den Abbau der überbordenden Bürokratie, die Realität sieht anders aus. Jeder Bürgermeister, jeder Landrat, die Länder, der Bund und die EU regieren in die Unternehmen hinein. Besonders betroffen ist das Rechnungswesen, weil viele dieser Vorschriften den finanziellen Aspekt betreffen. KI hilft dort auf zwei Arten. Zum einen kann KI verwendet werden, um neue Regularien zu erkennen und in das System einzupflegen. Zum anderen kann bei der Erledigung dieser Aufgaben die KI eingesetzt werden, um notwendigen Informationen zusammenzutragen und die verlangten Berichte, Meldungen oder Nachweise zu erstellen.
Der Ausgangspunkt für dieses Kapitel war die Frage nach der besonderen Eignung des Rechnungswesens für den Einsatz von KI. Die beschriebenen Kriterien treffen ebenfalls auf andere Unternehmensbereiche zu, meist aber nur teilweise. Denn aufgrund
der zentralen Rolle des Rechnungswesens im Unternehmen,
der dort zu erledigenden Aufgaben und
der langjährigen Erfahrungen mit IT-unterstützten Abläufe
gibt es eine besondere Situation, die den Einsatz der KI in Buchhaltung, Kostenrechnung und Controlling besonders lohnend macht.
1.3 Entwicklung im Rechnungswesen
Das Rechnungswesen ist wesentlicher Teil eines Unternehmens, aufgrund seiner Aufgabe eng verbunden mit den Abläufen in Verkauf, Einkauf, Produktion und allen anderen Bereichen. Es existiert eine gegenseitige Abhängigkeit. Auf der einen Seite werden im Rechnungswesen die Daten aus den Fachbereichen verarbeitet, auf der anderen Seite verwenden die Fachbereiche die Ergebnisse aus dem Rechnungswesen für ihre Arbeit.
Buchhaltung, Kostenrechnung und Controlling müssen sich nicht nur den Entwicklungen im eigenen Bereich stellen, sondern auch denen in ihrem Umfeld. Weder inhaltliche noch organisatorische oder technische Entwicklungen dürfen ignoriert werden. Viele der notwendigen Veränderungen in den Abläufen des Rechnungswesens sind durch KI möglich.
Zusätzliche Regularien
Nicht nur im Bereich der Energienutzung und dem CO2-Ausstoß sind weitere gesetzliche Vorgaben zu erwarten. Die Verantwortung für Lieferketten wird aktuell noch diskutiert, wird aber in Zukunft zu weiteren Erhebungen und Protokollen führen. In der Steuerpolitik sind zusätzliche Änderungen zu erwarten, ebenso in der Förderungspolitik. Die politische Lage führt zu der Notwendigkeit, Sanktionen zu beachten und dies nachzuweisen. Das alles schafft neue Aufgaben im Rechnungswesen.
Diese erhöhen die Komplexität der bereits bestehenden Anwendungen, verlangen nach mehr Daten, Verarbeitungen und Entscheidungen. Leider ist die Befriedigung dieser neuen und zusätzlichen Ansprüche mit einem hohen Aufwand verbunden. Eine manuelle Bearbeitung ist nicht mehr praktikabel, digitale Automatisierung nicht ausreichend und zu wenig flexibel. Mit neuen, KI-basierten Anwendungen kann der Aufwand wesentlich reduziert werden. Hinzu kommt, dass die Sicherheit für die Verantwortlichen in Buchhaltung, Kostenrechnung und Controlling steigt, wenn KI eingesetzt wird, um die Regularien zu beobachten und auf Veränderungen zu reagieren.
Wachsende Dynamik
Die Veränderungsrate in den Märkten steigt wesentlich. Umsatzveränderungen werden nicht mehr in Monaten oder Jahren gemessen, sondern in Stunden und Minuten. Die hohen Risiken in globalen Lieferketten schwanken kurzfristig. Die Einstellungen der Fertigungsanlagen werden in Abhängigkeit aktueller Kosten für Energie optimiert. Es entsteht eine Dynamik auf den Märkten, die ebenso dynamische Entscheidungen in den Unternehmen verlangen, wenn der Erfolg am Absatzmarkt garantiert werden muss.
Wenn das Unternehmen zu schnellen Entscheidungen gezwungen wird, müssen die dazu notwendigen Informationen schnell und aktuell zur Verfügung stehen. Die an den Periodenabschluss gebundene Buchhaltung sieht sich der Notwendigkeit gegenüber, aktuelle Daten in Echtzeit verfügbar zu machen. Das Controlling braucht Anwendungen, in denen zielgenau Berichte für frühzeitige Entscheidungen erstellt werden. Die Kostenrechnung muss nicht nur die Produktionssteuerung mit minutengenauen Informationen versorgen.
Mit digital automatisierten Abläufen oder gar manuell ist dieser wachsenden Dynamik im Rechnungswesen nicht Herr zu werden. KI-Lösungen analysieren die ihnen zugewiesenen Bereiche permanent, erkennen die Entwicklung dort und können früh- und damit rechtzeitig Handlungsempfehlungen geben oder sogar selbst Entscheidungen treffen und durchführen.
Steigende DatenvolumenDatenvolumen
Das Volumen der im Rechnungswesen und vor allem im Controlling zu verarbeitenden Daten vergrößert sich enorm. Nicht nur die Anzahl der Quellen wächst, auch der Grad der Detaillierung und damit die Anzahl der Daten steigt dramatisch an.
Beispiel
Wo das Controlling in der Vergangenheit einen Umsatz pro Tag und Geschäft feststellte, entstehen heute im Onlineshop wesentlich größere Datenmengen. Hier wird z. B. für jeden Artikel ein Umsatz pro Minute festgehalten. Das macht bereits bei nur 100 Artikel im Shop 144.000 Umsatzdaten pro Tag. Aus 26 Daten im Monat, das sind im Durchschnitt für jeden Verkaufstag ein Inhalt, werden über 4,3 Mio. Daten für die Umsatzverteilung von 100 Artikeln im 24-stündigen Betrieb des Onlineshops.
Hinzu kommen weitere Datenquellen, die kontinuierlich Informationen für das Marketing, das Controlling oder den Finanzbereich liefern. Dabei haben CRM-Systeme, Websites oder Social Media in der Regel keine feste, bekannte Struktur. Solche Daten, unstrukturiert und in großen Mengen, können nur mithilfe von KI wirtschaftlich verarbeitet werden.
Zukunftspläne
Führungskräfte in allen Unternehmensbereichen werden zunehmend an der erfolgreichen Durchsetzung ihrer Strategien gemessen. Nicht mehr der Erfolg der Vergangenheit zählt, sondern der Aufbau und die Umsetzung erfolgreicher Strategien. Nur mit umfangreichen Informationen aus dem Rechnungswesen kann das gelingen. Die traditionellen Methoden, die mit Daten allein aus dem eigenen Rechnungswesen und mit Erfahrung der Menschen arbeiten, müssen ersetzt werden.
KI bietet die Instrumente, mit denen riesige Datenmengen aus der Vergangenheit und Informationen über die Zukunft zu einer Strategie geformt werden können, die eine hohe Wahrscheinlichkeit der Realisierung bietet. Mithilfe der neunen digitalen Technik entstehen viele Szenarien, in denen die Auswirkungen von Investitionen, Marktkämpfen oder Krisen auf das Unternehmen simuliert und bewertet werden. Das Ergebnis ist eine Strategie, die alle möglichen Entwicklungen berücksichtigt und die höchste Wahrscheinlichkeit aufweist.
Gesellschaftspolitik
Jedes Unternehmen ist in eine Gesellschaft eingebettet. Die einzelnen Gruppen darin haben eigene Forderungen gegenüber dem Unternehmen. Eigentümer, Manager, Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Nachbarn und viele mehr formulieren verbindliche Vorgaben oder unverbindliche Wünsche. Gesetzliche Diskriminierungsverbote gehören ebenso dazu wie der Lärmschutz für die Nachbarschaft oder der Wunsch der Kunden nach mehr Regionalität. Das birgt für die Unternehmen und für deren Rechnungswesen, das die notwendigen Daten dazu aufbereiten muss, zwei Herausforderungen:
Die gesellschaftspolitischen Trends und die sich daraus ergebenden Anforderungen verändern sich permanent und schnell. Wer die Notwendigkeit der Reaktion zuverlässig einschätzen will, muss diese Entwicklungen frühzeitig erkennen. Das ist bei der Vielzahl der Themen und der Komplexität der Inhalte mit KI-Unterstützung möglich.
Die Erfüllung solcher Forderungen verlangt oft die Berücksichtigung vieler unstrukturierter Daten. Die Beurteilung der Nachhaltigkeit oder die ethisch korrekte Behandlung aller Beteiligten einer Lieferkette fußt vielfach auf manuellen Berichten, Reports aus exotischen Ländern oder ungeregelten Selbstauskünften. Um diese Daten wirtschaftlich sinnvoll und inhaltlich korrekt zu analysieren und zu bewerten, wird KI eingesetzt.
GlobalisierungGlobalisierung
Globales Agieren ist für viele Unternehmen überlebenswichtig. Der Absatz der Produkte auf internationalen Märkten fördert den Erfolg, der Einkauf von Waren in Asien, Afrika oder sonst auf der Welt kann wirtschaftlich notwendig sein. Der Umgang mit unterschiedlichen Kulturen, die Nutzung unbekannter Sprachen, die verschiedenen Rechtsräume, Währungen und Standards erfordert einen hohen Aufwand. KI hilft zukünftig dabei, diesen wirtschaftlich zu gestalten.
So kann die Umrechnung von Währungen ebenso durch eine KI-Anwendung erfolgen wie die Übersetzung von Korrespondenz oder Dokumenten. Die rechtssichere Steuererklärung für die betroffenen Staaten wird erstellt, die Buchungen in der Buchhaltung für verschiedene Rechnungslegungsstandards parallel ausgeführt. Das macht die Nutzung der globalen Märkte für viele vor allem kleine und mittlere Unternehmen erst möglich.
Globale Lieferketten unterliegen einem höheren Risiko als regionale Beschaffungswege. Das gilt auf der anderen Seite für die Absatzwege in weit entfernte Länder oder in Nachbarstaaten der EU. Klimakrisen, Probleme auf den Transportwegen oder Vorgänge innerhalb der Lieferkette, die bei uns die Kunden vom Kauf abhalten würden, in den Ländern der Lieferkette aber akzeptiert werden, erhöhen das Risiko globaler Aktivitäten. Es werden Abläufe notwendig, die Risiken überwachen, Alarm geben oder selbst aktiv werden. KI-Unterstützung wird dies in Zukunft ermöglichen.
RisikomanagementRisikomanagement
Nicht nur die globale Vernetzung erhöht die Risiken für ein Unternehmen. Alle Aktivitäten sind bedroht, sei es durch Cyberangriffe, Pandemien oder politische Instabilität. Das Risiko des finanziellen Verlustes steigt. Das wird sich in Zukunft nicht ändern, sogar noch verstärken. Nur wenn diese Risiken in einem systematischen Management überwacht werden, können Entwicklungen frühzeitig erkannt werden und Reaktionen rechtzeitig erfolgen.
Dazu sind Echtzeitdaten notwendig, die permanent überwacht werden. Das ist eine typische Aufgabe für KI. So kann die Analyse von Inhalten auf Social-Media-Kanälen in den Erzeugerländern wichtiger Rohstoffe Hinweise auf entstehende politische Krisen geben. Die Beschaffung kann als Reaktion darauf regional erfolgen, Vorräte werden angelegt. So wird zwar die Krise nicht vermieden, eine Vorbereitung darauf ist jedoch dank KI möglich.
Eingebettet in das gesellschaftliche Umfeld kann sich das Rechnungswesen den Anforderungen, die aus vielen Veränderungen entstehen, nicht entziehen. Buchhaltung, Kostenrechnung und Controlling müssen sich weiterentwickeln, um ihre Aufgabe im Unternehmen erfüllen zu können. Das kann mit manuellen Mittel oder traditionellen IT-Anwendungen geschehen. Ob die KI dabei helfen kann, noch besser und wirtschaftlicher zu werden, wird sich zeigen.
Noch ist der Einsatz von KI in ständigen Abläufen selten, und selbst die Integration eines Chatbots in eine Buchhaltungsanwendung wird als Fortschritt verkauft. KI kann viel mehr und wird das in Zukunft auch zeigen. Wenn in diesem Buch Anwendungsmöglichkeiten beschrieben werden, sind diese technisch machbar, oft allerdings erst im Entwicklungsstadium. Wer diese Möglichkeiten kennt, kann Forderungen an die Entwickler stellen und somit die Entstehung neuer KI-Unterstützungen beeinflussen. Bevor einzelne KI-Anwendungen zu einer einheitlichen Software für das Rechnungswesen zusammengefügt werden, wird noch einige Zeit vergehen. Wenn die Entwickler KI geschickt auch für ihre eigene Arbeit nutzen, wird der Zeitraum bis zur KI-Software für das Rechnungswesen schneller vergehen als viele erwarten.
2 Grundlagen der Künstlichen Intelligenz
Künstliche Intelligenz ist ein Teilgebiet der Informatik. Darin wird die menschliche Fähigkeit zu lernen, Zusammenhänge zu erkennen, Probleme zu lösen und Entscheidungen zu treffen, nachgeahmt. Die Frage an ChatGPTChatGPT, ein KI-Sprachmodell des US-amerikanischen Unternehmens OpenAI, nach einer Definition von KI, hat u. a. die folgende Antwort erzeugt:
Abb. 1:
Antwort ChatGPT
Diese Definition ist wenig speziell und lässt viel Spielraum, den das Rechnungswesen auch nutzen sollte. ChatGPTChatGPT (Chat generative pre-trained transformer) ist nicht das einzige Sprachmodell, das mit KI versucht, einen Dialog mit Menschen zu führen. Andere Anbieter sind z. B. YouChatYouChat, Google GeminiGoogle Gemini, ClaudeClaude oder PerplexityPerplexity. Ob alle Angebote in den kommenden Monaten und Jahren überleben werden, muss sich noch zeigen. Der Markt ist umkämpft und sehr unruhig. Das verdeutlicht das während der Arbeit an diesem Buch aus China vorgestellte Sprachmodell DeepSeekDeepSeek, das in der Entwicklung deutlich geringere finanzielle Mittel verbraucht haben soll als die übrigen Modelle, die fast alle in den USA entwickelt wurden. Europa spielt nicht nur bei den Sprachmodellen, sondern in der gesamten KI-Entwicklung eine untergeordnete Rolle.
KI-Sprachmodelle sind Anwendungen, die KI nutzen, mit einer benutzerfreundlichen Schnittstelle zwischen KI und Menschen. Diese ermöglichen in einem Dialog zwischen Mensch und Maschine, Probleme zu lösen und Informationen zu beschaffen. Beim Einsatz von KI in autonomen Prozessen stammen die »Fragen« nicht von Menschen, sondern aus digitalen Anwendungen. Die Antworten werden nicht am Bildschirm ausgegeben, sondern direkt in die Anwendungen zurück. Die dahinterliegende Technik, die von der IT genutzt wird, um KI zu schaffen, ist identisch. Ebenso gelten die Anforderungen an die Daten für deren Verarbeitung durch KI.
Es wäre überraschend, wenn die KI und ihre Anwendung in unserer pluralistischen Gesellschaft nicht kontrovers diskutiert würde. Es gibt Totalverweigerer und Superoptimisten, es gibt aber auch die große, oft schweigende Mehrheit derjenigen, die KI verantwortungsvoll zum Vorteil der Gesellschaft nutzen wollen. Über die selbstverständlich auch für die KI geltenden aktuellen Gesetze hinaus entstehen neue Normen, bestehende Normen werden angepasst. Die EU-Verordnung versucht in einem ersten Anlauf, den Bürger zu schützen. Dabei geht es nicht um die Technik an sich, sondern um die Möglichkeiten ihrer Anwendung. Neue Gesetze drohen mit Beschränkungen oder versprechen Schutz, je nach Sichtweise.
Ein letzter Punkt in diesem Überblick über technische und organisatorische Grundlagen der KI beschäftigt sich mit der Ethik. KI wird nur dann unumstritten werden, wenn es gelingt, die mit KI getroffenen Entscheidungen ethisch zu machen.
Der Einsatz von KI in automatisierten Prozessen oder in menschlicher Entscheidungsfindung ist also nicht unumstritten. Die Technik entwickelt sich weiter, damit wachsen die Einsatzbereiche auch im Rechnungswesen. Um den KI-Einsatz im Rechnungswesen richtig einschätzen zu können und erfolgreich zu implementieren, ist es nicht notwendig, ein KI-Experte zu sein. Dieser Überblick über die Grundlagen ist jedoch hilfreich.
2.1 Technik
Die Technik der KI ist zweigeteilt. Zunächst ist die KI eine IT-Anwendung, die mit entsprechenden Geräten und Systemen arbeitet. Die in den Geräten vorhandenen Besonderheiten sind für den Nutzer der KI-Anwendungen nicht entscheidend. Er muss seine IT-Techniker dazu bringen, die für seine Problemstellung optimale Hard- und Systemsoftware einzusetzen. Wir werden darauf nur kurz eingehen, bevor wir die Arbeitsweise der KI als zweiten Teil der KI-Technik darstellen.
2.1.1 Geräte und Systeme
KI-Anwendungen brauchen viel Speicherplatz und Rechenkapazität. Es müssen riesige Datenmengen verfügbar sein und verarbeitet werden. Das funktioniert auch mit der bisher üblichen, leistungsfähigen Hardware, allerdings nicht immer in einer zufriedenstellenden Geschwindigkeit.
Energie
Für die Nutzung von KI werden wesentlich höhere technische Kapazitäten benötigt als für übliche IT-Anwendungen. Bei aller Euphorie über die Vorteile der KI, auch im Hinblick auf gesellschaftspolitische Entwicklungen, wird dabei meist vergessen, dass zusätzlicher Speicherbedarf und steigende Rechenleistung zwangsläufig mit einem wachsenden Energieverbrauch einhergeht. Wenn also z. B. die notwendige intelligente Steuerung der Stromverteilung für erneuerbare Energien durch die Nutzung von KI erreicht werden muss, entstehen allein dadurch signifikante zusätzliche Energieverbräuche. Wie immer in der Technik werden sich diese in Zukunft sicherlich optimieren lassen, vernachlässigt werden darf das Thema nicht.
Die Evolution der KI umfasst, neben der Programmierung von KI-Modelle, die Entwicklung der notwendigen Technik. Die Technik wird bestimmt durch unterschiedliche, auf die verschiedenen Arbeitsweisen der KI angepasste Computerchips, die für die erforderliche Geschwindigkeit notwendig sind.
GPU (Graphics Processing Unit)GPU (Graphics Processing Unit)
Ursprünglich wurden GPUs für die schnelle und detaillierte Darstellung von Bildern in Computerspielen entwickelt. Sie bieten die notwendigen Kapazitäten für darüber hinaus gehende Anwendungen, z. B. für das Schürfen von Kryptowährungen oder eben für KI. Diese Prozessoren können eine Vielzahl von Aufgaben parallel durchführen und arbeiten sehr effizient. Ihre besondere Eignung für die Verarbeitung von Daten in Echtzeit macht sie auch für das Training von KI-Anwendungen, Verarbeitung von Big Data oder die parallele Berechnung vieler Szenarien wertvoll.
Der Technologievorteil für diese Chips liegt in den USA, wo Hersteller wie NVIDIA, Intel oder AMD beheimatet sind. In Taiwan befindet sich ebenfalls ein Zentrum der Produktion dieser Chips, die in der Weiterentwicklung von den US-Technologiefirmen zu größeren Einheiten kombiniert werden.
Volatilität
Wie beeinflussbar und anfällig das gesamte Umfeld der KI ist, zeigen zwei aktuelle Entwicklungen:
Als in China DeepSeekDeepSeek vorgestellt wurde, war die Fachwelt von der effizienten Arbeitsweise des KI-Sprachmodells überrascht. Der geringere Bedarf an Rechenleistung ließ am Markt eine geringere Nachfrage nach leistungsfähigen GPUs erwarten. Der Aktienkurs von NVIDIA sank um 17 %.
Kurz nach der Amtseinführung von Donald Trump als 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika präsentierte dieser eine private Initiative großer US-amerikanischer Digitalunternehmen. Diese wollen 500 Milliarden US-Dollar in ein gigantisches Rechenzentrum investieren, das die für KI-Anwendungen notwendige Rechenleistung zur Verfügung stellen soll.