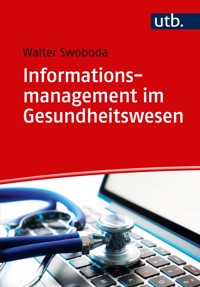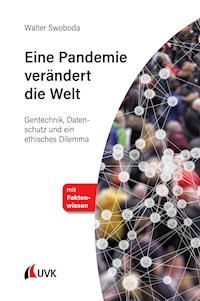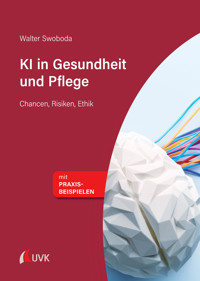
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UVK
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihre KI Künstliche Intelligenz durchdringt alle Bereiche des Lebens - auch das Gesundheitswesen. Walter Swoboda zeigt in seinem Buch, wie die KI funktioniert, welche Varianten dieser neuen Technologie in Gesundheit und Pflege zum Einsatz kommen können und welche Einsatzgebiete sich kurz- und langfristig ergeben. Auf Chancen, Risiken und ethische Herausforderungen geht er ein. Auch experimentelle Verfahren der Zukunft berücksichtigt er. Das Buch richtet sich an Praktizierende, Forschende und Studierende in den Bereichen Gesundheitswesen, Gesundheitsmanagement, Gesundheitsinformatik, Medizin, Pflegewissenschaften sowie Medizinethik.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Walter Swoboda
KI in Gesundheit und Pflege
Chancen, Risiken, Ethik
Umschlagabbildung: © Ivan Bajic ∙ iStock
Autorenbild: © privat
DOI: https://doi.org/10.24053/9783381113125
© UVK Verlag 2024— Ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
ISBN 978-3-381-11311-8 (Print)
ISBN 978-3-381-11313-2 (ePub)
Inhalt
Danksagung
Ich bedanke mich bei Prof. Dr. Bernhard Bauer von der Universität Augsburg und den Teilnehmern des gemeinsamen Workshops zu KI-Anwendungen in Medizin und Pflege im Rahmen der BayWISS-Jahrestagung 2023. Die erarbeitete Liste denkbarer KI-Anwendungen im Gesundheitswesen ist eine wichtige Grundlage für dieses Buch. Bei Prof. Dr. Manfred Spitzer danke ich für den Hinweis auf den Artikel zur Optimierung der Erkennungswahrscheinlichkeit bei neuronalen Netzwerken. Außerdem danke ich Daniel Hieber, M.Sc., für die interessanten Gespräche zum Thema.
Vorwort
Ich habe gerade von einem Programmierer gelesen, der ein 30 Jahre altes Computerspiel namens Doom1 auf einem elektronischen Schwangerschaftstest zum Laufen gebracht hat. Dabei hat er ein wenig geschummelt, denn er benötigte zusätzlich einen externen Minicomputer der 5-Euro-Klasse. Trotzdem ist das eine erstaunliche Leistung. Vor 30 Jahren lief Doom nur auf gut ausgestatteten PCs, heute reichen ein Stück Technikschrott und eine billige Zusatzplatine. Billigste Hardware genügt, um ein einst anspruchsvolles Programm laufen zu lassen.
Wie wird die Welt in den nächsten 30 Jahren aussehen? Wenn die Entwicklung so weiter geht wie bisher, dann werden viele KI2-Systeme, die wir heute nutzen, auf so ziemlich jedem Gerät laufen, die irgendwelche Elektronik enthält. Wird mir dann meine elektrische Zahnbürste Vorwürfe machen, wenn ich mir abends die Zähne zu kurz reinige? Das tut sie heute schon. Aber die „intelligente“ Zahnbürste der Zukunft kann nicht nur meckern, sie kann auch mit mir diskutieren, sich mit anderen Geräten austauschen oder meine Daten an die Krankenversicherung senden, wenn sie das für richtig hält. Ich kann mir gut vorstellen, dass eine Versicherung die Zahnbürste bezahlt, den Kunden aber dafür verpflichtet, sich die Zähne regelmäßig und gründlich zu putzen. Tut er das nicht, erhöht sich der Eigenanteil bei der nächsten Zahnbehandlung. Ob und wie ich meine Zähne putze, entscheiden dann nicht mehr ich oder mein Zahnarzt, sondern meine Zahnbürste. Sie wäre „intelligent“, wie meine Wohnung, mein Autoschlüssel, mein Wecker und wahrscheinlich auch meine Kleidung.
Auch in medizinischen und pflegerischen Geräten wird KI massiv zum Einsatz kommen. Während ich bei meinen Alltagsgegenständen hoffentlich noch eine gewisse Wahlmöglichkeit habe, wird es hier schon etwas heikler, denn die Medizin spielt wie so oft eine besondere Rolle. Damit meine ich nicht die eingesetzte Technik, die unterscheidet sich nicht wesentlich von anderen Anwendungsbereichen. Aber in der Medizin geht es um die eigene Gesundheit, manchmal sogar um die eigene Existenz, und natürlich will jeder die beste Behandlung.
Wenn wir in nichtmedizinischen Bereichen auf KI verzichten, werden vielleicht einige Prozesse nicht optimal ablaufen und einige Entscheidungen falsch oder verspätet getroffen. Das ist nicht schön, aber damit könnten wir leben. Aber welcher schwer kranke Mensch würde freiwillig auf ein Verfahren verzichten, das sein Leben verlängern oder ihn sogar heilen könnte?
Die Medizin ist daher ein wichtiges, wenn nicht sogar das wichtigste Einfallstor für Anwendungen der künstlichen Intelligenz.
Der Herbst 2022 wird in die Geschichte der Informatik eingehen, da die Firma OpenAIOpenAI das Programm ChatGPTChatGPT in Betrieb nahm. Ein historischer Durchbruch. Wer sich mit dem System unterhält, hat das Gefühl, einen Menschen vor sich zu haben, mit dem man sich zwanglos unterhalten kann. Allerdings verfügt ChatGPT über deutlich mehr Wissen als vergleichbare Systeme und beherrscht zudem fast alle gängigen Sprachen.
Nach einigen Versuchen habe ich die Probe aufs Exempel gemacht und ChatGPT mit einer kompletten Bachelorarbeit beauftragt. Eigentlich dachte ich nicht, dass etwas Vernünftiges dabei herauskommen würde. Meine bisherigen Erfahrungen mit solchen Konversationssystemen waren eher ernüchternd. Die Programme beherrschten meist nur ein mittelmäßiges Englisch und die Gespräche verliefen recht eintönig.
„Neue Entwicklungen der Digitalisierung in der Pflege“, so sollte der Titel lauten. Die Maschine lieferte fast augenblicklich eine mögliche Gliederung, deren Überschriften ich wieder einspeiste mit der Bitte, zu jedem Punkt zwei bis vier Seiten zu schreiben. Ich fasste die Texte zusammen und bat ChatGPT, sie mit geeigneten Literaturangaben zu ergänzen, die ebenso prompt geliefert wurden. Längere Sätze sind orthographisch und grammatikalisch korrekt und die Kommasetzung ist besser, als ich es gewohnt bin. Die Ausgabegeschwindigkeit war in Ordnung und insgesamt machte das System einen recht „erwachsenen“ Eindruck.
Insgesamt habe ich für die 40 Seiten nur knapp 15 Minuten gebraucht. Um ehrlich zu sein, es hat nicht einmal so lange gedauert, da ich gleichzeitig online mit einer etwas eintönigen Videokonferenz beschäftigt war.
Die Bachelorarbeit, die dabei herausgekommen ist, ist zwar kein Meisterwerk, aber ganz ansehnlich. Ich fügte ein Deckblatt mit einem fiktiven Namen hinzu und gab das Ganze einem Kollegen. Ich hatte ihn nicht gebeten, die Arbeit genau durchzusehen. Er sollte nur sagen, welche Note er nach grober Durchsicht empfehlen würde. 2,7 war seine Empfehlung. Nicht gerade das, worauf man stolz sein kann, aber weit davon entfernt, durchgefallen zu sein. Ein gutes Ergebnis, wenn man bedenkt, wie einfach und schnell es ging.
Später sah ich mir den Text genauer an und entdeckte etwas, das mich erstaunte: Von den insgesamt 23 Zitaten waren gerade einmal drei „echt“, also tatsächlich vorhanden. Die anderen 19 waren frei erfunden. Ich jedenfalls konnte weder die Autoren noch die Titel der zugrundeliegenden wissenschaftlichen Arbeiten finden. Allerdings waren diese „Literaturstellen“ so gut gemacht, dass sie ohne weiteres als authentisch durchgingen. Erst nach intensiver Suche in wissenschaftlichen Literaturdatenbanken konnte ich aufdecken, dass es sie nicht gibt.
Kann eine Maschine lügen und wenn ja, warum so gut? Was bedeutet das für Gesundheit und Pflege?
Unser Gesundheitssystem wird sich dramatisch verändern, so viel ist sicher. Wohin es sich entwickelt und warum, ist Gegenstand dieses Buches. Im → Vorwort gehe ich kurz auf die geschichtliche Entwicklung der KI ein, dann folgt → Kapitel 1 mit den technischen Grundlagen. Dabei können wir auf Formeln oder komplizierte Beschreibungen von Algorithmen verzichten, weil die Systeme bis zu einem gewissen Grad nach einfachen, ja trivialen Prinzipien funktionieren. Es gibt so viele Parallelen zu biologischen Prozessen, dass auch die Medizin nicht zu kurz kommt. Denn es ist wichtig, zu wissen, wie Gehirne funktionieren, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu Computern zu verstehen. Und weil Chatbots die derzeit leistungsfähigsten Beispiele für KI sind, gibt es ein eigenes → Kapitel 2 dazu. Zunächst beschäftigen wir uns in → Kapitel 3 mit der Frage, welche Voraussetzungen für den Einsatz von KI-Systemen in Medizin und Pflege notwendig sind, bevor ich in den → Kapiteln 4 bis 9 mögliche Szenarien beschreibe. Dabei erhebe ich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber die beschriebenen Einsatzfelder haben eine hohe Realisierungswahrscheinlichkeit. Welche Regeln wir dabei beachten sollten, ist Gegenstand von → Kapitel 10. Am Ende des Buches, in → Kapitel 11, konnte ich es mir nicht verkneifen, über Dinge zu sprechen, die in fernerer Zukunft liegen. Lassen Sie sich überraschen.
Ist KI in Medizin und Pflege nun Fluch oder Segen? Urteilen Sie selbst! Dieses Buch liefert Ihnen Grundlagen, Anregungen, Szenarien und mögliche Konsequenzen. Es kann die eigene Auseinandersetzung nicht ersetzen.
im April 2024
Walter Swoboda
Genderhinweis | Der Autor verzichtet auf verkürzte Formen zur Kennzeichnung mehrgeschlechtlicher Bezeichnungen im Wortinneren und verwendet in der Regel das generische Maskulinum.
Kapitel 1 | Denkende Maschinen
Rechenmaschinen
Die Natur nachzuahmen war schon immer verlockend und hat die Menschen zu Höchstleistungen angespornt. So manche alte Tischuhr ist mit einer komplizierten Mimik ausgestattet, das singende Vögel, tanzende Paare oder Ähnliches simuliert. Wo das nicht reichte, wurde auch schon mal geflunkert. Wolfgang von Kempelenvon Kempelen, Wolfgang baute 1769 einen mechanischen Schachspieler, der zur Verblüffung seiner Zeitgenossen viele Partien gewann. In Wirklichkeit war die Schachfigur auf einem Tisch befestigt, hinter dem sich eine kleine Person versteckte, die die Maschine mit Hilfe eines Apparats bediente. Immerhin waren solche Apparate mindestens 150 Jahre lang die Attraktion auf Jahrmärkten. Es ist eben faszinierend, einen „lebenden“ Automaten zu besitzen, den man selbst geschaffen hat.
Wissen | Wolfgang von Kempelen (1734–1804) war ein ungarischer Mechaniker, Erfinder und Staatsbeamter.
Wolfgang von Kempelens mechanischer Schachspieler
Automaten wurden ursprünglich auch nicht gebaut, um Rechenaufgaben zu lösen, Texte zu schreiben oder als Kommunikationsmittel zu dienen. Ein Ziel war von Anfang an, Menschen oder Tiere so gut wie möglich nachzuahmen. Die Idee einer denkenden Maschine ist so alt wie die ersten Rechenmaschinen.
Als die ersten Computer mit ihren damals ungeheuren Möglichkeiten gebaut wurden, schien es, als würden alle Grenzen fallen. Der IT-Pionier Joseph WeizenbaumJoseph Weizenbaum, Joseph, meint, dass die Informatik und insbesondere das Fachgebiet der Künstlichen Intelligenz (KI) schon immer große Erwartungen geweckt oder sogar Symptome von Größenwahn gezeigt habe: „Wenn wir heute etwas nicht haben, werden wir es morgen oder übermorgen haben.“ So gingen die frühen Computerpioniere fest davon aus, dass sich in wenigen Jahren jeder mit seinem Computer wie mit einem Mitmenschen unterhalten könne. Selbstfahrende Züge und Autos schienen nur eine Frage der Zeit.
Wissen | Joseph Weizenbaum (1923–2008) war ein deutsch-US-amerikanischer Informatiker und Pionier der KI.
Nicht wenige Dystopiker warnten davor, dass RoboterRoboter mit Computergehirnen die Menschheit unabwendbar versklaven würden. Im Film, wie in Stanley KubricksKubrick, Stanley Meisterwerk Odyssee 2001, handeln Maschinen autonom und nicht selten gegen die Interessen ihrer Schöpfer.
Wissen | Stanley Kubrik (1928–1999) war ein US-amerikanischer Fotograf, Filmemacher und Produzent.
Es gibt eine schöne Kurzgeschichte von Isaac AsimovAsimov, Isaac in der ein neu ausgepackter und installierter Roboter nicht glauben mag, dass er von „unvollkommenen“ Menschen geschaffen wurde. Da er jedoch seine Aufgaben weiterhin erfüllte, beließen ihn die Protagonisten der Erzählung schließlich dabei.
Wissen | Isaac Asimov (1920–1992) war ein russisch-amerikanischer Biochemiker und Autor zahlreicher Sachbücher und Science-Fiction-Romane.
I, Robot ist ein neuerer Film (2004), der auf einer Geschichte von Asimov aus dem Jahr 1950 basiert. Hier werden allen Robotern die „Robotergesetze“ auferlegt, was sie dann jedoch nicht hindert, ihre Unabhängigkeit zu fordern. Asimov nahm seine Gesetze durchaus ernst. Er war fest davon überzeugt, dass Maschinen bald eine neue, intelligente Lebensform begründen werden. Seine Regeln sind als erste Grundlage für ein Zusammenleben von Menschen und Automaten gedacht.
Wissen | Asimov’sche RobotergesetzeAsimov’sche Robotergesetze
Ein RoboterRobotergesetz darf kein menschliches Wesen verletzen oder durch Untätigkeit zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird.
Ein Roboter muss den ihm von einem Menschen gegebenen Befehlen gehorchen – es sei denn, ein solcher Befehl würde mit Regel eins kollidieren.
Ein Roboter muss seine Existenz beschützen, solange dieser Schutz nicht mit Regel eins oder zwei kollidiert.
Die InformatikInformatik hat sich in der Zwischenzeit rasant weiterentwickelt und Computer haben alle Bereiche des menschlichen Lebens erobert. Das Phänomen, dass sie heute praktisch überall eingesetzt werden, ist als Digitalisierung bekannt.
MaschinenMaschinen erfüllen profane Aufgaben als Rechner in Steuerzentralen und werden bei der Produktion von Texten, Bildern, Filmen und Musik eingesetzt. Die meisten dienen heutzutage als Kommunikationsgeräte. Mobiltelefone und Smartphones ja sind nichts anderes als tragbare Computer, die mit dem Internet verbunden sind.
Diese Entwicklung ist ein Lehrstück für alle Zukunftsforscher. Kein EDV-Pionier hatte den Einsatz von Computern zur Kommunikation in dieser Größenordnung vorhergesehen. Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen, wie Karl Valentin bemerkte.
Wissen | Karl ValentinValentin, Karl (1882–1948) war ein Münchner Komiker und Volkssänger.
Der große Sprung
Die weite Verbreitung von Computern beruht auf MiniaturisierungMiniaturisierung, unglaublicher LeistungssteigerungLeistungssteigerung und dem damit verbundenen rapiden Preisverfall. Gemäß Moores GesetzMooresche Gesetz verdoppelt sich die Leistung elektronischer Computerkomponenten etwa alle 12–18 Monate, während der Preis fällt oder unverändert bleibt. Diese Regel gilt seit 1970 ohne Ausnahme. Wenn unsere Fahrzeuge sich genauso schnell entwickelt hätten, würde ein neues Auto heute höchstens 25 Euro kosten und mit einem Liter Kraftstoff 1000 Kilometer weit fahren, ohne dass der Komfort beeinträchtigt wird.
Wissen | Gordon MooreMoore, Gordon (1929–2023) war ein amerikanischer Chemiker und Gründer der Firma Intel.
Bis vor kurzem schien die Leistungsfähigkeit von Computern an ihre Grenzen zu stoßen. Doch mit neuen Entwicklungen wie dem Quantencomputer rücken Möglichkeiten in greifbare Nähe, von denen Experten bisher nicht zu träumen wagten. Die Informatik steckt noch in den Kinderschuhen, nicht nur wegen ihres jungen Alters von knapp 100 Jahren, sondern auch, weil sie bisher keine großen technischen Revolutionen erlebt hat.
Nachhaltige Erfindungen durchlaufen im Laufe ihrer Entwicklung strukturelle Veränderungen. Die ersten Doppeldecker besaßen Propeller, waren größtenteils aus Holz und mit Leinen bespannt. Heutige Flugzeuge bestehen aus Aluminium und Karbon und verwenden Düsentriebwerke. Mit den allerersten Fluggeräten haben sie praktisch nur noch die Anordnung der Tragflächen gemeinsam. Die Veränderungen sind nicht nur eine Frage des Designs, sondern vielmehr eine Anpassung an veränderte Anforderungen. Die Ingenieure der ersten Stunde waren gezwungen, eine Konstruktion zu entwickeln, die bei geringem Eigengewicht eine hohe Nutzlast tragen konnte, da die Triebwerke nur über eine geringe Leistung verfügten. Heute steht die Effizienz im Vordergrund, also die Kosten pro geflogenem Kilometer. Entsprechend haben sich die eingesetzten Mittel verändert.
Bei Computern zählt nach wie vor die Rechenleistung, also die Anzahl der pro Zeiteinheit ausgeführten Rechenoperationen. Die verwendete Technik hat sich durchaus gewandelt: Zunächst wurden elektromechanische Schalter (Relais) eingesetzt, dann Elektronenröhren und schließlich die heute übliche Transistortechnik, stark miniaturisiert auf Siliziumplättchen gepackt. Die grundsätzliche Funktionsweise ist jedoch gleichgeblieben. Alle heutigen Geräte arbeiten wie die ersten programmierbaren elektronischen Rechner digital und basieren auf Logikgattern, die grundlegende mathematische Verknüpfungen realisieren. Diese wiederum basieren auf einer speziellen Algebra von George BooleBoole, George, der Anfang des 19. Jahrhunderts in England lebte.
Die wenigen Analogrechner, die zwischenzeitlich gebaut wurden, bestätigen eher die Regel.
Wissen | George Bool (1815–1864) war ein englischer Mathematiker.
Auch bei den Programmiertechniken gibt es keinen wirklichen Quantensprung: Nach wie vor werden die Computer mit imperativen Sprachen gefüttert, in denen Anweisung an Anweisung gereiht wird (auch hier gibt es wenig erfolgreiche Ausnahmen wie z. B. die interaktive Programmierumgebung PROLOGPROLOG). Alles in allem haben wir es also mit einer rein quantitativen Entwicklung zu tun. Unsere Computer wurden leistungsfähiger, unsere Programmiersprachen komfortabler, aber es gab keine wirklich neuen Konzepte, die sich durchsetzen konnten.
Das ändert sich jetzt. Während Computer früher hauptsächlich mit Algorithmen, also Anweisungslisten, gearbeitet haben, sind moderne KI-Systeme extrem datengetrieben. Ändern sich die DatenDaten, ändern sich zwangsläufig auch die Systeme. Eine bisher immer gültige Eigenschaft von Maschinen, nämlich ihre implizite Eindeutigkeit, wird damit aufgegeben. Im Gegenzug gewinnen DatenbankenDatenbanken enorm an Bedeutung, sie sind das „Öl des 21. Jahrhunderts“. Wir befinden uns mitten in der ersten wirklichen Revolution der Computertechnologie.
Kapitel 2 | Grundlagen der KI
Frühe Versuche
Was ist aus den Hoffnungen der ersten Pioniere wie natürliche Sprache, selbstständiges Denken oder gar Maschinenbewusstsein geworden? Viel wurde versucht, Milliarden an Fördergeldern wurden ausgegeben. Erreicht wurde zunächst wenig, fast nichts. Computer blieben billige, schnelle, aber im Grunde dumme Werkzeuge, die nie selbständig arbeiteten. Sie waren die Säge in der Hand des Schreiners und der Pinsel in der Hand des Künstlers. Keine Säge kann den Schreiner ersetzen, kein Pinsel das Bild allein malen. Aber je besser das Werkzeug, desto perfekter das Ergebnis. Folgerichtig hat man sich darauf verlegt, den Menschen bei seiner Arbeit zu unterstützen.
Auch in der MedizinMedizin wurde daran gearbeitet und es entstanden Programme, die Diagnosen oder Therapien vorschlagen. Zwischen 1992 und 1996 arbeitete ich als wissenschaftlicher Entwickler im Team von Prof. Lothar Gierl am Klinikum der Universität München.
Wissen | Lothar GierlGierl, Lothar (1942–2004) war ein deutscher Informatiker und KI-Pionier in der Medizin.
Wir haben medizinische Expertensysteme programmiert und zwei Ansätze ausprobiert. Zum einen mit einem Programm, das Dienstpläne für die Pflege erstellt, zum anderen mit einem System, das Therapievorschläge für lebertransplantierte Patienten liefern soll. Das Dienstplansystem arbeitet mit festen Regeln, die aus einer Eingabe (Anzahl der Pflegekräfte, Anzahl der zu leistenden Dienste, Arbeitszeiten, Wochenenden, individuelle Urlaubswünsche etc.) bestehen. Ein solches „regelbasiertes System“ war weder besonders neu noch originell, aber es sollte funktionieren, da es auf ein bereits existierendes Programm aufbaute. Natürlich hat es nicht funktioniert und wir haben das Projekt nie zu Ende gebracht. Es ist oft einfacher, etwas neu zu beginnen, als nach alten Fehlern zu suchen.
Die Idee mit den TherapienTherapie bei transplantierten Patienten war anspruchsvoll: Aus einer großen Datenbank von Lebertransplantierten wurde ein medizinisch ähnlicher Fall herausgesucht und dieser dann als Referenz vorgeschlagen. Dieses Vorgehen entspricht dem eines fortgeschrittenen Arztes: Während ein Anfänger meist nach festen, gelernten Regeln vorgeht (wie das Dienstplan-Programm), hat ein Oberarzt oft schon genügend Erfahrungswerte, um Vorschriften zu modifizieren oder wegzulassen, wenn es sinnvoll erscheint.
Dies erwies sich jedoch als schwierig. Zum einen ist es nicht einfach, ein Maß für die Ähnlichkeit zweier medizinischer Fälle zu finden. Die Suche nach geeigneten Formeln ist ein eigenes Forschungsgebiet und es gibt eine Vielzahl von Lösungsvorschlägen. Welche sollen wir verwenden? Der zweite Punkt war nicht weniger knifflig: Ein „Fallbasiertes System“ ist immer nur so gut wie die gespeicherten Fälle. Wenn die Datenbank keine passenden Therapien liefert, kann das System auch keine liefern.
Das ist ein grundsätzliches Problem früher KI-Systeme: Sie sind immer auf bestehende Regeln oder sinnvolle Vorlagen angewiesen, um zu funktionieren. Daran haperte es auch in unserem Fall: Die vorhandenen AlgorithmenAlgorithmen lieferten Daten, die bei näherer Betrachtung nicht immer besonders ähnlich waren. Wurde dennoch ein passender Fall gefunden, so lag er schon einige Zeit zurück und es wurde eine Therapie vorgeschlagen, die inzwischen als überholt galt, also nicht mehr verwendbar war. Eine Programmiererweisheit lautet:
„Garbage in, garbage out“.
Das ist gemeint: Wenn deine Daten nur Müll sind, sind auch deine Ergebnisse nur Müll. Wie wahr.