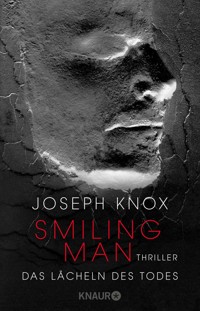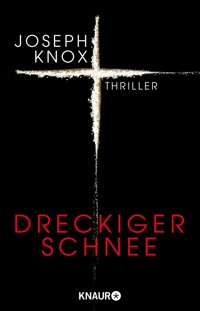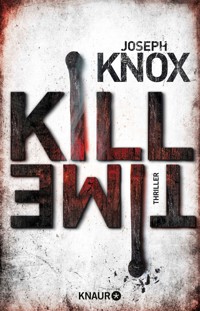
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Aidan Waits ermittelt
- Sprache: Deutsch
Düster, authentisch und gnadenlos spannend: das Noir-Meisterwerk des britischen Bestseller-Autors Joseph Knox und Fall drei für seinen Detective Aidan Waits Seit Jahren wartet ganz Manchester darauf, dass der Mörder Martin Wick verrät, was mit der kleinen Lizzie Moore geschehen ist, deren Familie er brutal abgeschlachtet hat – denn von dem Kind war nach dem Blutbad keine Spur zu finden. Jetzt liegt Wick im Sterben, und Detective Aidan Waits soll ihm ein letztes Geständnis entlocken. Stattdessen taucht eine Serie von plötzlichen Stromausfällen Manchester in Dunkelheit, eine tätowierte Frau dringt in die Wicks Krankenzimmer ein und setzt ihn mit einem Flammenwerfer in Brand. Die letzten, kaum noch verständlichen Worte des Killers schicken Aidan Waits auf eine Reise in die Finsternis: »Ich war es nicht …« Messerscharf und schonungslos realistisch seziert der britische Krimi-Autor Joseph Knox die Schattenseiten menschlicher Existenz und ist damit für Manchester das, was Ian Rankin für Edinburgh darstellt. Detective Aidan Waits – ein durch und durch zerrissener Ermittler und klassischer Anti-Held – ermittelt in insgesamt drei typisch britischen Noir-Krimis: • Dreckiger Schnee • Smiling Man. Das Lächeln des Todes • Kill Time »Raffiniert konstruierter, vielschichtiger Noir-Krimi.« Tagesanzeiger über »Smiling Man«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Joseph Knox
Kill Time
Thriller
Aus dem Englischen von Andrea O'Brien und Karl-Heinz Ebnet
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Seit Jahren wartet ganz Manchester darauf, dass der Mörder Martin Wick verrät, was mit der kleinen Lizzie Moore geschehen ist, deren Familie er brutal abgeschlachtet hat – denn von dem Kind war nach dem Blutbad keine Spur zu finden.
Jetzt liegt Wick im Sterben, und Detective Aidan Waits soll ihm ein letztes Geständnis entlocken. Stattdessen taucht eine Serie von plötzlichen Stromausfällen Manchester in Dunkelheit, eine tätowierte Frau dringt in die Wicks Krankenzimmer ein und setzt ihn mit einem Flammenwerfer in Brand. Die letzten, kaum noch verständlichen Worte des Killers schicken Aidan Waits auf eine Reise in die Finsternis: »Ich war es nicht …«
Inhaltsübersicht
Widmung
Zitat
Prolog
I
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
II
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
III
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
IV
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
V
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
VI
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
VII
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
VIII
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
IX
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
X
1. Kapitel
Für Elizabeth K.
»Die Lust, den Tod zu riskieren, ist unsere letzte, große Perversion. Wir kommen aus der Nacht, wir gehen in die Nacht. Warum in ihr leben?«
John Fowles, Der Magus
Tessa hatte fertig gepackt und war bereit. Ihr blieben noch ein paar Minuten, so stand sie in der offenen Tür und genoss den leichten Abendwind. Die Dunkelheit hatte noch nicht eingesetzt, aber es kam ihr vor, als hätte sie das klare, tiefblaue Dämmerlicht seit Jahren nicht mehr wahrgenommen, als hätte ihr seit Jahren die Zeit dafür gefehlt. Es war wie eine Vorahnung, eine Verheißung der vielen guten Dinge, die am Horizont auf sie warteten. Unwillkürlich legte sie die Hand auf den Bauch.
In der Straße war es still, Tessa hörte das kleine Mädchen nebenan auf dem Klavier Beethovens »Mondscheinsonate« üben. Sie hatte sich in den letzten Monaten gemausert, was erst stockend geklungen hatte, kam nun ganz natürlich, floss ihr geradezu aus den Fingern. Die Scheinwerferlichter eines Wagens kamen um die Ecke gebogen, strichen über die Häuser auf der gegenüberliegenden Straßenseite, kurz darauf hielt ein mattschwarzer Mercedes pünktlich am Ende ihrer Einfahrt. Der Fahrer, in elegantem dunklem Anzug und getönter Sonnenbrille, kam ihr auf dem Weg entgegen.
»Miss Klein?«, sagte er.
»Nennen Sie mich Tess.«
Er fragte, ob er ihr den Koffer abnehmen könne. Sie sah ihr Spiegelbild in den Gläsern seiner Brille. Sah ihr amüsiertes Lächeln, das zeigte, dass sie so etwas nicht oft tat. Sie folgte ihm zum Wagen, wo er ihr die Tür aufhielt und ihr Gepäck in den Kofferraum lud, bevor er wieder einstieg.
»Wohin?«, fragte er. Ein Scherz, ganz klar.
»Ach, überraschen Sie mich«, antwortete sie mit einem breiten Lächeln.
Der Chauffeur nickte ihr im Rückspiegel zu und fuhr los. Tessa sah durch die Scheiben, zu den Häusern, den erleuchteten Fenstern, dem Leben, das sie zurückließ. Dann wurden ihre Augen schwer, sie ließ sie zufallen, und als sie sie wieder aufschlug, war es draußen dunkel. Der Chauffeur bog auf einen schmalen Feldweg ab, Schotter knirschte unter den Reifen, sie näherten sich einem kleinen Cottage, das in Dunkelheit lag. Er hielt an und stellte den Motor aus.
»Überraschung«, sagte er.
Es war so still, dass Tessa ihren eigenen Atem hörte. Der Chauffeur stieg aus, ging zum Kofferraum, nahm ihr Gepäck und kam wieder, um ihr die Wagentür zu öffnen.
Er schaltete eine Taschenlampe an und führte sie zum Cottage.
»Wir suchen nach einem Kaktus«, sagte er und ließ den Blick über die an der Wand aufgereihten Blumentöpfe schweifen. Tessa beugte sich zur Pflanze hinunter und fand darunter den Zweitschlüssel. Die Tür öffnete sich mit einem Seufzen, als hätte das Gebäude den Atem angehalten. Sie tastete an der Wand nach den Lichtschaltern und drückte alle auf einmal. Energiesparbirnen, das gefiel ihr. Sie musste lächeln bei dem Gedanken, dass er sie wahrscheinlich nur ihr zuliebe hatte auswechseln lassen. Ihr weicher Lichtschein reichte nicht in alle Ecken des Raums, der daher noch mehr wie eine Höhle wirkte. Es war groß, offen, umfasste eine Küche und ein Wohnzimmer, mächtige Holzbalken zogen sich über die Decke. Für eine Sekunde vergaß Tessa den Chauffeur. Erst als er sich diskret räusperte, fuhr sie herum.
»Entschuldigung, bitte stellen Sie ihn irgendwo ab.«
Er trat ein und stellte den Koffer neben ein Sofa.
»Kann ich Ihnen was zu trinken anbieten?«, fragte sie und ging zur Küche. »Auch wenn ich nicht weiß, wo hier alles ist. Vielleicht sollten wir auf Seine Lordschaft warten.« Als der Chauffeur nicht reagierte, drehte sie sich zu ihm um. Er stand jetzt viel näher bei ihr, und sie fragte sich, wie er sich so lautlos bewegen konnte.
»Er wird leider nicht kommen.«
Sie wich etwas zurück. »Gibt es ein Problem?«
»So könnte man es sagen.« Die getönte Brille verbarg seinen Gesichtsausdruck. »Es ist leider vorbei, Miss Klein.«
»Okay.« Wieder erfasste sie in seinen Gläsern ihr Spiegelbild. Sie sah jetzt ängstlich aus, bemühte sich aber, ganz ruhig zu klingen. »Schon okay, aber in diesem Fall möchte ich nach Hause.«
»Es ist alles aus und vorbei«, stellte er klar.
»Sie müssen sich irren.« Sie lächelte, war erleichtert, dass sie die richtige Antwort parat hatte. »Wir waren gestern noch zusammen …« Sie dachte an ihre ineinander verschlungenen Körper auf dem Boden seines Büros, sie hatte das Ohr an seine Brust gepresst, als wollte sie die Kombination eines Safes erspüren. »… ich bin schwanger.«
»Genau«, sagte der Chauffeur und klang irgendwie dankbar, dass sie ein heikles Thema angesprochen hatte. »Genau, also seien Sie so freundlich und setzen Sie sich«, sagte er und deutete zum Tisch. »Es gibt da noch was, das ich von Ihnen will, das wäre dann alles. Ich nehme Ihnen gegenüber Platz.«
Er legte die Hand auf einen der Stühle.
»Ich stehe lieber, danke.«
»Auch gut«, sagte er. »Dann bleibe ich auch stehen.« Er fasste in seine Tasche, fand einen Stift und ein Blatt und legte beides auf den Tisch. Als er ihr alles hinschob, bemerkte sie, dass beide Gegenstände von ihr waren. »Das ist für Sie. Sie müssen mir was aufschreiben.«
»Wenn es um das Baby geht …«
»Nein, nein«, sagte er. »Nehmen Sie den Stift, es ist ganz einfach.« Ohne ihn aus den Augen zu lassen, nahm sie den Stift zur Hand. »Gut. Dann müssen wir nur noch das hier abschreiben.« Er wühlte in einer anderen Tasche, zog ein bedrucktes Blatt heraus, legte es auf den Tisch und schob es ihr hin. Sie begann zu lesen, trat unwillkürlich zurück und schlug die Hand vor den Mund.
»Lassen Sie mich mit ihm reden«, sagte sie. Der Chauffeur rührte sich nicht. »Ich schreibe das nicht, auf keinen Fall.«
Der Mann nahm die Brille ab und betrachtete sie mit so großem Mitgefühl, dass sie bereits glaubte, ihn erweicht zu haben.
Er nahm einen weiteren Gegenstand aus der Jacketttasche, eine Zange.
»Sorry«, sagte er und suchte nach was anderem. »Ach, hier haben wir es ja.«
Er warf einen schweren Umschlag auf den Tisch.
»Geld?«, sagte sie und konnte es nicht fassen, war aber sehr erleichtert. »Er meint, er kann mich auszahlen?« Der Chauffeur wartete, sagte nichts und sah sie auch nicht an. Sie nahm den Umschlag, öffnete ihn und schüttelte den Inhalt heraus.
Farbfotos.
Das erste zeigte ihre Mutter bei der Arbeit im Co-op, das zweite ihren Dad am Steuer seines Wagens. Der Großteil allerdings waren Bilder ihrer Schwester, ihres Schwagers, ihrer beiden kleinen Kinder Sarah und Max. Die letzten drei waren in ihrem Zimmer aufgenommen, während die Kinder schliefen. Tessa sah auf, brachte aber kein Wort heraus. Plötzlich bekam sie keine Luft mehr.
»Am Ende könnte sich wirklich alles zum Guten wenden«, sagte der Mann. »Tess, heute Abend können Sie ihnen allen das Leben retten. Sie müssen mir dazu nur diesen Zettel abschreiben.«
»Ich glaube Ihnen nicht«, sagte sie atemlos. »Ich …«
Er nahm sein Handy aus der Tasche, scrollte zu einem Eintrag und schob es ihr hin. Sie erkannte die Festnetznummer ihrer Schwester, eine Nummer, die sie seit Jahren nicht mehr angerufen hatte. Ihre Finger zitterten vom Adrenalin, dann drückte sie auf den Anruf-Button und sah den Chauffeur herausfordernd an. Beim ersten Klingeln wurde abgenommen.
Eine unbekannte Männerstimme war zu hören: »Schon eine Entscheidung getroffen?«
»Wer sind Sie?«
»Wichtig ist nur die Frage, wo ich bin. Wo ich bin, wenn Ihre Schwester in zehn Minuten mit ihren Kindern nach Hause kommt. Unterschreiben Sie, Tess. Ich wüsste sonst nicht, wie ich es ihnen leicht machen sollte.«
Der andere legte auf. Tessa spürte, wie ihr das mit einem Mal glitschige Handy entglitt. Sie sah sich um, dann nahm sie am Tisch Platz und trocknete sich die rechte Hand an der Bluse, damit sie den Stift halten konnte. Stockend schrieb sie zwei Zeilen, vor der dritten Zeile hielt sie lange inne.
Sucht nicht nach mir, stand dort. Ich mache es so, dass mein Leichnam nie gefunden wird.
Langsam, zögernd schrieb sie die dritte Zeile und setzte eine einzige Initiale darunter. Als sie wieder aufsah, war der Mann noch näher an sie herangerückt, er stand jetzt fast direkt hinter ihr.
»Sie werden nach mir suchen«, sagte sie.
»Aber sie werden nichts finden.« Er strich ihr sanft über die Schultern. »Überhaupt nichts. Es ist das Baby, verstehen Sie. Das würde auf ihn verweisen, und, na ja, er hat doch jetzt Familie.« Tess stierte in den leeren Raum und glaubte von irgendwo in der Ferne ein Klavier zu hören.
»Hören Sie das?«, fragte sie, hob eine Hand und lauschte.
»Die Leute hören oft irgendwas«, sagte er. »Darf ich fragen, was es ist?«
»Beethoven«, sagte sie, und ihr Blick fiel auf die Zange auf dem Tisch. »Die Mondscheinsonate.« Der Chauffeur umfasste sie an den Schultern, sie sah zu ihm auf und versuchte zu lächeln. Er drückte sie herzlich und lächelte ebenfalls.
»Bezaubernd, nicht wahr?«
I
Night People
1
Das verlorene Wochenende, so wurde es später genannt. Mehrere Lastabwürfe führten von Freitagnachmittag bis Sonntagabend in ganzen Stadtvierteln zu stundenlangen Stromausfällen, während derer das Stadtzentrum zu einer aufregenden, unbekannten Zone wurde. Ohne den Lichtschein der Hochhäuser und Straßenlaternen, der grellen Schaufenster und Fassaden gewannen die Menschen wieder eine Art Unschuld, die nur Stunden zuvor für immer verloren zu sein schien. Die Älteren wurden ins Freie gelockt und deuteten auf Sternbilder, die seit Jahrzehnten nicht mehr zu sehen gewesen waren. Gruppen von Jugendlichen streiften ziellos durch die Straßen, ignorierten die polizeilich verordnete Ausgangssperre und erschreckten sich gegenseitig, leuchteten mit dem kostbaren Strom ihrer Handys in die Gesichter ihrer neuen Freunde. Als der Strom wieder da war, ließ er die Stadt aufleuchten, überwältigte die Passanten, als wäre alles eine pompöse Broadwaybühne, die Menschen spürten den Kitzel, als sie sich sahen, wie sie wirklich waren, und sie versuchten sie zu nutzen, diese essenzielle, geborgte Zeit, als die sie ihnen vorkam.
Im Dunkel spürte man, dass man mühelos verschwinden oder sich neu erfinden, dass man aus dem einen Leben heraus- und in ein anderes hineintreten konnte. Auf dem Weg durch die Stadt zu meiner Schicht hätte ich gesagt, dieses Gefühl sei bei allen vorhanden, es liege irgendwie in der Luft, aber wenn ich darüber nachdenke, komme ich zu dem Schluss, dass es vielleicht doch nur mein Gefühl war. Mehr als dreißig Nächte am Stück hatte ich im Krankenhaus St. Mary’s in der Oxford Road verbracht und zugesehen, wie ein Mehrfachmörder langsam starb.
Dort hielt ich mich auf, als die Lichter erneut erloschen.
Wir befanden uns in einem kleinen Zimmer, das in einem ansonsten leeren Gang lag, nur ich und Martin Wick.Er war ans Bett fixiert, zu krank, um noch aufzustehen. Durch die Fesseln konnte er noch nicht mal den Arm heben und mir zuwinken, wenn er was von mir wollte. Seine dünnen Arme hatten nur wenig Bewegungsspielraum und schrumpelten so schnell, dass die Riemen jeden Morgen nachjustiert werden mussten. Als der Strom ausfiel, gab es für mich daher keinen Grund, den Blick abzuwenden oder nervös zu werden. Außer dass ich in den Sekunden, bevor sich das Notstromaggregat einschaltete, das Gefühl hatte, ich könnte ihn sehen, wie er wirklich war.
Immer kam es mir so vor, als wäre er in der Dunkelheit besser zu sehen.
Seine Augen glänzten, als würden sie von innen beleuchtet, als loderte hinter ihnen ein Feuer. Eine kalte Flamme, die noch weiterzubrennen drohte, lange nachdem der Körper tot war. Ich atmete aus, als der Strom wieder da war und sich ein mattes Licht im Zimmer ausbreitete.
Als ich zu Martin Wick aufblickte, lächelte er.
Er behauptete, er könne sich nicht erinnern, sie alle umgebracht zu haben, daher sein Spitzname. Keiner glaubte ihm und seiner Version der Ereignisse, der zufolge er blutüberströmt aufgewacht sei. Die Schlagzeilen, Leitartikel und Kommentare, die ihn als den Schlafwandler beschrieben, trieften vor Sarkasmus. Sogar Leute, die nicht wussten, was er getan hatte, fühlten sich in seiner Gegenwart unwohl. Ich hörte eine der neuen Schwestern sagen, von ihm gehe was Unheilvolles aus, ohne dass sie von seiner Vergangenheit gewusst hätte.
Das Unheil war bereits eingetreten.
Schon vor Jahren hatte es ihn leicht vom Kurs abgebracht und auf unkartiertes Terrain geführt. Es gab keine Straßenkarte für die Martin Wicks der Welt, keinen Weg zurück in die Zivilisation. Wenn man ihm glauben wollte, war er jetzt also hoffnungslos verloren und an ein Krankenhausbett geschnallt. Wenn man ihm glauben wollte, hatte er keine Ahnung, wie er dahin gekommen war.
Falls man ihm glauben wollte.
Trotz des Zwinkerns waren seine Augen leblos, vollkommen dunkel und bewegten sich nur träge. Manchmal schlief er, obwohl sie weit offenstanden. Man konnte die Pupille nicht von der Iris unterscheiden, man konnte nicht sagen, ob er ins Leere starrte oder einen direkt ansah. In manchen Nächten war es weder das eine noch das andere, in anderen beides zugleich. In manchen Nächten, wenn sein Blick auf mich fiel, war es, als würde er mich beobachten.Ich konnte nie ganz das Gefühl abschütteln, dass irgendeine dritte Instanz die Filmaufnahmen in seinem Kopf prüfte, sie Einzelbild für Einzelbild durchging und nach Schwachstellen suchte.
Mein Job war es, zehn Stunden am Stück hier zu sitzen, zu warten, dass er etwas sagte oder tat, und jede seiner Bewegungen zu dokumentieren. Wenn er während meiner Schicht schwieg, kam er mir vor wie jemand, der ein Geheimnis für sich bewahrte. Wie jemand, der in einer üblen Gegend die Faust um sein Kleingeld in der Hosentasche schloss und sichergehen wollte, dass es nicht zu laut klimperte. Wie jemand, der nichts verraten wollte, bevor er starb.
Klar, es stellte sich heraus, dass er bloß wartete.
Ich war schon etwa eine Stunde hier, als ich eine Bewegung wahrnahm. Ich blickte von meinem Taschenbuch auf und sah ihn nach dem Notizblock greifen. Er umfasste seinen Stift, zuckte zurück, weil die Fesseln ihn hinderten, und schrieb etwas. Seine Handschrift war die kleinste, die ich je gesehen hatte. Hätte ich nicht die Abschrift seines Deals mit der Staatsanwaltschaft gelesen, hätte ich nicht blinzelnd nach der Unterschrift gesucht, die sich unten auf jeder Seite verbarg, hätte ich die Notizen für eine Art Psychospielchen gehalten, das nur darauf abzielte, mich von meinem Stuhl zu locken.
»Bleiben Sie ruhig liegen«, sagte ich, machte ein Eselsohr in die Buchseite und durchquerte das Zimmer.
Im Krankenhauslicht war Martin Wick blasser als blass. Weißer als Hitlers Wichsflecken, um Suttys Worte zu benutzen. Das Resultat von zwölf Jahren Kettenrauchen in Einzelhaft, worauf ihm Lungenkrebs im Endstadium diagnostiziert worden war. Er hatte einen alten verrunzelten Lumpen als Gesicht, seine Haut war dünn wie Pergament. Was darunter lag, wollte man nicht sehen. Ein Lungenflügel war ihm bereits entfernt worden, der andere wurde nur noch lose von Tumoren zusammengehalten, Folge seiner anscheinend eher nachlässigen Arbeit bei der Asbestentsorgung auf Baustellen, damals, bevor sie ihn in Strangeways einlochten.
Ich beobachtete den Herzmonitor, während er vor sich hin kritzelte. Die Spitzen, Höhen und Tiefen. Es sah aus wie ein Lügendetektortest, den er nicht bestehen würde. Als er den Stift aufs Bett fallen ließ und ich den Notizblock nahm, bekam ich einen Schlag ab. Wick reagierte irgendwie seltsam auf die Bettlaken, jede Bewegung führte zu einer statischen Aufladung, und jedes Mal, wenn ich ihn berührte,bekam ich einen elektrischen Schlag, als wäre sein Körper gefährlich aufgeladen, als stünde er unter einer Spannung, die über schlechte Schwingungen hinausging. Ich konnte nie ganz das Gefühl abschütteln, dass mit jedem Funken etwas zwischen uns ausgetauscht werden sollte, dass er ansteckend war und das auch wusste.
Sutte stand da in seiner winzigen Handschrift. Ich ließ den Block aufs Bett fallen, damit ich ihn Wick nicht zurück in die Hand geben musste, dann ging ich durchs Zimmer. Erst eine Stunde zuvor hatte ich Sutty, meinen Vorgesetzten, abgelöst, aber unsere Anweisung war klar. Bis zu dem Tag, an dem Wick auscheckte, würde er bekommen, was er wollte.
»Hoffentlich haben Sie ihm heute Abend auch was mitzuteilen, Martin«, sagte ich und öffnete die Tür.
»Spielt das irgendeine Rolle?«
Ich drehte mich um. Seit mehr als einem Monat war ich auf dieser Station, hatte Martin Wick aber noch nie sprechen hören. Er hatte sich das Beatmungsgerät abgenommen, doch als ich ihm in die glänzenden schwarzen Augen sah, konnte ich nicht sagen, ob er an die Decke starrte oder mich anblickte. Es konnte beides sein oder etwas ganz anderes.
Er hustete, keuchte die Kiesel aus seinem noch verbliebenen Lungenflügel. »Verschwende dein Leben, Junge …« Es war ein schmerzhaftes Flüstern. »… es ist sowieso versaut.«
Ich stand da, sah, dass er schwitzte, weil ihn das Reden so anstrengte, dann nickte ich und verließ das Zimmer. Auf dem Weg durch den Gang zu unserem Wachmann rieb ich die Hände in den Hosentaschen, musste an die Funken denken und fragte mich, ob es bloß meine Einbildung war, dass er was gesagt hatte.
Seit Wochen kam es mir so vor, als hätte ich nicht richtig geschlafen und wäre auch nie richtig wach gewesen.
In jeder Schicht hatte ich das Gefühl, ich würde in einen Zustand des Stillstands eintreten, in eine Phase zeitweiligen Irrsinns. Als erneut die Lichter ausgingen, stapfte ich einfach weiter und tastete mich an der Wand entlang. Der Wachmann drehte sich um, blendete mich mit der Taschenlampe, die an seiner Heckler & Koch befestigt war, aber ich hatte noch keine Angst. Ich fühlte mich nicht weniger machtlos oder von Dunkelheit umgeben als sonst auch.
2
Ich hatte die Videoaufzeichnung von Martin Wicks Festnahme nur einmal gesehen, vor einigen Jahren, aber ich war nachhaltig beeindruckt. Es war früh am Morgen gewesen, etwa eine Stunde vor der Dämmerung, Wick war in der Dunkelheit kaum auszumachen, bis sich hinter ihm die Tür schloss und sich seine Silhouette vor dem Mattgrau der Bahnhofshalle abzeichnete.
Wick, den Kopf, Nacken, die Schultern gebeugt, erschien wie eine schlaffe Marionette, er zog ein Bein nach, was man erst sah, als er auf dem Bild ins Licht humpelte. Seine Kleidung war schwarz, vollkommen schwarz. Die Videoauflösung war nicht besonders toll, trotzdem war zu erkennen, dass die Jacke falsch geknöpft war, sie beulte sich an einer Schulter und verlieh ihm einen Buckel. Er bewegte sich ruckartig, abgehackt durch die leere Bahnhofshalle auf einen unbesetzten Fahrkartenschalter zu.
Das körnige Bild der Überwachungskamera hinter dem Schalter war seltsam passend. Er sah aus, als wäre er von einer statisch aufgeladenen Wolke umgeben, einem elektrischen Nebel, der seinen Körper verschwimmen ließ und an den Rändern unscharf machte. Dann schob er sich in den Lichtkegel der schmutzig-gelben Lampen und war mit einem Mal im Fokus. Den Hemdkragen hatte er hochgestellt, einen Ärmel des Jacketts nach oben gekrempelt, den anderen unten gelassen, die Hosenbeine waren verrutscht.
Wenn ich mich recht erinnere, trug er nur einen Schuh.
Sein rechter Fuß steckte in einer nassen, schlabbrigen Socke, mit der er Abdrücke auf dem Boden hinterließ. Als er den Schalter erreichte, wurde klar,dass seine Kleidung feuchtschwarz glänzte und ihm stellenweise am Körper klebte. Die blauen Lichter, die über seiner Schulter so fern und geisterhaft gewirkt hatten, wurden allmählich heller und blinkten in den Fenstern.
Martin Wick hob den Kopf und sah mit leerer Miene in den Fahrkartenschalter. Schließlich wanderte sein Blick vom Schalter zum eigenen Spiegelbild in der Acrylglasscheibe. Er machte einen Schritt zurück. Über seine Miene huschte ein Ausdruck des Entsetzens und des Erkennens, als wäre er aus dem einen Albtraum aufgewacht und in einen anderen gefallen. Er taumelte nach hinten, weg von sich selbst, und sah kurz hinauf zur Kamera, die seinen Weg durch die Halle aufgezeichnet hatte.
Das Bild bot Anlass für endlose Diskussionen.
War es das unschuldige Zusammenzucken eines Mannes, der nicht wusste, wo er war und was er tat, oder war es die kalkulierte Bewegung eines Psychopathen, der sichergehen wollte, dass sein Auftritt gebührend aufgezeichnet wurde? Danach sackte er zusammen, hatte Schaum vor dem Mund und lag zuckend auf dem Boden.
Wenige Stunden später fand man das Haus der Familie, deren Eingangstür weit offen stand.
Martin Wick war in seiner Kleidung, die mit dem Blut von fünf Menschen getränkt war, durch die Stadt spaziert, die folgenden zwölf Jahre hatte er in Strangeways verbracht.
Das reichte aber noch nicht ganz.
3
Detective Inspector Sutcliffe ging nicht an sein Handy, aber ich fand ihn am ersten Ort, den ich ansteuerte. The Temple war eine kleine Kellerbar in der Great Bridgewater Street, zwanzig Minuten strammen Fußmarsches vom Krankenhaus entfernt. Der Raum im Souterrain, in viktorianischen Zeiten eine öffentliche Bedürfnisanstalt, war in den Achtzigern zu einer Rock-’n’-Roll-Kneipe umfunktioniert worden. Die kleinen Tische standen eng zusammen, die Wände waren zugekleistert mit Bandflyern, Tourpostern und mit Graffiti besprüht. Sutty stand in der Ecke und war dabei, einem der Gäste irgendwas klarzumachen. Um sich dessen ungeteilter Aufmerksamkeit zu versichern, hatte er ihn an den Ohren in die Höhe gelupft und begann gerade dessen Kopf zum Rhythmus der Drums gegen die Wand zu schlagen.
Als er mich erblickte, ließ er theatralisch sein Lächeln ersterben.
»Oh«, sagte er über die Musik hinweg. »Das ganze Elend dieser Welt. Solltest du dich nicht lieber um Brot anstellen, statt Bier zu ordern?«
»Wick möchte mit dir reden.«
Sutty nickte, ließ den anderen los und gab ihm zu verstehen, dass er sich verpissen sollte. »Komisch, nicht?«
»Was?«, fragte ich und sah dem Typen hinterher, der sich die Ohren rieb.
Sutty wischte sich über die Stirn und schenkte mir sein mattgelbes Grinsen. »Dass Wick mich so viel lieber mag als dich.«
»Ja, schon komisch. Ihm ist heute Abend nach Quatschen zumute …«
»Ach ja?« Es war schon einiges nötig, um Sutty aus der Reserve zu locken, aber damit hatte ich ihn. »Vielleicht rückt er endlich mit der Sprache raus. Was hat er gesagt?«
»Ich soll mein Leben verschwenden.«
Er prustete und drehte sich zu seinem Glas um. »Da bist du ja schon gut dabei.«
Sutty leerte sein Glas. Ich konnte ihm schlecht was entgegensetzen.
Mein Kollege war wie ein Flachmann gebaut. Stämmiger, halsloser Schädel auf breiten Schultern mit dazu passendem Whiskyatem. Sein Gesicht sah völlig abgefahren aus, wie kreidebleicher Sauerkäse mit seltsamen Klümpchen unter der Haut. Irgendwie passte das alles zu seiner Person, so wie die aufgedruckten Warnhinweise auf Rattengiftpackungen. Er bügelte seine Anzüge nie, füllte sie aber bis zum Bersten, weshalb sie völlig knitterfrei aussahen. Er knallte sein Glas auf den Tresen und glotzte mich an, als hätte er mich noch nie gesehen.
»Woher weiß ich, dass du dir nicht bloß den Abend freinehmen willst? Hat nicht mal deine Verflossene hier gearbeitet?«
»Ist nicht mehr da«, sagte ich und kramte in meinen Taschen nach dem Zettel, den Wick mir gegeben hatte.
»Eine der vielen, die Reißaus genommen haben. Wahrscheinlich bist du ihr zu oft gekommen.«
»Einer von uns muss es ja tun.«
Ich fand das gefaltete Blatt.
»Jurgh«, sagte Sutty und betrachtete den Zettel. »Jammerschade, dass wir ihm nicht die Hände auf den Rücken binden können.« Er nahm sich seinen Blazer vom Barhocker und zwängte sich hinein wie in eine Zwangsjacke. »Dann mal los, du Flachwichser, ins Spastmobil.«
»Ich bin zu Fuß hier«, sagte ich.
»Na, nehmen wir ein Taxi, und du kommst mit. Sobald er wegpennt, übernimmst du wieder.«
Ich nickte und folgte ihm nach draußen.
Wir stiegen die Stufen zur Straße hinauf, hielten ein Taxi an und starrten während der Fahrt auf die an uns vorbeiziehende Stadt. Sozialarbeiter zwischen Obdachlosen mit wirrem Blick. Schwer gestylte und schwer abgefüllte Jungs auf dem Weg zu oder von den Pubs und Clubs. Und die Mädchen, die in Formation vorbeizogen und sich krummlachten über das Leben. Das war unser Revier, aber die Dinge hatten sich geändert.Sutty saß murmelnd neben mir und rieb sich Desinfektionsgel in die Hände. Er brauchte mittlerweile eine Tube pro Tag, wurde aber irgendwie nie richtig sauber. Manchmal beschlich mich der Verdacht, er nahm den Alkohol über die Poren in die Blutbahn auf.
Bei unserer Ankunft im St. Mary’s trugen zwei Männer eine bewusstlose Jugendliche hinein, die sie wie einen aufgerollten Teppich gepackt hatten. Wir betraten das Krankenhaus, die Lichter in der Aufnahme gingen aus und nach einer Sekunde wieder an. Ich sah mich um. Da waren sie, Opfer von Schlägereien, andere, die aus Stichwunden bluteten. Verwirrte, benommene Menschen, Betrunkene, Drogensüchtige, mit Verletzungen, die ihr Leben verändern würden. Spindeldürre alleinerziehende Mütter, die sich von gemeinnützigen Tafeln ernährten, mit fettleibigen Babys. Sutty und ich drehten uns in dem Moment um, als das Mädchen zu sich kam, sich von ihren Helfern losriss und davonwollte, hinaus auf die Straße. Es schien die einzig vernünftige Reaktion zu sein.
4
Seit den Selbstmordanschlägen vom 22. Mai waren bewaffnete Polizeikräfte ein alltäglicher Anblick in der Stadt.
Es kam mir aber immer noch ungewöhnlich vor, einen von denen in einem Krankenhaus zu sehen.
Es hatte einigen Widerstand seitens der Krankenhausverwaltung gegeben, bis wir Wicks Akte vorgelegt hatten mit allen darin enthaltenen Warnungen vor möglichen Mordanschlägen. Die Polizei war gesetzlich dazu verpflichtet, solche Morddrohungen bekanntzugeben, wenn sie glaubhaft erschienen. Wick hatte sich während seiner Haft in Strangeways eine lange Liste äußerst glaubhafter Morddrohungen eingehandelt, die wir in der einen Stunde, in der wir uns mit der Verwaltung zusammengesetzt hatten, gar nicht vollständig durchgehen konnten. Das Krankenhauspersonal weigerte sich, noch mehr davon zu hören, und stimmte einem bewaffneten Wachmann vor dem Krankenhauszimmer schließlich vorbehaltlos zu.
Wir hatten die Strategie absichtlich so gewählt.
Damit wir nicht die tatsächlich auf unseren Gefangenen verübten Mordanschläge erwähnen mussten, hatten wir das Thema vorsätzlich auf die Morddrohungen gelenkt. Ein Zellengenosse hatte Wick mit einem angespitzten Kugelschreiber das Ohr durchstochen, ein anderer hatte versucht, ihn mit seinem eigenen Laken aufzuknüpfen. Beim originellsten Versuch hatte sich eine unbekannte Zahl von Mithäftlingen zusammengetan, um Wick in seiner Zellentoilette zu ersäufen. Gefängnislatrinen sind in weiser Voraussicht entsprechend konstruiert und haben deshalb einen großen Siphon und eine schwache Spülung, sodass es im Grunde an Flüssigkeit mangelt. Laut des Berichts wären mindestens fünf Männer mit vollen Blasen nötig gewesen, um die Schüssel so weit zu füllen und den Wasserstand eine Minute oder länger aufrechtzuerhalten, damit Wicks Gesicht durchgehend untergetaucht blieb. Die Wärter waren gerade noch rechtzeitig angerückt, im Großen und Ganzen war es aber vermutlich für alle eine Erleichterung gewesen, als seine tödliche Erkrankung diagnostiziert und er auf die Krankenstation verlegt wurde.
Laut Anweisung sollte möglichst immer einer von uns, entweder Sutty oder ich, bei Martin Wick im Zimmer sein. Nicht weil er noch eine Gefahr darstellte, sondern weil man sich erhoffte, dass der nahende Tod ihm vielleicht die Zunge löste. Selbst jetzt noch, zwölf Jahre nach seiner Verhaftung, war vieles ungeklärt.
Als wir den Auftrag annahmen, sagte man uns, er habe noch fünf oder sechs Tage zu leben. Ich war froh, dass wir nicht lange hier sein würden.
Das war vor fünf Wochen gewesen.
Suttys Anwesenheit hatte dem todkranken Mann irgendwie neues Leben eingehaucht, so, als hätte er es mir herausgesaugt und direkt an unseren Gefangenen weitergegeben. Am Ende der ersten Woche war ich überzeugt, dass Wick in der zweiten sterben würde. In der dritten dachte ich, er könnte noch durchhalten, in der vierten, er würde wieder völlig genesen. Jetzt, am Ende der fünften Woche in Schutzgewahrsam, fürchtete ich, Martin Wick könnte ewig leben.
Die Beherbergung einer landesweiten Hassfigur kann recht heikel sein, weshalb beschlossen wurde, dass Wick heimlich untergebracht würde, im dritten Stock eines maroden, gerade in Renovierung befindlichen Krankenhaustrakts. Das Zimmer lag in einem Korridor, der auf ein Viertel seiner ursprünglichen Länge verkleinert worden und nur noch über einen einzigen Zugang zu betreten war. Die Lifttüren waren deaktiviert, zur restlichen Station war eine provisorische Trennwand eingezogen. Der einzige Weg rein und raus bestand über einen Notausgang, der in ein nacktes Betontreppenhaus führte. Um in das eigentliche Krankenhaus zu gelangen, musste man die Stufen runter, durch die Aufnahme und auf der anderen Seite der Trennwand die Haupttreppe hoch. Theoretisch bedeutete das, dass es nur einen Weg in und aus Martin Wicks Zimmer gab.
Tatsächlich kam ich mir vor wie eine Ratte in der Falle.
Rennick, der bewaffnete Polizist, war auf seinem Posten, als ich aus dem Treppenhaus kam. Sutty war noch ein Stück hinter mir. Rennick saß in der ehemaligen Schwesternstation und trug die volle Kampfmontur: Schutzweste, fingerlose Handschuhe, die neue schwarze Basecap. Mit der an die Weste geschnallten Ausrüstung inklusive Speedcuffs, Funkgerät und Taser, mit seiner Handfeuerwaffe, dem Verbandsmaterial und den Ersatzmagazinen sah er aus wie eine Actionfigur. Er las eine Zeitung, lächelte vor sich hin und kratzte sich mit seinem G36-Sturmgewehr am Ohr.
Ich wollte ihn nicht erschrecken.
»Rennick«, sagte ich leise.
»Waits«, antwortete er, ohne den Kopf zu heben. Er legte die Zeitung auf den Tresen, erhob sich und schwang das Gewehr in einer einzigen fließenden Bewegung an mir vorbei.
»Jetzt hättest du dir mit dem Ding fast einen Mittelscheitel gezogen.«
»Ist nicht entsichert«, sagte er gleichmütig.
»Sutty ist im Anmarsch, da wäre es besser, wenn du etwas lebendiger aus der Wäsche schaust.«
Er warf mir einen Blick zu und kam langsam um den Tresen herum, als wäre es seine Idee gewesen. Die Sache war es nicht wert, viel Aufheben darum zu machen. Rennick war Mitte zwanzig, vier oder fünf Jahre jünger als ich, trotzdem hatten wir denselben Dienstgrad. Ich hatte vor Kurzem die Prüfung zum Sergeant abgelegt, erwartete aber keineswegs, befördert zu werden. In meiner Akte fanden sich so viele dunkle Flecken, dass man meinen könnte, sie wäre durch die Scheiße gezogen worden.
Sutty stürmte durch die Tür und marschierte an mir vorbei auf die Schwesternstation zu. Er stülpte die Taschen nach außen, gab sein Handy heraus, lehnte sich über den Tresen und spreizte die Beine.
»Willst du mich nicht filzen?«
Rennick schob ihm wortlos das Blatt hin, auf dem er sich eintragen musste. Sutty richtete sich auf, kritzelte seinen Namen in die Spalte und stapfte weiter. Er besaß die unheimliche Gabe, andere zu erschrecken, und die Freude, die ihm das bereitete, hatte beinahe etwas Lebensbejahendes. Er bog zu Wicks Zimmer ab und verschwand darin.
»Wie geht’s meinem großen tapferen Jungen?«, bellte er, bevor die Tür hinter ihm zufiel.
Verächtlich betrachtete Rennick das Blatt mit der Unterschrift. »War er schon immer so?«, fragte er.
»Solange ich ihn kenne.«
Er sah zu Wicks Zimmer, bemüht, die coole Fassade aufrechtzuerhalten, aber seine Neugier auf Sutty gewann die Oberhand. Er packte sein Gewehr und nickte mir zu.
»Ihr macht doch beide sonst die Nachtschicht …«
»Für unsere Sünden«, sagte ich. Sutty und ich hatten so viele angesammelt, dass ein Priester schreiend aus dem Beichtstuhl geflüchtet wäre. Wer bei der Nachtschicht gelandet war, befand sich auf der niedrigsten Stufe der Polizei und übte auf Außenstehende eine makabre Faszination aus.
Es gab nur zwei, die schon lange dabei waren.
Detective Inspector Sutcliffe und ich. Andere Beamte wurden gelegentlich zu uns abgestellt und beäugten uns misstrauisch, als hätten sie Angst, sie könnten sich bei uns anstecken und permanent der Nachtschicht zugeteilt werden. Als Folge davon waren wir relativ selbstständig, setzten uns mit dem Kleinkram auseinander, unspektakulären Verbrechen, ohne von der Dienststelle allzu viel mitzubekommen oder von ihr beaufsichtigt zu werden. Unsere offizielle Dienstzeit ging vom Abend bis in die frühen Morgenstunden, in einer Stadt, die über ein ausgelassenes Nachtleben verfügte. Wer im Dienst für Probleme gesorgt hatte, wurde gelegentlich durchrotiert, bis er sich eines Besseren besonnen oder seine Kündigung eingereicht hatte. Sutty und ich galten als nicht resozialisierbar.
»Detective Inspector Peter Sutcliffe …«, sagte Rennick und las vom Blatt ab. »Ein bisschen unglücklich, dieser Name, oder? Der Yorkshire Ripper lässt grüßen.«
Wir hörten leises Murmeln aus dem Gang.
»Keine Ahnung … ich glaube, er passt zu ihm.«
Rennick lächelte. »Unser DS meint, ich müsste mich verhört haben, als ich ihm sagte, dass ihr beide für Wick abgestellt seid. Er meint, der Nachtschicht kann man noch nicht mal trauen, die Schwänze auf einer Klotür zu zählen.«
»Hier geht’s nur um die auf einer Krankenhausstation, Rennie.«
»Ich wusste gar nicht, dass man auch Leute in unserem Alter zur Nachtschicht schickt«, sagte er, ohne auf die Beleidigung einzugehen. »Auf Dauer, meine ich …« Er senkte die Stimme. »Was hast du ausgefressen, damit man dir das aufbrummt?«
»Nichts Aufregendes.« Er wartete. »Das Richtige auf die falsche Art.«
»Da hab ich was anderes gehört«, sagte er grinsend. »Ich gehe davon aus, dass du jetzt clean bist?« Als ich nichts erwiderte, fuhr er fort. »Warum bist du hier? Da muss doch was dahinterstecken.«
Klar glaubte er, es müsste was dahinterstecken. Schließlich war er ja hier.
»Sutty gehört zu denen, die Wick festgenommen haben.«
»Echt?« Rennick war sichtlich beeindruckt. »Dachte, das wäre dieser Blake gewesen …«
»Blake hat für die Verurteilung gesorgt, aber Sutty war als Erster am Tatort. Jemand hat einen Typen gemeldet, der blutüberströmt durch die Stadt spaziert ist, und Sutty hat alles stehen und liegen lassen, damit er als Erster dort war.«
Rennick runzelte die Stirn. »Und zwölf Jahre später wird er von der Nachtschicht abgezogen, damit er Wick das Händchen halten kann, während der stirbt? Kapier ich nicht.«
»Du weißt, eines der Kinder ist nie gefunden worden …«
»Ja«, sagte er. »Lizzie Moore.«
»Genau.« Mit einem Nicken deutete ich in den Gang. »Solange Wick noch lebt, ist es für die Familie die letzte Chance, herauszufinden, was er mit ihr gemacht hat.«
»Ja, aber warum ihr zwei?«
»Wie nennst du den Gefangenen immer?«
»Wichser«, antwortete Rennick ohne zu zögern.
Ich nickte. »Siehst du, Sutty spricht diese Sprache. Fließend. Sie sind gut miteinander ausgekommen, nachdem er Wick verhaftet hat. Die da oben meinen, wenn ihn jemand zum Reden bringt, dann er.«
»Die sind miteinander ausgekommen?« Rennick verzog das Gesicht. Ich glaubte zu sehen, wie sich ihm vor Widerwillen die Haare aufstellten. »Wick hat eine Frau umgebracht, drei Kinder …«
Ich nickte, aber es war schwer zu erklären.
Oberflächlich betrachtet hatte Sutty mit einem Kriminellen mehr gemein als mit einem Polizisten. Nur, während Verbrecher emotional handelten, aus Wut oder aus ökonomischer Notwendigkeit, liebte Sutty das Verbrechen, und je niedriger die Beweggründe, desto besser. Sein Beruf als Polizist ermöglichte es ihm, ständig davon umgeben zu sein, ohne seine Freiheit aufs Spiel zu setzen. Manchmal, wenn es sehr lange zu ruhig gewesen war, hatte er so seine Art, gewisse Sachen anzustoßen.
Insgeheim stimmte ich Rennick zu.
Unsere Abstellung war ungewöhnlich, unwahrscheinlich sogar, aber ich wollte lieber nicht wissen, was der eigentliche Grund dafür gewesen war. Wenn die Antworten von Mal zu Mal übler ausfallen, stellt man irgendwann keine Fragen mehr.
Ich wusste nicht genau, woher die Abstellung kam, aber ich vermutete, dass Sutty seine desinfizierte Hand mit im Spiel hatte.
»Wie ist er denn so?«, fragte Rennick und unterbrach mich in meinen Gedanken.
»Sutty?«
Er rollte mit den Augen. »Martin Wick.«
»Keine Ahnung«, sagte ich. Er sah mich zweifelnd an. »Ich meine, er redet nicht mit mir.«
»Wenn du mit ihm zehn Stunden am Stück da drin bist …«
»Schreibe ich alles auf, was er tut, und rufe Sutty, falls er nach ihm verlangt.«
»Da bist du ja ein echter Glückspilz.«
»Ja«, sagte ich. Es fühlte sich eher an, als hätte ich die Arschkarte gezogen.
Ich ging an ihm vorbei und drehte die Zeitung auf dem Tresen um. Auf der Titelseite prangte ein Foto von Martin Wick, unserem Gefangenen, wie er in seinem Krankenhausbett saß und Cornflakes mampfte. Es war von der Tür zu seinem Zimmer mit einem Handy aufgenommen worden.
Cereal Killer!
»Verdammte Scheiße«, sagte ich und sah zu Rennick.
»Nicht in meiner Schicht. Ich werde immer schon vor dem Frühstück abgelöst.«
»Wenn Sutty das sieht, kriegt er einen Koller.« Ich sah aufs Datum. Die Frühausgabe der sonntäglichen Morgenzeitung. In wenigen Stunden würde die Welt, wenn sie erwachte, das zu sehen bekommen. »Woher hast du die?«
»Hab sie in meiner Pause in der Aufnahme mitgehen lassen.«
»Und dir ist nicht der Gedanke gekommen, das zu erwähnen?«
»Es wurde doch nicht in meiner Schicht aufgenommen«, wiederholte er.
»Aber du lässt schon jeden seine Hosentaschen umdrehen, oder?« Nur überprüfte Personen durften über diesen Punkt hinaus. Pflegern, dem Reinigungspersonal, sogar Ärzten und Krankenschwestern war der Zutritt nur zu festgelegten Zeiten erlaubt. Es war Aufgabe des Wachmanns, sie alle zu durchsuchen.
Keiner durfte über diesen Punkt hinaus ein Handy mitnehmen.
Er runzelte die Stirn. »Sicher mach ich das.«
Wir drehten uns beide um. Sutty kam aus Wicks Zimmer. Er wirkte beunruhigt. Ich versuchte mich zwischen ihn und die Zeitung zu stellen.
»Hast du mal kurz Zeit, Aidan?«, fragte er.
»Klar …«
Ich stülpte die Taschen nach außen, übergab mein Handy und unterschrieb, damit ich den Kontrollpunkt passieren konnte. Ich ging an Rennick vorbei in den Gang hinein und wollte ein wenig Abstand zu ihm haben, bevor ich Sutty die schlechten Neuigkeiten präsentierte.
Große Plastikplanen verhüllten die Wände.
Davor Eimer voller Bauschutt. Überreste der Renovierungsarbeiten, die zurückgestellt waren, bis Wick tot war.
Sutty hielt die Klotür auf, als wollte er mich in sein Büro geleiten. Ich trat ein, fand den Lichtschalter. Seit Wochen war keiner mehr hier gewesen, wahrscheinlich war es der sauberste Raum im ganzen Gebäude. Ich setzte mich auf den Toilettendeckel. Sutty zog die Tür hinter sich zu und lehnte sich dagegen, sodass keiner rein oder raus konnte.
»Wick behauptet, er hätte dich gar nicht gebeten, mich zu holen …«
»Hat er aber. Ich meine, er hat dir diesen Zettel geschrieben. Wenn ich das falsch verstanden habe, tut’s mir leid, dass ich dich angeschleppt habe.« Sutty sagte nichts, dachte nach, dann änderte sich seine Miene.
»Jurgh«, sagte er schließlich. »Ich glaub dir. Er hat den Zettel geschrieben und gewollt, dass du mich holst. Irgendwas läuft hier ab.«
»Meinst du, er stirbt?«
»Er stirbt seit Monaten. Mittlerweile sollte er sich daran gewöhnt haben. Nein, was anderes. Er scheint, ich weiß nicht … er scheint Angst zu haben.«
»Du meinst, es liegt ihm was auf der Seele?« Ich dachte an die Zeitung, erwähnte sie aber nicht und senkte die Stimme. »Was? Warum?«
Sutty starrte finster zu Boden, dann löste er sich von der Tür und öffnete sie. Als er in den Gang hineinsah, schüttelte er den Kopf. Ich steckte ebenfalls den Kopf raus. Rennick war wieder in seine Zeitung vertieft. Er hatte das Kinn auf den Lauf seines Sturmgewehrs gestützt.
»Die Hand am Rohr«, sagte Sutty. Wir gingen raus, und er knallte mit aller Macht die Tür zu. Rennick fuhr zusammen, sprang auf, fummelte an seinem Gewehr herum und konnte von Glück reden, dass er sich nicht die Birne wegknallte. Sutty stapfte zum Tresen, inspizierte die Besucherliste und baute sich vor dem Wachmann auf.
»Constable, hatte der Gefangene in unserer Abwesenheit irgendwelche Besucher?«
»Was?«
»Was, Sir«, blaffte Sutty. »Ich glaube nämlich, dass jemand mit Wick gesprochen hat, als wir weg waren. Vielleicht ein Arzt oder eine Schwester bei einer außerplanmäßigen Visite, vielleicht jemand, der sich nicht eingetragen hat. Vielleicht hast auch du dich von deiner Neugier hinreißen lassen, ich weiß es nicht. Aber dieser Typ, der kurz davor war, uns zu erzählen, was er mit einem toten zwölfjährigen Mädchen angestellt hat, kriegt plötzlich den Mund nicht mehr auf.«
»Keiner ist hier reingekommen.«
Suttys Blick fiel auf die Zeitung auf dem Tresen. Er sah das Foto von Wick im Krankenhausbett und griff sich das Blatt. Ich kannte diesen Blick und war froh, dass er nicht mir galt. Der Blick von einem, der vor lauter Scheißungeduld gleich explodieren würde. Er griff sich seine Brieftasche vom Tresen, öffnete sie und begann das Geld zu zählen.
Rennick schnaubte. »Ich würde Ihr Geld nie anrühren, Sir.«
»Das weiß ich«, sagte Sutty. »Aidan, wie heißt dieser Typ, der im Rising Sun seine Dienste anpreist?«
Ich dachte nach. »Rohrbomben-Willy.«
»Genau der. Behauptet, für fünfzehn Mücken bricht er dir sämtliche Knochen.« Sutty knallte die Brieftasche auf den Tresen und beugte sich zu Rennick vor. »So, ich hab seine Telefonnummer und zwei Zwanziger, also rück jetzt raus mit der Sprache.«
»Beim Frühstück hab ich nie Dienst. Ich war nicht da, als das Foto gemacht wurde.«
Schließlich drehte sich Sutty um. »Bestätige mir das, Aidan.« Er packte sich die Zeitung und stürmte in Wicks Zimmer zurück. »Und hol mir einen Kaffee. Schwärzer als ein Hundert-Meter-Lauf.«
Ich wartete, bis ich die Tür knallen hörte, dann nickte ich keinem Bestimmten zu und ging zum Treppenhaus, ohne Rennick noch mal anzusehen.
5
Auf dem Weg nach unten flackerten die Lichter, wurden schwächer und gingen schließlich ganz aus. Sutty verlor die Beherrschung, so wie andere ihre Schlüssel verloren. Leichtsinnig und völlig gedankenlos, manchmal schien er sie auch nicht mehr wiederzufinden. Seltener kam es vor, dass er seinen Zorn wie einen Scheinwerfer auf andere richtete, ihnen dadurch Einhalt gebot und Dinge ins Rampenlicht rückte, von denen sie nicht wollten, dass man sie zu sehen bekam. Wenn ihm Wicks anscheinender Gesinnungswandel Kopfzerbrechen bereitet hatte, dann stand vermutlich etwas dahinter. Besorgniserregend war nur, dass seine Nase ihn sofort zu Constable Rennick geführt hatte.
Vor uns lag eine lange Schicht, und ständig kam es zu Unfällen mit Schusswaffen.
Das Notstromaggregat setzte ein, die Lichter gingen wieder an, allerdings nur mit der Hälfte ihrer üblichen Leuchtkraft. Ich rieb mir etwas Leben ins Gesicht und trat durch die Tür ins organisierte Chaos einer innerstädtischen Notaufnahme an einem Wochenende.
So schnell wie möglich schlängelte ich mich auf dem zerschrammten Linoleum durch den Tumult der ankommenden und abgehenden Patienten.
Ich stieg die Haupttreppe hinauf, fort von dem Trubel, und sah gerade noch ein Notfallteam, Ärzte und Schwestern, die jemanden in den OP-Bereich schoben. In diesem Gebäudeteil gab es keine Fenster, die Tageszeit ließ sich meistens aber ganz gut am Zustand der jeweiligen Patienten ablesen. Heute waren die Betten an den Wänden aufgereiht, in ihnen Menschen in unterschiedlichen Stadien der Versehrtheit, die darauf warteten, dass woanders Platz frei wurde. Ich schob mich zwischen ihnen durch, während ein weiteres Triageteam vorbeirauschte, dem fast sofort ein drittes folgte.
Saturday Night Fever.
Als ein letztes Team vorbeieilte, fiel mein Blick auf die leeren Augen des Mannes auf der Rollbahre, der eine fürchterliche Kopfverletzung aufwies. Das Team drehte in einen Nebenraum ab, hinter ihnen gingen die Türen zu.
»Entschuldigung …« Ich sah auf eine kleine Frau hinab, die dem Team durch den Gang gefolgt war. Ich wollte an ihr vorbei, aber sie legte mir die Hand auf die Brust. Sie wirkte bestürzt, verloren, ihre Stirn war blutverschmiert. Wahrscheinlich stand sie unter Schock. »Arbeiten Sie hier? Wissen Sie, ob er wieder gesund wird?«
»Nein«, sagte ich und wich von ihrer Hand zurück. »Ich meine, ich arbeite hier nicht.«
Ich ging um sie herum bis ans Ende des Korridors und verschwand um die Ecke, ohne mich noch mal nach ihr umzusehen. Weiter, immer weiter, um mich im Labyrinth der Abteilungen und Stationen zu verlieren. Ich erreichte einen völlig leeren Abschnitt, lehnte mich an die Wand und atmete tief durch.
Dem Mann hatte die Hälfte des Schädels gefehlt.
Irgendwann ging ich zum Kaffeeautomaten und wühlte in meinen Taschen nach Kleingeld. Ich befand mich nur wenige Meter weiter genau in dem Gang, in dem auch Martin Wick lag, aber wegen der Trennwand brauchte man zehn Minuten hierher.
Ich warf die erste Münze ein, erfasste im schwarzen Plastik mein Spiegelbild, sah an mir hinunter und entdeckte die Blutflecken, die die besorgte Frau auf meiner Brust hinterlassen hatte. Vermutlich hätte ich ihre Fingerabdrücke abnehmen können. Ich steckte die Münzen wieder in die Tasche und ging auf die Toilette, um mich zu säubern.
6
Der Spiegel über dem Waschbecken war eine blank polierte Metallplatte, damit die Junkies ihn nicht zerbrechen und die Scherben als Messer verwenden konnten. Die Oberfläche war matt und dort, wo sich manche mutwillig daran versucht hatten, voller Dellen. Mich starrte ein so surreales Bild an, als wäre es die schlechte Übertragung aus einer anderen Dimension. Ich musterte mich. Die dunklen Augenringe wurden allmählich rot.
Die Bestätigung, dass ich der Typ im Spiegel war.
In den ersten beiden Seifenspendern war keine Seife, lediglich der Vollständigkeit halber probierte ich auch den dritten. Auch er war leer, also ließ ich die Blutflecken Blutflecken sein, knöpfte mir das Jackett zu und ging zur Tür.
Ich hatte sie schon geöffnet, als aus einer der Kabinen ein seltsamer Laut kam.
So was wie ein Gurgeln. Ich drehte mich um und sah zwei zerfetzte, leere Plastikgelbeutel, die aus den Seifenspendern gerissen worden waren. Schimmernd lagen sie wie zwei riesige zerquetschte Nacktschnecken auf den Kacheln. Dann ein weiteres Geräusch. Ein langer, feuchter Schmatz.
»Hallo?«, sagte ich.
Keine Antwort.
Ich ging auf die Kabine zu. Das Licht wurde dunkler. Auf halbem Weg hielt ich an. Ich wusste ganz genau, was ich vorfinden würde. Die Tür stand halb offen, und als ich sie ganz aufdrückte, sah ich eine ausgemergelte Frau in einem grünen Jogginganzug mit hochgezogener Kapuze. Sie saß auf dem geschlossenen Klodeckel und saugte an einem Beutel Flüssigseife. Jede Packung entsprach angeblich sechs Gläsern Wodka und knallte voll rein. Auch wenn sie einem nicht unbedingt die Innereien ausputzte, die Nachwirkungen jedenfalls waren drastisch.
Amnesie, Blindheit, Kontrollverlust über den Schließmuskel.
Zumindest war sie dafür am richtigen Ort.
Sie hatte grüne Fingernägel und Tattoos im Gesicht, Fünfecke unterschiedlicher Größe um die Augen. Ihr Alter konnte ich unmöglich schätzen. Ein Leben wie ihres trieb den Tachostand ziemlich nach oben oder nahm eine ganze Menge davon weg, je nachdem, wie man es sehen wollte.
»Verpiss dich«, sagte sie und saugte erneut an der Gelpackung. Sie tat mir leid, deshalb widmete ich ihr nicht die Aufmerksamkeit, die nötig gewesen wäre. Ich nickte und überließ sie sich selbst, hörte noch, wie die Tür zufiel und hinter mir abgesperrt wurde. Ich hätte ihr sagen sollen, dass sie sich den Mund ausspülte, aber es war einfach zu deprimierend.
7
Ich kehrte mit zwei Kaffee in den Trakt zurück, wo Rennick Habachtstellung angenommen hatte. Als ich ihm einen Kaffee auf den Tresen stellte, sah er mich nicht an. Verletzter Stolz, oder doch was Ernsthafteres?
»Prost«, sagte ich. Er antwortete nicht.
Ich ging zu Wicks Zimmer und war hypersensibel, als wäre eine Zielscheibe auf meinen Rücken geheftet.
Von drinnen kam leises Gemurmel, ich lauschte kurz an der Tür, bevor ich anklopfte und eintrat. Sutty saß neben Wick und kam gerade zum Ende einer dreckigen Geschichte.
»Ich hab gesagt, ich hätte schon von anderen Pfarrern gehört, dass sie Babys küssen, aber der ist der Erste, der auch noch die Zunge zum Einsatz bringt.«
Bei schlüpfrigen Geschichten lief Sutty gewöhnlich zu Hochform auf, heute war sein Vortrag allerdings eher lau. Vielleicht weil er damit einen abrupten Themenwechsel kaschieren wollte.
»Schwarz«, sagte ich und reichte ihm seinen Kaffee.
Er nahm den Becher entgegen und ließ ihn auf dem Tisch vor sich hin dampfen, brach eine neue Tube Desinfektionsgel auf und rieb es in die Hände ein.
»Immer noch viel los da drüben?«, fragte er.
Ich nickte und sah zu Martin Wick. Ich hatte das Gefühl, dass ich in was reingeplatzt war, aber seine glänzenden Überwachungskamera-Augen hatten sich, seitdem ich ins Zimmer gekommen war, nicht bewegt. »Ist er wach?«
»Siehst du das nicht?«, sagte Sutty.
»Wie geht’s, Martin?« Ein Zucken in seinem Gesicht, dann das vertraute Frösteln bei mir, als er seine schwarzen Augen auf mich richtete. Sutty beugte sich vor, legte das Ohr an Wicks Mund und lauschte der geflüsterten Antwort.
»Sagt, wenn es noch Gerechtigkeit auf der Welt gibt, dann wird er wieder ganz gesund werden.«
»Wenn es Gerechtigkeit auf der Welt gäbe, wären wir arbeitslos. Wie geht es ihm wirklich?«
»Wir wollten gerade zusammen lesen, wie es mit seiner Lebenserwartung steht.« Sutty hielt die Zeitung hoch, damit Wick sie sehen konnte. Erst jetzt erkannte ich, dass das abgedruckte Bild ihn zeigte, wie er ganz offensichtlich Schmerzen hatte und es ihm alles andere als gut ging. »Was das Leben kostet«, las Sutty die Bildunterschrift vor. »Nach Auskunft von Krankenhausmitarbeitern klammert sich Mr Wick ans Leben, wahrscheinlich sind ihm aber nur noch wenige Tage vergönnt.« Er legte die Zeitung weg und sah zu unserem Gefangenen. »Glaub nicht alles, was in der Zeitung steht, Martin.«
Wicks Lippen bewegten sich. Sutty beugte sich zu ihm hinunter.
»Hm«, sagte er, als würde er eine Frage beantworten. »Krankenhausmitarbeiter, das kann so gut wie jeder auf der Station sein. Ärzte, Schwestern, Putzfrauen. Du würdest doch nicht seine Story verhökern, oder, Aidan?«
»Würde sie mir überhaupt jemand abkaufen?«, erwiderte ich. »Meinst du wirklich, er will das alles lesen?«
Sutty schlug die Seite um zu dem Bild einer lächelnden Familie. Fünf Personen waren zu sehen. Mutter, Vater, zwei Mädchen und ein Junge. Die Moores.
»Du hast doch nichts dagegen, wenn ich deinem Gedächtnis ein bisschen auf die Sprünge helfe, oder, Martin?« Wicks Lippen bewegten sich erneut, Sutty beugte sich zu ihm und lauschte. Als er sich wieder aufrichtete, hatte sich sein Gesicht verfinstert, langsam ging sein Blick zu mir. »Vielleicht solltest du dir diesen Scheiß vom Hemd waschen.«
Ich sah zum eingetrockneten Blut auf meiner Brust.
»Klar«, sagte ich und verließ das Zimmer. »Lass den Kaffee nicht kalt werden.« Sutty wandte sich kommentarlos wieder Wick zu. Draußen im Gang war dann erneut das leise Murmeln zu hören, und erst dann bemerkte ich, dass mich Constable Rennick vorn an der Schwesternstation eindringlich beäugte. So, wie er seine Waffe hielt, starrte ich direkt in den Gewehrlauf. Ich überquerte den Gang zur Toilette und fragte mich, was hier abging.
8
Als ich das Licht anmachte, entdeckte ich ein weiteres ausgepresstes Flüssigseifenpäckchen, exakt so eines wie auf der Toilette hinter der Trennwand. Es war noch nicht dagewesen, als ich mich hier mit Sutty unterhalten hatte. Ich sah zu den Halterungen über den Waschbecken, alle leer, und stieß die halb offene Tür zur Kabine auf. Die beiden noch übrigen Gelpäckchen trieben im Wasser der Kloschüssel. Ich trat zurück, sah hoch und bemerkte eine lose Deckenplatte direkt über der Kabine.
Mein Herzschlag reagierte auf die Unregelmäßigkeit, ich verließ die Toilette.
Rennick gaffte mich an.
»Alles in Ordnung?«, fragte ich.
Er antwortete nicht.
»Ist alles in Ordnung, Constable?«
Er nickte. Ich ging an ihm vorbei ins Treppenhaus.
»Du bist voller Blut!«, rief er mir hinterher.
Ich war diese Stufen in den vergangenen Wochen so oft rauf- und runtergelaufen, dass meine Beinmuskulatur kräftiger geworden war. Jetzt legte ich einen Zahn zu, stürzte durch die Türen im Erdgeschoss, schob mich durch die Menge in der Aufnahme, hoffte, dass alles nur meiner Paranoia zuzuschreiben war, und rannte die Haupttreppe zur Station hinauf. Immer noch war eine Menge los, ich zwängte mich durch den Korridor zur Toilette, wo ich etwa zwanzig Minuten zuvor die Junkiefrau gesehen hatte. Ein Mann stand am Urinal. Als ich gegen die Wand der Kabine schlug, spürte ich seinen Blick auf mir.
Von drinnen war nichts zu hören.
Ich trat einen Schritt zurück und sah, dass auch hier eine Deckenplatte fehlte. Mit der Schulter rammte ich die Tür ein, die Kabine war leer, in der Kloschüssel trieb eine leere Seifenpackung. Oberhalb der Tür war lediglich ein schmaler Spalt zu erkennen. Entweder hatte sich die Frau selbst im Klo runtergespült, oder sie war zur Decke hinaufgeklettert.
»Fuck«, sagte ich.
Der Mann am Urinal ging, ohne sich die Hände zu waschen. Ich folgte, schob mich wieder an Patienten und Krankenhausmitarbeitern vorbei, schubste die Leute vor mir aus dem Weg und lief die Haupttreppe hinunter. Bis ich den Stau an der Aufnahme wieder hinter mir gelassen hatte und im Treppenhaus war, flackerten die Lichter erneut, wurden fahl, dann gingen sie ganz aus.
Ich tastete nach dem Handlauf und ging nach oben.
In der Luft lag ein starker chemischer Geruch, außerdem glaubte ich von oben Schritte zu hören. Mein Herz schlug so heftig, dass ich schon Angst hatte, ich würde mir die Rippen aufschürfen. Als die Lichter flackernd wieder angingen, strich etwas Kaltes an mir vorbei. Ich drehte mich um. Die ausgemergelte Frau mit dem grünen Hoody ging die Treppe hinunter, dann begann sie zu laufen.
»Hey!«, rief ich ihr hinterher und zuckte zusammen, als der Feueralarm losgellte.
Im engen Treppenhaus hörte sich das an, als würde mir jemand einen Presslufthammer an die Schläfen drücken. Ich hielt mir die Ohren zu und lief nach oben. Schon als ich die Tür aufstieß, ahnte ich, dass etwas nicht stimmte. Rennick war nicht mehr auf seinem Posten. Völlig sinnlos, im Getöse des Alarms nach ihm zu rufen. Ich ging in den Flur hinein, bei der Schwesternstation warf ich einen Blick über den Tresen und wich zurück. Der Constable lag auf dem Boden und hatte beide Hände am Hals. Blut sickerte zwischen seinen Fingern hindurch, und er sah aus, als würde er ertrinken.
In diesem Augenblick stürzte Sutty aus Wicks Zimmer. Er brannte lichterloh und warf sich, begleitet von einem Hitzeschwall, von der einen Wand zur anderen. Ich löste mich aus meiner Erstarrung, riss einen Feuerlöscher von der Wand und richtete den Schaum auf ihn. Er fiel zu Boden und wälzte sich in den letzten Flammen, bevor die Sprinkler ansprangen, uns beide durchtränkten und ihn endgültig löschten.
Ich schob mich an meinem Kollegen vorbei in Wicks Zimmer, wo mir ein unglaublicher Gestank entgegenschlug.
Er wand sich versengt in seinen Handschellen, mit denen er ans brennende Bett gefesselt war. Ich richtete den Feuerlöscher auf ihn und sprühte seinen Oberkörper ein. Die Flammen wurden erstickt, aber ich roch die verbrannte Haut, die verbrannten Haare und schlug mir den Arm vor den Mund, damit ich den Geschmack nicht auf der Zunge hatte. Ich wollte schon raus, als ich sah, dass er noch lebte und im Schrillen des Alarms auf sich aufmerksam machte.
Ich ging zu ihm und legte vorsichtig das Ohr an seinen Mund.
»Ich war’s nicht«, glaubte ich ihn sagen zu hören.
Ich spürte die Hitze, die von ihm ausging. »Ich weiß, Martin …«
»Nicht das«, sagte er. Seine schwarzen Augen starrten mich aus der verkohlten, blasenwerfenden Haut an, sie funkelten vor Wut. »Die Moores«, sagte er. Die Haut über seinem Mund platzte auf, er schlug mir mit seiner freien Faust gegen die Brust. Vielleicht sagte er noch mehr, aber es wurde vom Feueralarm übertönt. Als sein Körper auf das schwelende Bett zurücksackte, musste ich seinen Puls nicht mehr fühlen.
Entsetzt, von den Sprinklern klatschnass, taumelte ich in den Gang hinaus. Sutty war zu Rennick gekrochen und versuchte mit den bloßen Händen den Blutfluss aus dem Hals des Constable zu stoppen.
Das Wasser um ihn herum färbte sich rot.
Ich lief zu ihnen und dann an ihnen vorbei zum Treppenhaus. Drei Stockwerke tiefer glaubte ich jemanden davonrennen zu sehen. Ich folgte, nahm zehn Stufen auf einmal, rutschte auf meinen nassen Sohlen weg und schlitterte um jeden Treppenabsatz.
Übers Geländer hinweg konnte ich weitere Leute auf der Treppe sehen, und als ich das nächste Stockwerk erreichte, flog die Tür neben mir auf.
Die Leute flohen über die Notausgänge.
Ich schob mich durch die Menge, glaubte immer noch die Frau zu erkennen, wusste aber nach wenigen Sekunden, dass sie mir entkommen war. Obwohl ich drängelte und aus Leibeskräften brüllte, brauchte ich ewige Minuten, bis ich überhaupt ins Erdgeschoss gelangte. Die, die sich am Ausgang versammelt hatten, sahen mich alle mit der gleichen widerwilligen, erstaunten Miene an. Sie sahen das Blut an meinen Händen, auf dem Gesicht und auf dem von den Sprinklern durchnässten Hemd. Ich hievte mich auf die Motorhaube, dann aufs Dach eines Krankenwagens, blinzelte in die grellen Lichter des Parkplatzes, aber mir bot sich in allen Richtungen nur ein Bild.
Menschen, Wahnsinn, überall.
9
Es war nach vier Uhr morgens. Statistisch die Zeit mit den meisten Todesfällen. Ausnahmsweise waren wir dem Zeitplan voraus. Noch oben auf dem Krankenwagen setzte ich einen Notruf ab, wenige Minuten später traf eine bewaffnete Polizeieinheit ein und sicherte den Tatort. Ich lieferte eine Beschreibung der Junkiefrau, die sich auf der Toilette zugedröhnt hatte, sowie der Umstände, die zum Angriff auf Rennick, zu Suttys lebensgefährlichen Verletzungen und zum Anschlag auf Martin Wick geführt hatten – zumindest soweit ich sie mitbekommen hatte. Noch während ich das alles erzählte, wurde mir klar, dass ich nicht viel mitbekommen hatte. Der diensthabende Chief Inspector entließ mich mit einem knappen Nicken. Ich erhob mich, hoffte, eine Bar zu finden, in die ich mich reinfallen lassen konnte, als ich eine Hand auf der Schulter spürte. Der gepolsterte Handschuh eines Mitglieds der Spezialkräfte, also hörte ich zu, als er mir etwas ins Ohr flüsterte.
»Superintendent Parrs«, sagte er nur.
Ich schloss die Augen, fast erwartete ich, mein Leben würde jetzt an mir vorbeiziehen.
»Bringen Sie mich zu ihm.«
Er führte mich zurück ins Treppenhaus, wo wir nach oben gingen. Ich fühlte mich verdreckt, meine Haut juckte, ich stank nach Blut, nach verbranntem Fleisch und verbrannten Haaren. Bewaffnete Einsatzkräfte standen auf jedem Stockwerk und umfassten fester ihre Waffen, wenn wir uns näherten. Die letzte Tür, die wir erreichten, wollte sich nicht öffnen lassen, der Polizist warf sich mit der Schulter dagegen, bis sie aufsprang. Ich sah ein schwaches Licht und spürte den Wind in den Haaren.
Wir standen auf dem Krankenhausdach.
Der Bereich war nicht für die Öffentlichkeit gedacht, der Weg bestand aus Kies, in dem sich Gräser in die Höhe mühten. Ich sah verrostete, bis obenhin mit Zigarettenkippen gefüllte Coladosen, entdeckte sogar, halb versteckt hinter einem Stapel Backsteine, eine leere Ginflasche. Mein Begleiter streckte den Arm aus wie der Gastgeber einer Gameshow, um mir meinen Gewinn zu präsentieren.
Es sah nicht aus wie der erste Preis.
Superintendent Parrs stand mit dem Rücken zu uns, er war allein und blickte auf das von Scheinwerfern erhellte Chaos hinunter. Seine grauen Haare, der graue Mantel, die graue Hose verschmolzen mit der schartigen Skyline, sodass er aussah, als wäre er eins mit der Stadt. Die Morgendämmerung hatte noch nicht eingesetzt, nur ein diesiger Lichtstreifen lag über dem Horizont. Als hinter mir die Tür zufiel, ruckte der Kopf des Superintendent, er nahm mich zur Kenntnis. Der andere war verschwunden.
»Aidan Waits«, sagte Parrs. Sein schottischer Akzent klang noch härter als sonst. Wie eine an einem Betonziegel geschärfte Klinge. »Als ich gehört habe, einer meiner Leute hätte den Abgang gemacht, da hab ich irgendwie an dich denken müssen …« Er drehte sich zu mir um und sah mich an, seine Augen waren so blutunterlaufen, dass ich dachte, er müsste alles in Rot sehen. »Aber jetzt bist du hier, gesund und munter.«
»Alles Schlechte hat auch was Gutes, Sir.« Er sagte nichts. Ich sah zu Boden. »Guten Morgen, Superintendent.«
»