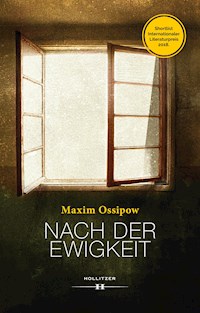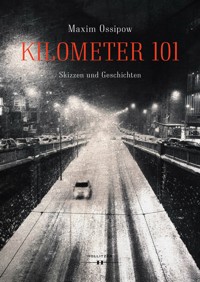
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: HOLLITZER Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Maxim Ossipows zweite deutschsprachige Veröffentlichung versammelt Essays, Geschichten und Novellen. Egal welches Genre der Autor wählt, egal wo seine Erzählungen spielen (die russischen Provinzen, Westeuropa, die USA), sein Focus gilt den Erwartungen, Ambitionen und Ängsten seiner Protagonisten. Was diese teilen, ist eine existentielle Einsamkeit; ein schmerzhafter Zustand, der bisweilen aber auch produktive Kräfte freisetzt. Ossipows Charaktere leben voll und ganz im 21. Jahrhundert, sind jedoch getrieben von elementaren zeitlosen Fragen, die endgültige Antworten erfordern, denen sie sich in der Regel entziehen. Der Blick des Autors auf die beschriebenen Verhältnisse ist klar und gänzlich unsentimental, ja gnadenlos, und doch immer getragen von großer Empathie für die handelnden Personen. Ihm gelingt das Kunststück, uns an der Offenbarung plötzlicher Glücksmomente dieser Menschen teilhaben zu lassen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 461
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
KILOMETER 101
Maxim Ossipow
KILOMETER 101
Skizzen und Geschichten
Deutsch von Birgit Veit
Lektorat: Regine Weisbrod
Umschlaggestaltung: Nikola Stevanović
Satz: Daniela Seiler
Hergestellt in der EU
Maxim Ossipow: Kilometer 101. Skizzen und Geschichten.
Deutsch von Birgit Veit
Die Übersetzung wurde vom Institut Perevoda gefördert.
Alle Rechte vorbehalten
© HOLLITZER Verlag, Wien 2021
www.hollitzer.at
ISBN 978-3-99012-888-6
INHALT
Sventa
Kilometer 101 – Skizzen aus dem Provinzleben
Auf heimatlichem Boden
Es könnte schlimmer sein
Unösterliche Freude
Die Kinder von Dzhankoj
Fantasie
Heimkino
Little Lord Fauntleroy
Die Zigeunerin
Figuren auf der Ebene
Luxemburg
Anmerkungen
SVENTA
Reiseskizze
Zum Andenken an meine Eltern
Wnukowo ist der kleinste, gemütlichste Flughafen von Moskau, und wenn du da landest, zumal am Samstag um elf Uhr abends, erwartest du kein Tohuwabohu. Eintragung in den Pass, Koffer, alles im Eiltempo:
„Woher?“
„Aus Vilnius.“
„Was bringen wir mit?“
Nichts Besonderes: Bücher, Käse. Die Normen der Einführung von Lebensmitteln werden von dir nicht überschritten: Geh durch. Aber gerade da, am Ausgang, erwartet dich eine Überraschung. Eine dichtgedrängte Menge Männer. So viele könnten zum Beispiel auf ein Flugzeug aus Tbilissi warten, aber nein, sie sehen nicht aus wie Grusinier. Es gibt auch keine Belästigungen: „Taxi, Taxi in die Stadt, preiswert“, es ist merkwürdig leise – trotz der Menge. Du drängst dich hindurch, aber sie wird nicht weniger dicht, die Leute weichen nicht aus, stören aber auch nicht absichtlich – sie stehen einfach da. Kräftige Männer mittleren Alters, bartlos, in dunklen Mänteln und Jacken, als würden sie dich gar nicht sehen. Sie reagieren nicht knurrig, machen keine Bemerkungen, wenn ihnen jemand mit den Rollen des Koffers über die Füße fährt. Es scheint, man könne sie kneifen oder stechen, sie rühren sich nicht. Eine unverständliche, dunkle Kraft aus einem Traum: Wer sind sie, wohin wollen sie – auf eine Pilgerreise oder einen Hadsch nach Mekka. Das klären wir gleich: Wo ist die Wache, die Polizei?
Wenn du dich zur Glastür durchdrängelst, entdeckst du, dass sie geschlossen ist – da auf der Straße ist ebenfalls eine Menge, aber eine andere, buntere, bestehend aus beiden Geschlechtern. Die Tür wird von einem Polizisten bewacht, er hat in der Hand ein Gefäß – wie spät du doch endlich begreifst: Das ist ein Altarlämpchen, es ist der Abend von Karsamstag, die Leute sind in Erwartung erstarrt, bald trifft das segensreiche Feuer ein.
„Spezialflug aus Tel Aviv. Wir warten auf den Flieger.“
„Rak ze chasér lánu“, das hat uns gerade noch gefehlt, das ist der einzige Satz, den du auf Ivrit beherrschst.
In einer oder zwei Stunden landet das Sonderflugzeug, die Obrigkeit verteilt das Feuer im Beisein des Fernsehens an die Männer, und sie bringen die Altarlämpchen nach Moskau, in das Gebiet um Moskau und die Nachbargebiete. Dann erst lässt man auch alle anderen ins Innere des Flughafens. Eine Reportage fällt hier nicht schwer: Die Menschen fahren von überall nach Wnukowo – „Wir kommen schon das sechste Jahr her“, „Wir glauben an das Volk, an unser Land“.
Nur die Ruhe, nur die Ruhe, keine Panik. Der Polizist deutet an: „Die dritte Tür dient als Ausgang.“
Den Koffer hinter dir herziehend, musst du dich wieder durchdrängeln. So endet die Reise nach Litauen.
„Was für Emotionen ruft dieser Ort bei Ihnen hervor?“, fragte eine Korrespondentin der Zeitung von Zarasai auf Englisch. Sie war die Einzige, die dich und Tomas, den Übersetzer und Verleger, empfing, und sie verstand kein Russisch.
„Für mich ist Zarasai gar kein Ort, sondern eine Zeit. Mit einem Wort: Paradise lost.“
Das Mädchen hatte einen Verdacht: „Sehnt sich der Genosse nach der UdSSR?“
„Nein überhaupt nicht! Nur nach den Zeiten, da meine Eltern noch lebten.“
„Sind Sie zum ersten Mal im freien Litauen?“
„Im freien, ja, zum ersten Mal. Es ist gut, wenn man sich nicht als Besatzer fühlt.“ Du bist durch Vilnius gelaufen, alles hat dir gefallen, aber es hat dich hierhergezogen. Du schaust dich um: eine neue Bibliothek am See (die ganze Stadt liegt am Ufer), ein Café mit Säulen, das aus den frühen Siebzigerjahren stammt und nicht in Betrieb ist (da gab es Tagesgerichte), eine katholische Kirche. Das Denkmal für das bewaffnete Mädchen namens Melnikaitė ist spurlos verschwunden. Und, wie üblich in solchen Städtchen, ist die Natur anziehender als das, was die Menschen gebaut haben.
„Warum sind Sie nicht schon früher gekommen?“
Die Antwort war ein Achselzucken. Mein Vater hatte von da vor fast vierzig Jahren geschrieben: Hier ist es ruhig, und es gibt keine Konflikte. Sowohl im Haus wie in der Stadt, wo jetzt wenig Leute sind und man mich wahrscheinlich deshalb sogar auf der Post höflich behandelt. Und manchmal fühlst du dich nicht wie ein schäbiger Moskauer mit belastetem Gewissen, sondern siehst die Welt anders: Du empfindest ihre Unerbittlichkeit.
Und hier deine eigene Tagebuchnotiz von vor fünfzehn Jahren: Möchte nach Zarasai, wo ich so viel Zeit verbracht habe: jeden Sommer, so viele Jahre hintereinander. Fahre hierhin und dorthin, wohin man fahren muss, wohin man sich schämt, nicht zu fahren, nur nicht nach Zarasai. Das heißt nicht sein eigenes Leben leben.
Hier war es windig, sauber: Sandböden, und auch die hiesigen Einwohner sind bestrebt, die Sauberkeit aufrechtzuerhalten. Öde.
„Geräumig“, sagte die Korrespondentin lächelnd.
„Ja.“ Sie verabschiedeten sich. „Kommen Sie im Sommer mit Freunden.“
Keine schlechte Idee. Aber von denen, mit denen du nach Zarasai gefahren warst, war der eine in San Francisco, der andere in Amsterdam, einem anderen musste die Freundschaft aufgekündigt werden, und einige, Eltern und Schwester eingeschlossen, waren tot.
Und du fährst zu der Halbinsel, die zwei Kilometer entfernt ist, auf der Südseite des Sees, an den Weg erinnerst du dich, du brauchst weder Navigator noch Begleiter.
„Hier stand das Haus …“ – zweistöckig, aus Stein. Keine Spur ist von ihm geblieben, man hat es abgerissen. Nach dem Tod der Eigentümer (von dem du erfahren hast) teilten die Kinder das Erbe und verkauften das Haus, aber den Käufern gefiel es nicht. Sie zerstörten es mit allen Anbauten und machten es dem Erdboden gleich. Sie wollten etwas Eigenes bauen, aber offenbar ging ihnen das Geld aus. So erzählen die Nachbarn, sie erinnern sich sogar ein bisschen an eure Familie.
Merkwürdig, das Haus war solide gebaut. Mit einem Riesenbalkon, auf den der Mittagstisch hinausgetragen wurde. „Der, mit dem wir uns treffen“, sagte Mutter tonlos, „euer Gast und Nachbar, der Sergej Rachmaninow ähnelt und ebenfalls aus Moskau stammt, hat mir beim Teetrinken erklärt, dass er Parteisekretär seines Instituts ist.“ Mutter war schweigsam, besonders im Vergleich zu Vater, konnte aber auch hinter vorgehaltener Hand etwas Peinliches anmerken. Sie war hier nur im Juli und August, während Vater zu jeder Zeit hier war. Im Sommer wohnte er oben, im Winter: hier ungefähr, wo du jetzt stehst. „Gerade flattert auf ein Vogel / Durchs leere damalige Fenster.“
Gedichte hin, Gedichte her – das Verschwinden des Hauses macht fassungslos: Steine, so stellt sich heraus, sind auch nicht von Dauer. Das ist traurig, obwohl es natürlich Schrecklicheres gibt und du nicht Nabokov oder Proust bist. Geh durch die Kiefern über das weiche Moos, geh ans Wasser. Weder die hohen, alten Kiefern noch die dünnen Bäumchen am Ufer noch das Dickicht des Schilfrohrs ist weg: Da sind sie, da, wo sie hingehören.
Eine Erinnerung: 1978, August, das heißt, du bist fast fünfzehn. Mit Charitóscha, einem Mitschüler und Freund fürs Leben, habt ihr die Jacht Delphin zu Wasser gelassen, ein über und über geflicktes Modell aus der DDR (damals war es üblich, Dinge zu reparieren), zwei Schwerter an den Seiten, die das Abdriften verhindern und für Kursstabilität sorgen. Ihr legt ab zu einer Reise über den Zarasaitis-See: du am Stagsegel, Charitóscha am Großsegel und am Steuer. Steiles Segeln am Wind: Mach dich bereit, dich auf die Seite zu legen. „Mamascha: auf Wiedersehen, Freundin: auf Wiedersehen / Ich bin ein Matrose der Baltischen Flotte.“
Aber eines der Schwerter hat sich losgerissen und kann das Boot nicht aus der Bucht hinausführen, die Wellen treiben euch zum Ufer zurück. Lahm versucht ihr, abwechselnd zu rudern. Vater beobachtet es vom Steg: Er ist schon ein paarmal ins kalte Wasser gestiegen und hat euch aus dem Dickicht gezogen. Stopp. Charitóscha hat eine Idee: „Es wäre gut, Epoxid zu beschaffen. Und das Schwert anzukleben, hol’s der Teufel …“ „Ach, Epoxid!“ Bis zum Gürtel im Wasser stehend, hält Vater eine lange Rede. „Rotzlöffel“ war noch das freundlichste Wort, das er fand.
Epoxid wurde zum Schlagwort für abwegige Ideen, und dein Boot wirst du auf der Leinwand sehen, wenn du das Archiv zu durchsuchen beginnst. Anfang der Sechziger hatte die Delphin einen Motor und keinen Mast, Vater sitzt hinten, Mutter fährt Wasserski auf der Oka. Nach Vaters Tod wurdest du impulsiv, aktiv, die Zeit ist gekommen, auch andere Verpflichtungen zu übernehmen: die Fotos zu rahmen, das Archiv aufzuräumen.
Nach dem, was mit dem Haus geschehen ist, bist du auf das Verschwinden der Banja vorbereitet: Sie war hölzern und baufällig. Wir wuschen uns samstags, freitags holten wir Wasser aus dem See und bereiteten das Brennholz vor. „Wir haben gut gearbeitet“, sagtest du mit zehn Jahren zu Josas, dem großen, hageren Hausbesitzer mit den riesigen, sehr kräftigen, von der Arbeit schwarzen Händen, du wolltest dich bei ihm einschmeicheln. „Ja, wir haben alle anderen abgehängt“, antwortete er verträumt. Josas rauchte filterlose Zigaretten: der Geruch des angezündeten Streichholzes und so weiter – wenn du möchtest, erinnere ich mich auch an die Abenteuer in der Banja, aber das hier sind Reiseskizzen und nicht der Film „Amarcord“.
Also weder Haus noch Banja, und sogar den Steg haben sie durch etwas geschmacklos Fundamentales ersetzt. Bleib hier nicht hängen, hier auf der Halbinsel, nimm Tomas mit und fahrt nach Sventa, aber vorher – in den Wald.
Die Bibliothekarin hatte einen Plan gezeichnet: von der Landstraße Richtung Degučiai nach Dusetos abbiegen, dann hinter der zweiten Bushaltestelle nach dem Schild Ausschau halten. „Hier kamen achttausend Juden um, erschossen von den deutschen Faschisten am 26.August 1941.“ Das Wort „Juden“ auf dem Obelisken wirkte wie eine unmögliche Kühnheit, in deiner Jugendzeit wurde dieses Wort nur in besonderen Fällen gebraucht, man konnte die ja nicht Sowjetbürger nennen. Links und rechts ein grasbewachsener Graben, zweihunderttausend litauische Juden liegen in solchen Gräben.
Die Entsowjetisierung hatte sich auch auf das Denkmal ausgewirkt, man hatte die russische Aufschrift entfernt. Ist das richtig? Das ist nicht deine Entscheidung, du hättest sie beibehalten. Jetzt gab es zwei Aufschriften: eine jiddische und eine litauische. „An diesem Ort töteten die nationalsozialistischen Mörder und ihre Helfer auf brutale Weise achttausend Juden – Kinder, Frauen und Männer. Heiliges Gedenken der unschuldigen Opfer“: jiddisch. In der litauischen Version wird das präzisiert: „einheimische Helfer“.
Es gab auch welche, die retteten. Und die erst erschossen und dann retteten. Und sogar umgekehrt – das ist schwer zu glauben, aber auch das ist vorgekommen.
Es herrscht vorbildliche Ordnung: Umzäunung, ordentliche Bordsteinkante, Davidstern auf dem Obelisken, auf dem Sockel Kerzen und die Flaggen Israels, Steine, und irgendjemand hat ein kleines, selbstgemachtes Kreuz mitgebracht. Das war früher nicht da.
„Leiden, beweinen“, sagt Tomas, „ist die Aufgabe der Litauer.“
Alle kennen hier den Witz, dass die letzte Frau unbedingt eine Litauerin sein muss: Sonst kümmert sich keiner um das Grab. Nein, nein, das sind nicht Mandelstams „Frauen, feuchter Erde nah Verwandte“, sondern Versuche des Ausbruchs aus einer beliebigen schrecklichen Lebenssituation.
Auf dem Weg zum Hotel: Erinnerung an den kleinen finsteren Alten von sechzig Jahren mit dem alkoholgeschwärzten Gesicht, einen einheimischen Schlosser oder Elektriker, der auf einem Motorrad mit Beiwagen fuhr und etliche Jahre gesessen hatte: „Die Polacken – an die Mauer. Die Russen – an die Mauer. Die Jidden …“, er hob den Blick und guckte Vater an, „… von den Jidden jeden Zweiten.“
Jetzt hätte man ihm das nicht durchgehen lassen, aber damals duldeten sie das ungerührt, sie waren ja Besatzer. Žydai – ein anderes Wort für Juden hat das Litauische nicht. Unter allen möglichen Aspekten betrachtete sich der Alte ebenfalls als Opfer. Radio Free Europe schickte den Waldbrüdern bis Mitte der Fünfzigerjahre tröstliche Nachrichten: Haltet durch, Kameraden, nicht mehr lange, bald kommt wieder ein Weltkrieg.
Damaliger Aufbruch nach Sventa für einen ganzen Tag: mit Decken und Essen, Büchern, Krügen für Blaubeeren, Körben für Pilze, mit einem Volleyball, und beim Auto sah man durch die Löcher im Boden den Asphalt, und die Gangschaltung war natürlich mechanisch. Wie habt ihr Mutter ausgelacht, als sie später, schon mit dem Anbruch der Freiheit, aus Amerika zurückkam und erklärte, die Autos hätten jetzt keine Gangschaltung mehr – das kann nicht sein –, und sie stimmte zu: Ihr müsst es besser wissen. Und wie sie jetzt mit Vater die einfache Freude teilen würde, die Freude über das vollkommene Auto, auch wenn es ein Leihwagen ist. Nach dem Weg braucht man nicht zu fragen – den zeigt das Navi an. Es schlägt Sventskoe ozero, Sventes ezers vor, das ist es. Auf deinem Umschlag steht ja auch „Maksimas“.
Was ist das denn für eine Grenze? Gehört Sventa zu Lettland? Natürlich, ihr fuhrt ja nach Daugavpils, wenn ihr eine richtige Stadt brauchtet. Dort am Bahnhof stand Lenin auch in der größten Hitze in seiner Pelzmütze mit den Ohrenklappen neben dem großen Gefängnis am Bahnhof. LitSSR, LatSSR – die Grenzen hatten keine gravierende Bedeutung. Und da ist auch die bekannte Straße mit dem Kies, hier hast du Autofahren gelernt. Und der kranke, ungepflegte Wald. Alles bekannt: die Straße und der Wald.
Touristen gibt es offenbar nur wenige, und es ist nicht verboten, ans Wasser heranzufahren. Überlaufen war es in Sventa nie – einer der Gründe, es zu lieben –, früher aber war hier ein Naturpark: Lagerfeuer und Autos verboten. Alles andere ist unverändert: hier der Sand, ein Ruderboot mit schwarzem, glänzendem, fett mit Pech bestrichenem Boden, hier der Steg, der vermodert ist, du hast dich so nach ihm gesehnt. Versuchst, darüber zu gehen, und stehst bis zum Knöchel im Wasser. Trocknest die Füße und schaust dich um.
„Was bläst du immer die Trompete, junger Mann? / Lägst besser in einem Sarg, junger Mann.“ Hast du nicht von hier aus, hinter diesen Bäumen versteckt, die Umgebung mit deiner Trompete beschallt? „Poème de l’Extase“, „Götterdämmerung“ – dieses Gedröhne hieltst du für Musizieren. „Unrhythmisch, dafür schiefe Töne.“ Mein Freund, der Pianist, der jetzt in Amsterdam lebt, überredete mich, die Trompete aufzugeben und zur Flöte zu wechseln – ein leises, sinnliches Instrument. Aber ich konnte mich damit nicht anfreunden. Das Glücksgefühl verbindet sich trotzdem mit der Trompete.
Über die Geheimnisse des Glücks. Der letzte von Vater geschriebene Brief schließt so: Wir haben uns versammelt – reden oder schweigen, und wir haben nicht das Gefühl, dass das Leben gelungen oder nicht gelungen ist. Manchmal denke ich: Vielleicht sind wir eigentlich glücklich? Versuch, Tomas von deinen Eltern zu erzählen, aber wie das Geheimnis der Persönlichkeit wiedergeben? Das ist noch schwieriger, als Gedichte zu übersetzen.
Auf uns können verschiedene Erschütterungen zukommen. Sie können auf jeden Menschen zukommen, auf uns umso mehr. Man muss damit so umgehen, dass wir sie möglichst wenig fürchten. Vater erinnerte sich zum Beispiel gut daran, dass er zu einer bestimmten Zeit (Ärzteprozess und drum herum) nicht die einfachste Arbeit finden konnte, wie er fast mit Hoffnung die Deportation der Juden in den Fernen Osten erwartete: Hauptsache, alle zusammen, Hauptsache, die Familie wäre beisammen. Seine Briefe hatten eher erbaulichen Charakter, er beeilte sich, etwas Wichtiges mitzuteilen, während das für Mutter ein Mittel war, das Schweigen fortzusetzen: Den Tag verbracht wie im Zug: Aufwachen, Einschlafen und Nichtstun … Ich plaudere einfach so, man kann in einem Brief ja nicht schweigen.
Eine Weile noch am Wasser stehen, eine Zigarette rauchen, sich an etwas Eigenes erinnern, eine Mandarine essen. Es ist hier tot, still, Friedhofsstille.
Und erst als du ins Hotel zurückkommst und eine gewöhnliche Karte aus Papier studierst, verstehst du, dass du dich geirrt hattest. Sventes, Švjantas, Švjantoin, der heilige See und der heilige Fluss, diese Namen finden sich jenseits und diesseits der lettischen Grenze. Der Švjantas-See ist der, den wir Sventa nannten, wo du hinfahren wolltest. Wie hattest du dich so irren können? Der Unterschied ist ein Häkchen: Šventas ežeras, da muss man nach Süden fahren, nach Turmantas und nicht nach Lettland.
Tomas sollte sagen: „Sie haben alles wiedererkannt, Maxim: sowohl den Weg wie den See.“
„Ja, habe ich.“
Auf dem Weg nach Vilnius vergleicht ihr die Eindrücke. Für Tomas war der Höhepunkt eurer Reise das Poltern der Lastwagen über das Kopfsteinpflaster an der Kirche, der Wind und der Hagel, während du das gar nicht beachtetest. Es ist merkwürdig mit diesen Erinnerungen: Hörst ein ganzes Konzert und erinnerst dich hinterher nur daran, dass der Dirigent rote Socken anhatte.
Störche und Hügel und das viele Wasser, der Himmel erinnert an den in Holland, aber durch die Hügel ist die Landschaft ausdrucksvoller. Wie würdest du dich hier fühlen? Ja, Provinz, aber nicht provinziell, nicht zu sehr. Das ist einfach so ein Land in Osteuropa – in vieler Hinsicht beneidenswert. Alles wird sich hier allmählich einrenken, wenn es zu keiner Einmischung von außen kommt.
„Als ich eine Säule der Gesellschaft war …“, so beginnt deine nicht mehr junge Bekannte gerne ihre Rede. Vielleicht stimmt das sogar. In Litauen gibt es auch Leute, die es lieben, sich an die Zeiten zu erinnern, als das Großfürstentum sich bis zum Schwarzen Meer erstreckte (hauptsächlich durch erfolgreiche Heiraten), aber hier ziehen sie aus der einstigen Größe keine praktischen Schlüsse.
„Sie wissen einfach nicht alles“, das hörte ich in Paris und Rom von antieuropäisch eingestellten Russen. Sie reden nur davon, dass man sie hier und da nicht mag. Liebe Freunde, am wenigsten liebt man uns zu Hause, in Moskau.
„Man muss so handeln, dass wir uns möglichst wenig fürchten.“ Damals warst du keine zwanzig, jetzt bist du schon über fünfzig.
Du sagst zu Tomas: „Alles ist auf erstaunliche Weise zurückgekehrt. Meine Sorgen aus der Zeit vor mehr als dreißig Jahren waren genau dieselben wie jetzt: 1) mir nicht die Finger schmutzig machen, nicht moralisch auf den Hund kommen 2) nicht eingesperrt werden und 3) nicht den Moment verpassen, wo es Zeit sein wird, für immer auszureisen. Und die alte trügerische Hoffnung: Eines Tages werden wir aufwachen, und diese ganze Ohnmacht wird vorbei sein.
Aber die Umstände zwingen einen, nicht zu schlafen, in verschiedene Richtungen zu schauen, den Kopf einzuschalten. Dein witziger Bekannter wird sagen: Fürst Andrej Kurbskij hatte ähnliche Vorstellungen. – Für Kurbskij endete alles mit Litauen.
„Geh zur Müllgrube“, schreibt Boris per Telefon, Freund Boretschka, ein großer Musiker, seines Zeichens Geiger, der vor kurzem aus London hierhergezogen ist. Er kämpft tapfer mit den litauischen Suffixen – žmogus, žmonija, žmogiukštis, žmogiškumas (Mensch, Menschheit und so weiter) – obwohl man in Litauen, wie es heißt, durchaus mit Englisch und Russisch durchkommt. Übrigens sind die Häkchen über den Buchstaben eine Erfindung von Jan Hus.
Boretschka möchte, dass dir die Stadt gefällt, er fährt dich hierhin und dahin, entschuldigt sich für alle möglichen Scheußlichkeiten wie die Müllgrube, stell dir vor! Das Leben ist nicht reich, aber auch nicht arm, und die Hauptsache: Es gibt keine Verbote, Einschränkungen, Barrieren und weniger Ärger, als du es in den letzten Jahren von Moskau gewohnt bist. Vilnius ist schön, sauber, aber nicht geleckt. Wo man dich untergebracht hat, sieht es aus wie eine Mischung aus Serpuchow und Paris, und die Altstadt ist etwas ganz Besonderes, sie gleicht keiner anderen.
„Es gibt überall eine Masse Probleme“, sagt der Besitzer des Künstlercafés und lächelt.
Ein erfahrener Mann, der in Israel und Amerika und sogar in Jordanien gewohnt hat und weiß, wovon er spricht. Rechnet er damit, dass die Geheimdienste (wer weiß, wie sie heißen?) ihm das Café wegnehmen und er froh sein kann, wenn sie ihn nicht einsperren? Da wird Amnesty International nicht mit der Wimper zucken. Er ist ehrlich erstaunt: Nein, so etwas ist nicht zu befürchten, was für ein Glück, dass die Sowjetunion zusammengebrochen ist! Du hast ebenfalls davon geträumt, noch vor Litauen, schon mit acht Jahren bei der Lektüre von Dickens’ „Die Pickwickier“. Und wusstest, dass es eine Stadt namens London gibt, in Büchern, auf Karten, aber London sehen, davon träume nicht, mein Sohn.
„Man sieht, dass der Autor wenig vertraut mit der Theorie der Prosa von Wiktor Schklowski ist“, sagte einer der Zuhörer, nicht laut, aber deutlich. Ein riesiger Litauer, der im Observatorium von Vilnius arbeitet. Schwierig, nicht arrogant zu sein, wenn man im Observatorium arbeitet.
Gespräche, Lesungen auf Russisch. Für wen, fragt sich, wurde das Buch denn eigentlich übersetzt? Die Antwort ist klar: für den Autor. Wer spendiert also den Umtrunk? Das wurde dir an ganz anderer Stelle gesagt, allerdings aus einem ähnlichen Anlass.
Užupis, Stadtbezirk der freien Künstler, mit einer komischen Verfassung und Regierung (Tomas hat da einen wichtigen Posten) – hier liest du deine Erzählung „Fantasie“:
„Houston …“, sagt Ada nachdenklich. „Andrjuscha, wir haben uns in Vilnius eine kleine Wohnung gekauft …“
Vilnius, finden sie, kann sie zwar nicht vor allem bewahren, aber mit dem Pass des Staates Israel …
„Was, sogar einen israelischen Pass haben die?“
Und die Zuhörer lächeln, und am Ende kommt ein Moskauer deines Alters auf dich zu, ein Absolvent der physikalisch-mathematischen Schule und Doktor der Wissenschaften – es stellt sich heraus, dass die Wohnung, in der man dich untergebracht hat, ihm gehört, er wirbelt nur nicht vor deiner Nase mit dem Laissez-passer, dem israelischen Pass herum, besitzt ihn aber. So ist also ein Reim gefunden, die Lösung ist eine ganze Zahl und nicht irgendein irrationaler Kokolores.
„Kommen Sie öfter oder gleich für immer. Glauben Sie mir, hier gibt es Liebenswertes.“
„Wie schön doch in der Dämmerstunde / Sich’s plaudern lässt beim Glase Wein.“
Sie wissen einfach nicht alles, hier sagte niemand dergleichen. Am letzten Tag des Aufenthalts in Vilnius fängst du an, Bekannte auf der Straße zu treffen. Vilnius ist imstande, abzulenken und zu zerstreuen – gerade so viel wie nötig. „Wie kann ich denn traurig sein, wenn es dir gut geht.“ Freude zu teilen – dafür sind Eltern ideal. Fertig, setz dich auf deinen Platz und fahr mit, setz dich gerade hin und schnall dich an.
Die Träume erledigen sich einer nach dem anderen – manche, weil sie in Erfüllung gehen, aber größtenteils, weil sie nicht notwendig sind. Vater wollte, dass du Doktor der Medizin wirst – wozu? Oder: Du hast einen schönen Friedhof auf der anderen Seite der Oka ausgesucht, hast alles mit der Frau abgesprochen, die dafür zuständig ist, aber plötzlich ist das zu nichts nutze – stille, gemütliche Friedhöfe finden sich auch hier, in greifbarer Nähe, an deinem Ufer.
Dort gibt es etwas, was man lieben kann, das ist sicher. Und hier auch, und wie! Man muss nur eine Öffnung finden zwischen den dunklen, harten Männern, die den Ausgang versperren, und ins Freie gelangen. Über die Männer ist schon alles gesagt. Erinnere dich an die, die du liebst – zum Beispiel den Priester, der alle deine Verwandten beerdigt hat. „Aristokratismus und Einfachheit, das ist das Beste, was die Russen haben.“ Denk daran, schau aufs Wasser, erinnere dich an Litauen.
Weit nach Mitternacht bist du zu Hause. Du gehst ins Netz und liest gemeinsam mit deinen Angehörigen das erste Kapitel des Johannes, vom Beginn bis zum siebzehnten Vers – auf Altkirchenslawisch, Englisch, Deutsch, Russisch. Das ist dein Ostern in diesem Jahr.
Tarussa, April 2017
KILOMETER 101
Skizzen aus dem Provinzleben
Der Stadt N. gewidmet
Auf heimatlichem Boden
1.
Schon seit anderthalb Jahren arbeite ich als Arzt in der kleinen Stadt N., einer Kreisstadt, die in einer an Moskau grenzenden Region liegt. Es ist Zeit, eine Bilanz meiner Eindrücke zu ziehen.
Erstens – und das ist das Schrecklichste: Bei den Kranken und auch bei vielen Ärzten sind zwei Gefühle am stärksten ausgeprägt – Angst vor dem Tod und Hass gegenüber dem Leben. Sie wollen nicht über die Zukunft nachdenken: Hauptsache, es bleibt alles beim Alten. Kein Leben, sondern Überleben. An Feiertagen sind sie fröhlich, trinken und singen; aber schauen Sie ihnen in die Augen, Sie finden dort keinerlei Fröhlichkeit. Kritische Stenose der Aorta, das muss operiert werden. Sonst brauchst du nicht im Krankenhaus zu liegen. „Wie? Soll ich sterben?“ Ja, es läuft darauf hinaus, dass du stirbst. Nein, sterben will er nicht, aber ins Regionszentrum fahren, Druck machen, sich einsetzen will er auch nicht. „Ich bin schon fünfundfünfzig, ich habe meine Zeit gelebt.“ „Was wollen Sie denn dann?“ „Einen Schwerbehindertenausweis.“ An die Möglichkeit, gesund zu werden, glaubt er nicht, er will kostenlose Medikamente. „Doktor, ob ich es wenigstens bis zur Rente schaffe?“ (Nur Loser schaffen es nicht bis zur Rente, wenn du es schaffst, ist das Leben gelungen.)
Zweitens: Die Macht ist aufgeteilt zwischen Geld und Alkohol, das heißt zwischen zwei Verkörperungen des Nichts, der Leere, des Todes. Viele meinen, man könne die Probleme mit Geld lösen, was fast nie stimmt. Wie kann man mit Geld Interesse am Leben, an der Liebe wecken? Und dann fordert der Alkohol sein Recht. Er führt beispielsweise zu folgendem Verhalten: Vor kurzem fiel ein zweijähriger Junge namens Fedja aus dem zweiten Stock. Die betrunkene Mutter und ihr boyfriend, also ihr Lebensgefährte, brachten Fedja ins Haus zurück und schlossen sich ein. Zum Glück hatten die Nachbarn alles gesehen und riefen die Miliz. Sie schlug die Tür ein, und das Kind kam ins Krankenhaus. Wie es sich gehört, jammerte die Mutter im Flur. Milzriss, die Milz wurde entfernt, Fedja lebt und hat selbst den Schnorchel rausgezogen (sie hatten es nicht mitbekommen, weil sie gleichzeitig eine andere Operation durchführten), und dann riss er den Katheter aus der Vene.
Drittens: Fast in allen Familien gab es in jüngster Zeit Fälle eines gewaltsamen Todes. Ertrinken, Explosion von Feuerwerkskörpern, Mord, Verschwinden in Moskau. Das macht den Hintergrund aus, vor dem sich das Leben auch unserer Familie abspielt. Nicht selten hast du es mit Frauen zu tun, die ihre beiden erwachsenen Kinder zu Grabe getragen haben.
Viertens: Ich habe bislang kaum Menschen erlebt, die von ihrer Arbeit oder überhaupt ihrer Tätigkeit begeistert sind, und diese Apathie führt zur bezahlten Unfähigkeit, sich auf die eigene Heilung zu konzentrieren. Zumal es auch schwierig ist mit diesen ganzen Namen der Medikamente (handelsübliche und generische) und den Dosierungen: um fünfundzwanzig Milligramm einzunehmen, muss man eine Tablette von fünfzig Milligramm halbieren, eine Tablette von hundert Milligramm in vier teilen. Schwierig, keine Lust, darauf Mühe zu verwenden. Sich jeden Tag zu wiegen und bei einer Zunahme des Gewichts die doppelte Dosis harntreibender Medikamente einzunehmen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Sie haben keine Waage, und dass man sie kaufen könnte, kommt ihnen nicht in den Sinn, am Geld liegt es nicht. Die Menschen sind praktische Analphabeten, sie können Buchstaben zu Wörtern zusammenfügen, aber sie wenden dieses Können in der Praxis nicht an. Die häufigste Antwort auf den Vorschlag, einen umfangreichen gedruckten Text mit meinen Empfehlungen zu lesen: „Ich habe meine Brille nicht dabei.“ Wenn du keine Brille dabeihast, heißt das, du hattest heute nicht vor, etwas zu lesen, genau das ist Analphabetismus. Noch ein Beispiel: „Haben Sie verstanden, wo Sie jetzt hinmüssen, haben Sie verstanden, dass Sie sich auf mich berufen müssen?“ „Ich denke ja.“ „Und wie heiße ich?“ Bös: „Woher soll ich das denn wissen?“
Fünftens: Freundschaft ist eine Besonderheit der Intelligenz. Die sogenannten einfachen Menschen haben keine Freunde: Mich hat noch nie jemand nach dem Zustand der Patienten gefragt außer den Angehörigen. Es fehlt die gegenseitige Hilfe, wir sind die größten Individualisten, die man sich vorstellen kann. Die Nation hat keinen Selbsterhaltungstrieb. Ein Jammer: Es ist einfacher zu sterben, als den Nachbarn zu bitten, dich nach Moskau zu fahren. „Du hast keine Frau? Aber Freunde?“ Nicht vorhanden. Einen Bruder habe ich, aber er lebt in Moskau, irgendwo muss seine Telefonnummer liegen.
Sechstens: Die Männer sind fast immer Idioten. Ein Mann mit Herzinsuffizienz, dem seine Frau nicht auf die Füße tritt, ist zum schnellen Untergang verurteilt. Diese Idiotie fängt schon im Knabenalter an und nimmt zu, selbst wenn der Mann inzwischen leitender Ingenieur oder beispielsweise Agronom geworden ist.
Ein Mann, der für seine Angehörigen sorgt, ist eine Seltenheit und flößt umso mehr Achtung ein. Einer von diesen, Alexej Iwanow, ist mein Patient – er hat durchgesetzt, dass man seiner Frau eine Niere implantierte, er verkaufte alles, was sie hatten, gab vierzigtausend Dollar aus. Normalerweise ist es anders: Gott hat es gegeben – Gott hat es genommen, Gedenken am neunten und am vierzigsten Tag.
Leute, die in die höheren Kreise vorgedrungen sind, sind widerwärtig. Dieser Tage kam so eine mit einem relativ frischen Vorderwandinfarkt. Mit dem gestohlenen Geld ihres Mannes hat sie in der Nachbarschaft ein großes, steinernes Haus gebaut. Sie sieht in mir ihresgleichen oder fast ihresgleichen und beschwert sich deshalb anfangs, sie sei ganz durchgerüttelt, „obwohl das Auto gut ist, ein Volvo“, und dann erzählt sie: „Ich muss jetzt meinen Enkel nach Zypern zu meiner Tochter schicken, sie studiert da. Wissen Sie, Zypern ist ganz heruntergekommen, zu viele Schwule.“ Und in dieser Art geht es weiter. Übrigens ist die Situation im Allgemeinen asexuell, nicht wie in manchen Moskauer Kliniken, wo die Anziehung der Geschlechter buchstäblich in der Luft liegt.
Noch eins: Alte Menschen werden bei uns fast nicht behandelt. Sie ist siebzig, was wollen Sie? Dasselbe wie eine Fünfundzwanzigjährige. Ich erinnere mich an die zittrige Alte in einem Geschäft. Stöhnend suchte sie, wie man so sagt: geschickt, das heißt: möglichst billig, Käsestückchen, gute Butter, Wurst aus. Hinter ihr bildete sich eine Schlange und die Verkäuferin, eine junge dicke, hellhäutige Frau, sagte gefühlvoll: „Ich werde bestimmt nicht so alt!“ Die Alte hob mit einem Mal den Kopf und sagte fest: „Doch. Und zwar sehr bald.“ In Sparta gingen sie mit den Siechen noch rationaler vor – was ist von Sparta geblieben außer ein paar Anekdoten? Es mag der Eindruck entstehen, dass wir bestimmte Ressourcen und Bemühungen für die Heilung der Jungen reservieren, das stimmt aber nicht. Ein alter Mensch wird behandelt, wenn er gesellschaftlich bedeutend ist (der Vater des Chefs des Elektrizitätswerks, die Mutter des Vizechefs der Administration).
Überhaupt sind die alten Frauen am interessantesten. Vor kurzem habe ich eine halbe Nacht lang einen provisorischen Herzschrittmacher einzusetzen versucht; als endlich alles geklappt hatte, drückte ich meinem Assistenten die Hand – und da reichte die eben noch halbtote Alte mir ebenfalls die Hand: „Und ich?“ – und drückte sie fest.
Der ewige Kommentar: „Sie haben gut reden, Maxim Alexandrowitsch.“ Im Klartext heißt das – Sie haben es gut, Maxim Alexandrowitsch, Sie sind nicht zu faul, um dies oder jenes machen.
Die Rolle der Kirche im Leben der Kranken und des Krankenhauses ist nicht der Rede wert. Es gibt noch nicht einmal die äußeren Attribute der Frömmigkeit wie Ikonen auf den Nachttischchen. Und doch sind alle getauft, alle tragen ein Kreuz um den Hals, darunter auch ein schrecklicher Mann namens Ulrich. Er hat mit eigenen Händen achtundsechzig Menschen erschossen (Nationalisten in der Ukraine, Verbrecher nach der Amnestie von 1953 und so weiter, und zwar einfach so, „wegen einer Kleinigkeit“), er ist Chauffeur, Veterinär, Wunderheiler und informeller Mitarbeiter bei der Staatssicherheit (wahrscheinlich eine Lüge). Er hat eine Dienstwaffe, eine automatische Stetschkin-Pistole (wenn das nicht wieder eine Lüge ist). Sein Schlag hat eine Stärke von einer halben Tonne, neulich hat er seinem erwachsenen Sohn die Vorderzähne ausgeschlagen. Ordnung muss sein. Und wer sie nicht einhält, den stoppen wir mit der Faust oder, wenn nötig, mit einer Kugel. Seine Rente: zweitausendsiebenhundert Rubel. Wie, hilft die Staatssicherheit denn nicht? Nein, das ist freiwillig. Mit Ulrich zu reden, ist schrecklich: Ehe man sich’s versieht, greift er zur Stetschkin. (Seine Exfrau, die sich mit schwarzer Magie beschäftigt und ein Büro in Moskau hat, schadet ihm und wendet alles Diesbezügliche an: Karma, Atemschutzgeräte, Magneten). Die Verrücktheit ist eine Folge des vollbrachten Bösen und nicht umgekehrt. Aber solche Patienten sind die Ausnahme, normalerweise sind die Menschen friedliebend.
Der Idiotismus der Obrigkeit (in der Region und in Moskau) wird noch nicht einmal diskutiert, diskutiert werden nur die Möglichkeiten, sie auszutricksen. Deshalb erlebt man Geschichten, für deren Beschreibung man das Genie der Petruschewskaja braucht. Hier eine von ihnen: Es gibt eine Anordnung, nach der amputierte Extremitäten nicht vernichtet (also beispielsweise verbrannt), sondern auf dem Friedhof beerdigt werden müssen. Die nachlässigen einbeinigen Bürger nehmen ihre amputierten Beine nicht mit nach Hause, so dass sich vor kurzem sieben Beine in der Leichenhalle angesammelt hatten. Man musste auf die Beerdigung eines Obdachlosen warten (auf Staatskosten und ohne Zeugen), um ihm diese Beine ins Grab zu legen.
Was sehe ich an Gutem? Die Freiheit, vielen Menschen zu helfen. Selbst wenn die Hilfe nicht angenommen wird – wir schaffen die Möglichkeit. Hindernisse vonseiten der Ärzte und der Administration existieren nicht. Wenn du ein Zimmer mit intensiver Therapie haben willst – bitteschön. Willst du importierte Medikamente austeilen – nur zu. Willst du einen Patienten aufnehmen, damit ihn seine Alkoholiker-Mutter in Ruhe lässt, tu das. Auch das Fehlen von Traditionen hilft. Im Unterschied zu anderen Provinzstädten hält sich N. nicht an irgendwelche Traditionen.
Fremdenfeindlichkeit gibt es im Allgemeinen nicht, obwohl kürzlich ein von einer Druckerei gestaltetes Flugblatt mit dem Text „N. soll eine weiße Stadt bleiben“ von einer Ladentür abgerissen werden musste. Dabei sind meinen Beobachtungen zufolge alle, die etwas für das Krankenhaus tun wollen, Zugezogene. Es gibt eine große Toleranz, darunter leider gegenüber ganz intolerablen Dingen wie dem Heroinhandel, der nicht im Mindesten verurteilt wird. Es ist klar, dass die Moskauer Diebe sind, sollen sie doch.
Es gibt Respekt vor Büchern und Wissen, vor Lebenserfahrung in der großen Welt, aber keinen Neid. Was macht’s, dass die Patienten einer Herzoperation nicht zustimmen – wer hat schon Lust dazu? Und da erklären die regionalen Koryphäen womöglich noch, dass man nichts zu machen brauche. Ein jeder solcher Fall wird wie ein ärztlicher Misserfolg, eine uneffektive Handlung, ein Scheitern aufgenommen. Deshalb muss man die Diplome an die Wand hängen, aber das Wichtigste ist, sich zu bemühen, sich anzustrengen, das Gespräch und die Begegnung mit dem Menschen zu suchen.
Es ist eine Freude, wenn sich zwar kein Verlangen, aber immerhin die Bereitschaft zum Handeln bei Menschen zeigt, die noch vor kurzem hoffnungslose Fälle schienen. Hinzu kommt das Gefühl der Abgeschlossenheit des Geschehens (alle kommen ins selbe Krankenhaus): Die Fortsetzung jeder Geschichte wird bekannt, was die Verantwortung vergrößert.
Es gibt die Freude der Begegnung: Vor kurzem habe ich die magere lustige neunzigjährige Alexandra Iwanowna behandelt (ihr Vater, ein Geistlicher, starb im Lager, die Mutter verhungerte, sie selbst hatte keine Ausbildung und arbeitete als Kindergärtnerin), ich habe bislang keinen Menschen getroffen, der einem Heiligen so nahekam. Ich sage ihr: „Sie haben eine gefährliche Krankheit (Myokardinfarkt), Sie müssen im Krankenhaus bleiben.“ Sie, fröhlich: „Die Vogelgrippe, ja?“
Dieser Tage bekam ich einen Gruß von meinem Urgroßvater, der kurz nach meiner Geburt starb: Ich wurde aufmerksam auf den schönen und seltenen Namen der Patientin – Ruth. „Ruth, die Ausländerin“, sagte ich zu ihr, und sie antwortete: „Nur ein einziger Arzt wurde auf meinen Namen aufmerksam und liebte mich sehr deswegen, ich war sogar bei ihm zu Hause.“ Dieser Arzt war mein Urgroßvater, er lebte nach dem Lager in der Stadt N., 101Kilometer von Moskau entfernt, wo er auch starb. Heute wird man nicht mehr zum Kilometer 101 geschickt, man muss sich selbst darum kümmern.
Außerdem gefällt mir natürlich das Gefühl, dass es meine Stadt ist, mir gefällt, wenn ich auf der Straße gegrüßt werde. Ein Beherzter in einer Herde von Schafen? Meinetwegen, besser als ein Schaf unter Schafen. Umso mehr, als bald ein weiterer Beherzter auftauchen wird, und dann, wie du siehst, noch einer.
Aus dem Gesagten ist klar, dass ich glücklich bin, in der Stadt N. arbeiten zu können.
April 2006
2.
Noch ein Jahr meines Provinzlebens ist vorbei, vieles hat sich geändert, in großem Maße wegen des oben versprochenen Beherzten, meines jungen Kollegen und Freundes. Zu zweit kommen wir so gut zurecht, dass uns die Kranken kaum reichen. Die Sterblichkeit im Krankenhaus ist auf die Hälfte gesunken. Es gibt immer mehr Möglichkeiten zu helfen, niemand beschneidet die Freiheit, es gibt keinen Grund zu klagen. Ein anonymer Oligarch hat uns einen wunderbaren Apparat geschenkt. Die Arbeit wird professioneller, nähert sich dem Ideal, obwohl sie dennoch weit von ihm entfernt ist. Die Sentimentalität schwindet (wenn man uns die Rolle eines Förderers und guten Menschen aufdrängen will). Wäre das nicht alles geschehen, müsste man die Stadt N. als ein Zugeständnis an die Entropie, als letzte Zuflucht des Doktors Schiwago betrachten: Nicht jeder, der Moskau verließ, ist Generalfeldmarschall Kutusow. Andererseits ist die erste Freude der Begegnung (mit den Leuten, mit der Stadt) vorbei, Grüße von meinem Urgroßvater sind keine mehr eingetroffen, der Blick auf die Umgebung ist nüchterner und deshalb finsterer geworden. Der Einflussbereich unseres Krankenhauses hat sich erweitert, immer häufiger sieht man die Obrigkeit, die des Kreises, die der Region, die von Moskau. Das ist kein Zuckerschlecken, wie der Kollege sagt. Im Unterschied zum Bösen, das immer eine verstärkende Rückwirkung hat (Angst – Atemnot – noch mehr Angst et cetera) wird sinnvolle Aktivität von wachsenden Schwierigkeiten begleitet.
DIE MEDIZIN. Medizinische Hilfe ist in Russland wie früher leicht zu erhalten, aber nicht sehr wirksam: „Sie können versichert sein“, sprach der Doktor weder mit zu lauter noch zu leiser Stimme, „(…) dass ich nie aus Gewinnsucht praktiziere (…) Natürlich könnte ich Ihnen die Nase wieder ansetzen – aber (…) es würde noch viel schlimmer werden. Überlassen Sie das lieber der Natur. Waschen Sie die Stelle öfters mit kaltem Wasser, und ich versichere Ihnen, Sie werden auch ohne Nase so gesund sein, als hätten Sie eine Nase.“ So heilt man auch jetzt ungefähr: In fünf Jahren ändert sich in Russland vieles, in zweihundert Jahren – nichts. Ärzte und Patienten passen wie früher ausgezeichnet zueinander. Aber als wir auftauchen, gerät alles außer Rand und Band: Der eine nimmt, einfach, wenn er sich schlecht fühlt, zu viel Warfarin, ohne zur Kontrolle zu gehen, und hat eine schwere Blutung, der andere hört nach dem Einsetzen einer künstlichen Herzklappe auf, Warfarin einzunehmen, und bekommt eine Thromboembolie der Hüftarterie (man kann sagen: Glück gehabt). Der Grund ist in beiden Fällen derselbe: Alkoholismus und Idiotie der Männer. Die männliche Idiotie zeigt sich in Folgendem: Die überwiegende Mehrheit der Männer antwortet auf die Frage „Was haben Sie für Beschwerden?“ gereizt: „Weißt du, man hat mich zum Kardiologen geschickt.“
Das Hauptproblem unserer Medizin ist das Fehlen eines behandelnden Arztes. Der Patient gehorcht (sofern er überhaupt gehorcht) dem Letzten, zu dem er kommt. Im Krankenhaus verordnen sie das eine, in der Poliklinik etwas anderes, im regionalen Krankenhaus das Dritte, und in Moskau sagen sie, er müsse operiert werden. Auf wen soll man da hören? Auf den, der einem gefällt, auf den, der besser trösten kann, auf den, der am meisten Geld verlangt? Oder auf den, der den klangvollsten Titel trägt? Wie kann ein Professor (Akademiker, leitender Spezialist, verdienter Arzt) Blödsinn erzählen? Ich erinnere mich an mein kindliches Entsetzen, als sich zeigte, dass Erwachsene Dummköpfe sein können; viele meiner Patienten haben bis jetzt diese Entdeckung nicht gemacht, deshalb geraten sie auch in prekäre Situationen.
Auch der Arzt versteht nicht, in welcher Rolle er sich befindet: ob er etwas entscheidet oder seine Meinung sagen soll. In der Theorie ist der Bezirksarzt behandelnder Arzt, aber der beschränkt sich im Wesentlichen auf die Ausstellung von Rezepten und Krankenscheinen, trinkt häufig, verachtet seine Arbeit und sich selbst. (Tschechow nennt in seinen Notizbüchern den Kreisarzt einen unaufrichtigen Seminaristen und Byzantiner, was nicht ganz verständlich ist.) Der Bezirksarzt hat sich längst abgewöhnt, Entscheidungen zu fällen (sagt nicht „ja“ und sagt nicht „nein“, schwarz und weiß darf auch nicht sein) und redet mit den Patienten so: „Tut Ihnen das Herz weh, wenn Sie schnell gehen? Aber warum hetzen Sie dann so?“ Merkwürdigerweise kommt so eine Antwort an.
Es fehlt nicht an Krankenhäusern, an Medikamenten, es gibt keine Verhaltensregeln, kein einheitliches System der Einbeziehung wissenschaftlicher Quellen, kein System der Beweise und keinen Bedarf für ein solches System. Natürlich gelingt es mal, jemandem zu helfen, aber das ist dann Zufall. Wichtig ist doch die Verwandlung der Kunst in ein Handwerk – darin besteht der Fortschritt. Was macht man nicht so alles im Land? Vor kurzem hat man in Petersburg einer Frau die Lunge transplantiert – kann man dann sagen, dass bei uns Transplantationen der Lungen vorgenommen werden?
In gewisser Beziehung ist die Situation hoffnungsloser als in Äquatorialafrika; denn wo es nichts gibt, kann man etwas hinschicken: Arznei, Apparate, Ärzte, die leben sich da ein, und es entsteht etwas – während bei uns eine entwickelte Gesetzgebung existiert, die uns immer effektiver vor Veränderungen zum Besseren schützt. Wie lange ein Mensch leben soll, ob man gegen die Krankheit mit allen bekannten Mitteln angehen soll, entscheidet nicht der Mensch, sondern die Obrigkeit (beispielsweise gilt als offizielle Kontraindikation gegen die Hinzuziehung eines neurochirurgischen Teams: Alter über siebzig Jahre), und dann schreien alle: „Worauf achtet der Staat eigentlich!“ Aber der Staat, das sind die Milizionäre, was verstehen die von der Medizin? Sie können sie nicht anders einschätzen als nach der Zahl der Visiten, der Länge des Aufenthalts im Krankenhaus, der Menge der Hightech-Untersuchungen und so weiter. Anders gesagt: vor der Revolution gab es im Gouvernement Tula nur einen Schriftsteller, jetzt sind es dreitausend.
„Wer braucht uns denn?“, fragt eine noch nicht alte Frau, die aufgehört hat, die von mir verordneten harntreibenden Medikamente einzunehmen, und ganz aufgedunsen ist. „Du selbst, deine Familie.“ Sie winkt ab: „In sowjetischer Zeit …“
Das Fehlen von Leuten, die imstande sind, eine Linie durchzuhalten – in der Behandlung der Patienten, im Gespräch, im Selbststudium –, ist nicht nur in der Kreisstadt, sondern auch im regionalen Krankenhaus und in Moskau zu spüren. Vor kurzem waren mein Kollege und ich in den zwei wichtigsten regionalen Krankenhäusern, das eine, das ärmere, gefiel uns eher (die Ärzte arbeiten schwer, sie lesen Fachliteratur, allerdings leider nur auf Russisch), das andere überhaupt nicht. Beide Krankenhäuser sind übrigens judenfrei, was für medizinische Institutionen nicht gut ist (der Untergang der russischen Medizin begann mit dem Ärzteprozess unter Stalin; später kam dann die massenhafte Emigration, der Weggang der aktiven Leute in westliche Pharmafirmen hinzu). Frau Dr.Ljuba, eine Schönheit mit langen Fingernägeln („Wir sind klinische Kardiologen“, das heißt, wir können nichts machen), wartet darauf, dass man ihr in einem Jahr die Katheter-Ablation von Herzrhythmusstörungen beibringt. Ohne es zu wissen, zitiert der Minister Stalin: „Niemand ist bei uns unersetzlich.“ Ich antworte ihm so sanft wie möglich: „Bei uns doch.“ Er hätte sich mal lieber an den Spruch erinnert: „Die Kader entscheiden alles.“ Wie ich nicht lerne, den Mephisto-Walzer zu spielen, selbst wenn man mir einen neuen Steinway kauft, so kommt Ljuba nicht mit den Herzrhythmusstörungen klar, selbst wenn sie sich die Fingernägel abschneidet. Die Obrigkeit versteht das nicht: Wir bilden sie aus, schicken sie nach Moskau und, wenn’s sein muss, auch nach Europa oder Amerika. Doch das bringt nichts, auf Eisschollen blüht kein Lorbeer, niemand wird in Amerika die russische Sprache lernen, um Ljuba dann von den Herzrhythmusstörungen zu erzählen (sie hat „im Institut ein wenig Englisch gehabt“).
Dann fuhren wir über eine verschneite leere Straße, es war beklemmend schön, der Kollege erzählte etwas aus der Genetik, genauer: aus der Molekularbiologie, und ich sah mich um und dachte: Was für Schicksalsschläge erwarten uns? Was für Schicksalsschläge erwarten die schöne betrunkene Frau, die untätig auf der Kreuzung steht? Schwer zu sagen, irgendwelche. Vielleicht kommt sie zur Vernunft, wird nüchtern und kehrt zu ihren Kindern zurück, oder sie trifft einen guten Mann?
DAS GELD. Der Hauptmythos, an den fast alle glauben, ist die angeblich ausschlaggebende Rolle des Geldes. Der Klatsch – Motor des Provinzdenkens – ist einförmig und langweilig und kreist nur ums Geld. Um meinen Aufenthalt in der Stadt N. kursieren abfällige Gerüchte, die alle mit einer (imaginären) ökonomischen Tätigkeit zusammenhängen. In der Sowjetzeit hätten die Gerüchte anders ausgesehen: Ärger in Moskau, der Wunsch, Experimente an Menschen vorzunehmen, Verbindung mit der Geheimpolizei (diese Anschuldigung ist noch schrecklicher) oder mit dem Ausland, Gier nach Ruhm, familiäres Durcheinander – jetzt interessiert das niemand mehr. Außer Geldgier gibt es Ehrgeiz, es gibt Genuss- und Herrschsucht, aber diese Laster sind vergessen. Das Hauptgerücht: Die Moskauer haben das Krankenhaus gekauft, bald wird alles Geld kosten. Egal, wie leicht die den Menschen entgegengestreckte Hand ist, sie meinen immer, die Hand sucht ihre Tasche.
Besonders bei den Männern hat die Idee des Geldes eine verheerende Wirkung. Mit Geld geht alles: sich selbst heilen, ein Kind, die Mutter heilen. Das führt zu viel stiller Verzweiflung. Unausgesprochen ist es der Grund für den Tod – zum Beispiel: Die Mutter ist gestorben, es war kein Geld für die Behandlung da. Die Verzweiflung wird angeheizt durch den Fernsehwerbespruch „Toyota: fahr deinen Traum“. Und du, Niete, kannst nicht verdienen oder schlimmstenfalls stehlen (um die Mutter zu kurieren, kann man auch stehlen). Echte Männer fahren ihren Traum, „Tefal“ denkt immer an sie, um ihre Zähne kümmert sich „Dirol mit Xylit und Carbanida“ (apropos: Carbanida ist auf Deutsch Harnstoff, nichts Besonderes). Natürlich braucht man Geld, für vieles reicht es nicht, aber das Hauptunglück ist ein anderes, nicht das Geldproblem.
DIE LEERE. Olja M. kam ins Krankenhaus wegen einer Vergiftung mit Essigessenz, sie hatte sich die Speiseröhre verätzt. (Im Herbst hatte sich das Krankenhaus in eine Art „Angleterre“ verwandelt: Einer hatte sich direkt im Zimmer aufgehängt, ein anderer sprang aus dem Fenster, eine Dritte versuchte zweimal, sich aufzuhängen – alles in zwei Monaten). Zuvor hatte Olja schon einmal versucht, sich die Venen aufzuschneiden. Sie ist achtundzwanzig, sieht aus wie fünfzehn und arbeitet in einer Kantine als Putzfrau. Aufgewachsen ist sie im Waisenhaus in Ljudinowo, Region Kaluga. Sie wohnt in einer Zweizimmerwohnung mit ihrem Mann, der trinkt, ihrem Schwiegervater, der trinkt, einer blitzsauberen siebenjährigen Tochter (die kam mit einer Schleife im Haar die Mutter besuchen, davor hatte sie ihren ersten Schultag) und der Schwiegermutter, die offensichtlich an der Enkelin hängt. Ich versuchte, mit ihnen zu reden, aber es kam wenig dabei heraus. Ich befahl dem trinkenden Mann, ihr ihren Pass zurückzugeben und verschloss ihn im Safe. Das war meine einzige sinnvolle Handlung. Ich schlug vor umzuziehen (wohin, wusste ich auch nicht, aber ich hätte mir etwas einfallen lassen) – sie will nicht. Liegt da und langweilt sich, liest nichts, obwohl sie sagt, sie könne lesen. Ich habe ihr das Evangelium geschenkt – sie hat es zurückgegeben (vermutlich hat sie schon nach dem ersten Wort – „der Stammbaum …“ aufgehört). Ich habe ihr ein Gespräch mit Vater K. vermittelt – einem vortrefflichen Geistlichen, er kam zu mir zur Behandlung aus Moskau – zwecklos, nur er redete, aber Olja weinte wenigstens. Wir sammelten Kleider für sie, dann erschien von irgendwoher ein neuer Mann, sie will mit ihm leben, bei der Entlassung ist sie fröhlich.
Nach zwei Monaten ist sie wieder da, betrunken (sie sagt, sie hat nur Bier getrunken, wenig glaubhaft), sie hat sich ganz schön den Bauch aufgeschnitten, wir haben es genäht. Sie sieht schon gröber aus. Stöhnt vor Schmerzen: „Dieser bescheuerte Husten.“ Dem Anschein nach ist sie ein Opfer, aber sie kann in Zukunft fast alles Böse tun, beispielsweise ihren Mann oder das Kind oder mich erstechen. Es wäre am einfachsten, Olja für psychisch krank zu erklären (obwohl sie keine Fantasien und Halluzinationen hat, doch die Frage, was die Seele ist, gilt in der Psychiatrie als unanständig), aber erklärt das etwas? Du schaust Olja an – und es ist klar, dass das Böse für diesen Menschen nicht charakteristisch ist, sondern in ihn eindringt, in ihn hineinfährt und die Leere, den Zwischenzellraum ausfüllt. Das Böse und das Gute sind von unterschiedlicher Natur, aber die Leere hat nun mal eine Affinität zum Bösen. (Vor kurzem erfuhr die Geschichte der Olja M. eine Fortsetzung. Ihr Mann, der Trinker, kam ins Krankenhaus. Er hatte eine Schnittwunde am Bauch mit Verletzung des Dünndarms und einer Iliakalarterie. Er behauptet, seine Hand sei vom Fleischwolf abgerutscht, er sei gegen den Tisch geprallt, auf dem ein Messer lag und so weiter).
Es gibt auch weniger schwere Begegnungen. In der Stadt N. geht man sehr viel besser als in Moskau mit Menschen um, deren Überleben gefährdet ist, insbesondere mit Obdachlosen. Vor kurzem fuhr der Krankenwagen bei bitterem Frost los, um eine „kriminelle Leiche“ zu holen. „Es sieht so aus, als wäre Sascha Terechow endlich entschlafen“, so drückte es die Arzthelferin aus. Während sie unterwegs waren, setzte sich der lebende Leichnam in ein Taxi, erschien im Krankenhaus und täuschte Atemnot vor. Er kam in das „soziale Bett“, am nächsten Morgen war er verschwunden. Ein anderer Obdachloser, einer der längst russifizierten Deutschen, mit schwerer Aorteninsuffizienz, wohnt schon seit drei Monaten im Krankenhaus, weil man ihn nirgendwohin entlassen kann. Äußerlich hat er sich aus einem Penner und Alkoholiker in einen anständig aussehenden Mann verwandelt, der nicht trinkt, mit Bärtchen und Stock. In dieser Zeit kam seine Exfrau ins Krankenhaus, er bat, sie möglichst lange dazubehalten: Ihre (gemeinsamen) kleinen Kinder kamen zu Besuch. Er nahm siebzig Rubel für einen Umschlag, er will nach Deutschland schreiben, schließlich ist er ein Deutscher und weiß, an wen er schreiben muss.
In einigen Moskauer Krankenhäusern geht man folgendermaßen vor: Nach drei Tagen im Krankenhaus werden die Landstreicher in einen Bus gesetzt und möglichst weit entfernt vom Krankenhaus ausgesetzt, es gibt tatsächlich Mitarbeiter, die dafür verantwortlich sind.
Auch das Lustige bleibt, obwohl es weniger auffällt, weil es sich wiederholt. Neulich brachte mir eine Patientin als Geschenk ein Dreiliterglas Gurken, sie preist die Gürkchen an, ich bedanke mich bei ihr. Auf einmal fragt sie nach: „Maxim Alexandrowitsch, und wie machen wir es mit dem Glas?“
Aktives, bewusstes Böses sehe ich überhaupt nicht, nur die Leere. Auf dem Krankenhausklo liegen Bruchstücke eines Kreuzworträtsels (Patienten wie Mitarbeiter lösen viele solcher Rätsel): „erbärmliche Menschen“, Wort mit vier Buchstaben. Eine Frau hatte ordentlich eingetragen: VOLK (die Autoren des Kreuzworträtsels meinten eigentlich: „Pack“). Ich habe dieses Wort immer gemieden, noch vor der Ankunft in N., doch ich habe mich in vieler Hinsicht stark getäuscht. (Brodsky über Solschenizyn: „Er dachte, der Grund ist der Kommunismus. Er versteht nicht, dass der Grund der Mensch ist.“) Man kann das sogenannte „Volk“ nicht wie kleine Kinder behandeln: in der Mehrheit sind das erwachsene, verantwortliche Menschen. Jedenfalls habe ich bei näherer Bekanntschaft mit ihm keinerlei Gefühl des Verlustes oder nicht verwirklichter Möglichkeiten gefunden. Sie sind wirklich bereit, fünfzig, sechzig Jahre zu leben – also kürzer als im Westen –, die Brücke „war nicht da, und wir brauchen auch keine“, sie ziehen wirklich die billige Popmusik Beethoven vor: Zu dem von uns organsierten Benefizkonzert kamen fast ausschließlich Datschniki. (Apropos: Der Hass auf die klassische Musik – trotz ihrer riesigen Erfolge – ist ein unerklärliches Phänomen. Meinem Bekannten, einem Musiker, der in die Psychiatrie musste, erlaubte man nicht, seinen Plattenspieler zu benutzen – er sollte keine klassische Musik hören, da die selbst schizophren sei. Den anderen Patienten erlaubte man es, weil sie „normale“ Musik hörten, sprich: Humtata-Humtata.) Die aktuellste Erzählung Tschechows ist trotzdem „Das neue Landhaus“ und nicht „In der Schlucht“. Da wählen die Leute aus ihrer Mitte – unter den Bedingungen ganz realer Autonomie – die Lytschkows.
DIE OBRIGKEIT (die, zu denen man nicht „nein“ sagen kann).
Ein einfacher Sowjetmensch und ein einfacher sowjetischer Sekretär der Kreisleitung, das waren sehr verschiedene Leute. Dieser Unterschied gilt noch jetzt. Lytschkow, der alle fertigmacht, die ihn stören, und auch noch legal gewählt ist, ist natürlich sehr dumm nach den Maßstäben eines Intellektuellen (was sollte es sonst für Maßstäbe geben?), aber er hat ein feines Gespür. Ich rede mit ihm, doch in meinen Augen steht geschrieben: „Ich brauche deine Unterschrift so dringend, dass ich sogar bereit bin, mit dir einen zu trinken.“ Er hat nichts dagegen, einen zu trinken, aber nicht unter diesen Bedingungen.
Mit der Obrigkeit sind viele Geschichten verknüpft, keine ist erfreulich, zwei wunderten mich. Die erste: Ich bat eine große westliche Firma, mir eine Rechnung über einen CT-Scanner auszustellen (Förderer hatten versprochen, ihn zu bezahlen), und zwar zu seinem echten Preis – für eine halbe Million und nicht für eine Million Dollar, ohne Schmiergeld. Sie redeten lange auf mich ein: Mit der Differenz können Sie noch andere Apparate kaufen (hm, ja, und die bringen ebenfalls Schmiergeld und so weiter bis zu Kopfkissenbezügen und chirurgischen Nadeln). Deshalb ist im Russischen das äußerst dehnbare Verb durchölen aufgetaucht, das heißt, für alles und jeden Geldaufschläge zahlen. Dann kam heraus, dass man den CT-Scanner ohne Schmiergeld nicht kaufen kann: Die Obrigkeit stünde in einem schlechten Licht da. Obwohl man bei Rot nicht fahren darf, ist das also die einzige Möglichkeit, ans Ziel zu kommen.
Die zweite Geschichte passierte, als ich mir bekannte einflussreiche Ärzte bat, mich vor der Obrigkeit in Schutz zu nehmen. „Kein Problem. Sag, wen wir anrufen sollen, wir regeln alles.“ Ich frage, wie. „Ehrlich gesagt, wir drohen normalerweise mit einer physischen Strafaktion“ (mithilfe früher einmal kurierter Banditen). Ich drossele schnell das Gespräch und schneide ein neues an: über Infarkte, Schlaganfälle und andere liebe Dinge.
All das bekümmerte mich stark, aber dann sah ich das Problem mit anderen Augen. Die Schwierigkeit ist nicht, dass „man in diesem Land nichts machen kann“ (schließlich hat man dort eine Revolution machen können), sondern dass meine Sprache ihnen genauso unverständlich ist wie mir die ihre. „Patient, was heißt, Schuster, bleib bei deinen Leisten?“ „Ich bin gar kein Schuster“, das ist aus dem Lehrbuch für Psychiatrie. So halten wir es auch mit der Obrigkeit. „Sie sind doch ein Staatsmann“, sage ich zu einem großen Bonzen. Antwortet der doch: „Staat – das ist ein relativer Begriff.“
Da gibt es zwei Wege. Der erste: eine neue Sprache lernen, was schwierig ist und wozu ich keine Lust habe, zumal sie meiner Muttersprache so ähnlich ist, dass man womöglich alles durcheinanderbringt. Da gibt es nicht nur „ich werde Sie anrufen“, „Bleiben Sie bitte in der Leitung“, „das kostet zu viel“, „zum Erfolg verurteilt“, „das wird nachgefragt“, „keine Rechtsgrundlage“, „schlechte Ökologie“, „Unterfinanzierung“, „Realisierung von nationalen Projekten“ – es geht um ein System von Begriffen und die Arten des Beweises. Was ich sage, hat absolut nichts mit dem zu tun, was ich als Antwort zu hören bekomme. Die Obrigkeit hat denselben Eindruck, denke ich. Der zweite Weg – nacheinander auf alle Knöpfe drücken wie bei einem unbekannten Computerprogramm, das ist häufig erfolgversprechend. Also machen wir das.
März 2007
Es könnte schlimmer sein
„Arbeit, wie auch Liebe, davon kann man nicht genug kriegen“, sagte Vater Ilja Schmain einmal, der ebenfalls in unserer Stadt lebte (und diente). „Nun los, versuchen wir’s: das Steuer linkisch wenden / Wir um, und mag’s auch knirschen sehr!“
Ein weiteres halbes Jahr ist vergangen, vieles hat sich äußerlich zum Besseren verändert, aber die Verzweiflung überkommt einen zeitweise mit der früheren Wucht: Wenn es nur um die Verpflanzung neuer Organe, ein künstliches Herz oder eine andere Revolution in der Medizin ginge, aber nein, es geht um gewöhnliche Dinge, die mit schrecklicher Mühe und durch Zufall gelingen. „O, Lord, deliver me from the man of excellent intentions and impure heart“, könnten unsere Feinde sagen, wenn sie Eliots „Die hohlen Männer“ gelesen hätten. Ich verstehe: Sie haben auf die Schwätzer mit unreinen Händen und Absichten gehört. Der Tatkräftige ist verdächtig, den mitfühlenden Beobachter kann man entschieden besser verstehen.
Aber der Traum zeigte Wirkung. Durch ihn, nur durch den Traum bekommen wir Apparate und Medikamente und anderes für die Arbeit Notwendige. Die Freundschaft – ein nur in diesem Sinn russisches Phänomen der Intelligenz – funktioniert, und jetzt haben wir fast alles, um zurechtzukommen. Also versuchen wir’s.