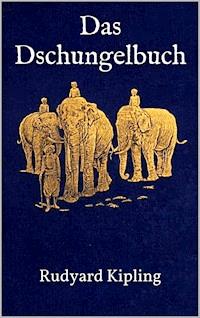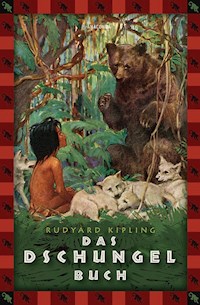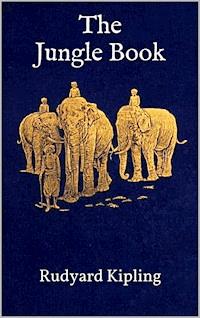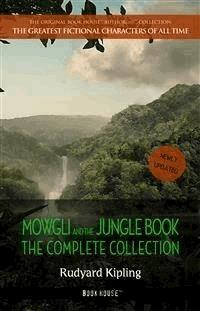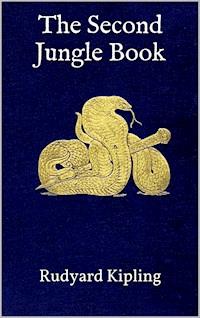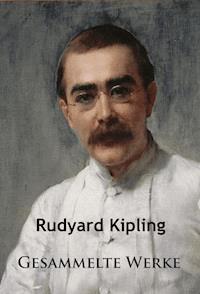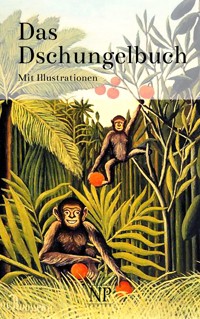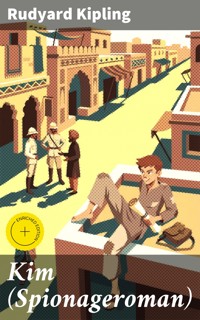
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In "Kim" entfaltet Rudyard Kipling ein facettenreiches Porträt des britisch-indischen Lebens im späten 19. Jahrhundert. Der Roman folgt dem Waisenjungen Kimball O'Hara, der als Hindu-Tempel-Knecht in Lahore aufwächst und in die intriganten Machenschaften des britischen Geheimdienstes verwickelt wird. Kipling gelingt es, mit seinem meisterhaften Erzählstil die kulturelle Vielfalt und die politischen Spannungen der damaligen Zeit einzufangen. Durch die geschickte Vermischung von Abenteuer, Spiritualität und dem Spiel von Loyalitäten erzeugt der Roman eine spannende Erzählung, die sowohl als Bildungsreise als auch als Spionagegeschichte fungiert. Rudyard Kipling, ein faszinierender Schriftsteller des Viktorianischen Zeitalters, verbrachte einen Teil seiner Kindheit in Indien, was seine tiefe Verbundenheit mit der Region und deren Menschen prägte. Seine Erfahrungen als Journalist und die komplexen geopolitischen Verhältnisse seiner Zeit flossen in die Schaffung von "Kim" ein, das nicht nur auf die britische Kolonialpolitik eingeht, sondern auch auf die tiefere Menschlichkeit der Charaktere und deren interkulturellen Dialog. Kiplings Scharfsinn für Sprache und Metaphern macht diese Erzählung zu einer einzigartigen literarischen Erfahrung. "Kim" ist ein zeitloses Meisterwerk, das Leser auf eine fesselnde Erkundungsreise durch Indien und die Intrigen eines Spionagenetzwerks mitnimmt. Es ist nicht nur eine spannende Lektüre für Geschichtsinteressierte und Liebhaber von Abenteuerromanen, sondern bietet auch tiefere Einblicke in die Philosophie von Identität und Zugehörigkeit. Dieses Buch sollte auf der Liste jedes Literaturbegeisterten stehen, der die Feinheiten der menschlichen Natur und die Komplexität kultureller Begegnungen verstehen möchte. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Eine prägnante Einführung verortet die zeitlose Anziehungskraft und Themen des Werkes. - Die Synopsis skizziert die Haupthandlung und hebt wichtige Entwicklungen hervor, ohne entscheidende Wendungen zu verraten. - Ein ausführlicher historischer Kontext versetzt Sie in die Ereignisse und Einflüsse der Epoche, die das Schreiben geprägt haben. - Eine Autorenbiografie beleuchtet wichtige Stationen im Leben des Autors und vermittelt die persönlichen Einsichten hinter dem Text. - Eine gründliche Analyse seziert Symbole, Motive und Charakterentwicklungen, um tiefere Bedeutungen offenzulegen. - Reflexionsfragen laden Sie dazu ein, sich persönlich mit den Botschaften des Werkes auseinanderzusetzen und sie mit dem modernen Leben in Verbindung zu bringen. - Sorgfältig ausgewählte unvergessliche Zitate heben Momente literarischer Brillanz hervor. - Interaktive Fußnoten erklären ungewöhnliche Referenzen, historische Anspielungen und veraltete Ausdrücke für eine mühelose, besser informierte Lektüre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Kim (Spionageroman)
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Identität ist Tarnung und Prüfung zugleich. Kims Weg durch das koloniale Indien entfaltet sich als Abenteuer, das immer auch ein Spiel um Zugehörigkeit ist. Die Räume der Straße, der Bahn und der Gebirgswege werden zu Bühnen, auf denen Herkunft, Sprache und Loyalität verhandelt werden. In Rudyard Kiplings Roman verschränken sich die neugierigen Augen eines Jungen mit den unsichtbaren Blicken derjenigen, die Grenzen überwachen. Der Leser betritt ein Geflecht aus Begegnungen, Zeichen und Botschaften, in dem jeder Schritt Bedeutung annehmen kann. So beginnt eine Erzählung, die Spannung mit der Suche nach einem eigenen Ort verbindet.
Kim gilt als Klassiker, weil er die Energie des Abenteuerromans mit der Feinheit ethnografischer Beobachtung verbindet. Das Werk zeigt eine Welt in Bewegung: Händler und Heilige, Soldaten und Spione kreuzen Wege, Sprachen mischen sich, Landschaften wechseln in rascher Folge. Kipling komponiert daraus ein Panorama, das Lesende mitreißt und zugleich zur Betrachtung einlädt. Der Roman hat das Bild des Spionagegenres früh geprägt, indem er nicht nur die Handlung, sondern auch das Handwerk der Wahrnehmung in den Mittelpunkt stellt. So entsteht ein vielschichtiges Buch, dessen Spannung aus Charakter, Milieu und moralischer Ambivalenz zugleich erwächst.
Rudyard Kipling (1865–1936), in Britisch-Indien geboren und später in England lebend, veröffentlichte Kim 1901 erstmals als Buch. Das Werk entstand in der Hochphase des Britischen Empire und reflektiert dessen Selbstverständnis ebenso wie seine Widersprüche. Kiplings genaue Kenntnis der Orte, Dialekte und Alltagsrituale verleiht dem Roman eine besondere Anschaulichkeit. Zugleich zeigt sich hier ein Autor auf der Höhe seiner erzählerischen Mittel, der kurze Episoden und große Bögen sicher verbindet. Kiplings spätere Auszeichnung mit dem Literaturnobelpreis im Jahr 1907 unterstreicht seine literarische Bedeutung, auch wenn Kim bereits zuvor als herausragende Leistung galt.
Die Handlung setzt im späten 19. Jahrhundert in Lahore ein. Kimball O’Hara, ein irischer Waisenjunge, bewegt sich mit lässiger Gewandtheit durch die Gassen, Märkte und Höfe der Stadt. Er begegnet einem buddhistischen Lama, dessen spirituelle Suche ihn fasziniert. Diese ungleiche Partnerschaft eröffnet Kim neue Wege, geografisch wie geistig. Gleichzeitig kreuzen ihn Kräfte, die im Schatten agieren: Nachrichten, Embleme und Aufträge zirkulieren zwischen Militärposten, Missionen und Karawanen. Aus Kims Beweglichkeit erwächst ein Talent, das ihn in die Nähe jener bringt, die Information zur Waffe machen. Mehr sei hier nicht vorweggenommen.
Kim ist damit zugleich Bildungsroman, Reiseroman und Spionagegeschichte. Die Stationen der Reise sind Prüfsteine, an denen der Protagonist Rollen erprobt und Regeln durchschaut. Selbstbeobachtung und scharfes Hören werden zu Fähigkeiten, die über das Vorankommen entscheiden. Das Werk stellt Fragen nach Herkunft und Wahlverwandtschaft: Was bedeutet es, mehrere Sprachen zu sprechen und mehreren Welten anzugehören. Wo endet Neugier, wo beginnt Loyalität. Die Balance zwischen Schicksal und Selbstbestimmung bildet den inneren Motor des Romans und macht seine Figur zu mehr als einem Abenteurer im klassischen Sinn.
Literarisch überzeugt der Roman durch eine montageartige Struktur, die Szenen des Alltags mit Passagen des Geheimdienstes verschränkt. Das Erzählen bleibt nah an der Straße, an Zügen, Karawanen und Rastplätzen, und wechselt doch mühelos in die Perspektive verwickelter Netze. Diese Beweglichkeit ermöglicht es, Spannung ohne bloße Effekte aufzubauen. Die Episoden formen sich zu einem Rhythmus aus Beobachtung, Entscheidung und Wandel. So entsteht ein Werk, das die Lust am Unterwegssein mit der Kunst der Fokussierung verbindet. Der Leser folgt keinem starren Plot, sondern einem organischen Strom aus Begegnungen, Signalen und Konsequenzen.
Sprachlich beeindruckt Kim durch sinnliche Dichte und klangliche Varianz. Kipling integriert unterschiedliche Register, lässt Fachausdrücke, Straßenjargon und religiöse Begriffe aufeinanderprallen, ohne den Fluss zu bremsen. Die Vielfalt der Stimmen spiegelt die Vielfalt der Gesellschaft, die der Roman zeigt. Landschaften werden nicht als Kulisse, sondern als aktive Partner der Handlung gezeichnet: Gebirge, Flüsse, Städte formen Wahrnehmung und Entscheidung. Diese stilistische Vielstimmigkeit trägt wesentlich zur Langlebigkeit des Buches bei, denn sie erlaubt immer neue Lektüren – als Spiegel kolonialer Strukturen, als Sprachabenteuer oder als Studie über Aufmerksamkeit.
Historisch steht der Roman im Zeichen des sogenannten Great Game, der Rivalität der Großmächte in Zentral- und Südasien. Das koloniale Indien wird als Kreuzungspunkt politischer Interessen sichtbar, wo Armeen, Verwaltung, Händler und Pilger die gleichen Wege nutzen. Die Infrastruktur der Zeit – Bahnlinien, Postwege, Telegraphie – verbindet und überwacht zugleich. Indem Kipling diese Netzwerke erzählt, macht er begreifbar, wie Macht und Mobilität einander bedingen. Der Roman verzichtet dabei auf Lehrhaftigkeit; die politischen Linien erscheinen in den Entscheidungen und Beobachtungen der Figuren, nicht in erklärenden Exkursen. So bleibt die Geschichte lebendig und anschaulich.
Als früher Beitrag zur Spionageliteratur hat Kim bleibenden Einfluss ausgeübt. Er demonstriert, dass Geheimdienstgeschichten nicht nur auf Täuschung, sondern auf kompetente Wahrnehmung und kulturelles Verständnis gründen. Später populäre Motive – verdeckte Identitäten, Botschaften im Alltag, das Nebeneinander privater und geopolitischer Interessen – werden hier in prägnanter Form erprobt. Der Roman erweiterte damit das Genre um eine ethnografische und psychologische Dimension. Seine Verbindung aus Abenteuer und Analyse hat Maßstäbe gesetzt, an denen sich nachfolgende Erzählungen über Agenten, Grenzgänger und Reisende messen lassen.
Gleichzeitig lädt Kim zur kritischen Lektüre ein. Die koloniale Perspektive, aus der der Text hervorgeht, ist nicht zu übersehen und wurde vielfach diskutiert. Der Roman zeigt Bewunderung für Vielsprachigkeit und religiöse Praxis, bewegt sich aber in Machtverhältnissen, die er nicht auflöst. Gerade diese Spannung macht seine heutige Lektüre produktiv: Sie eröffnet Räume für Fragen nach Repräsentation, Blickregime und Verantwortung. Wer den Text aufmerksam liest, erkennt beides – die erzählerische Virtuosität und die historischen Begrenzungen –, und kann daraus ein differenziertes Verständnis von Literatur und Geschichte gewinnen.
Warum also heute Kim lesen. Weil der Roman zeigt, wie Mobilität Identitäten formt, lange bevor Globalisierung ein Schlagwort wurde. Weil er die Kunst der Beobachtung lehrt: das Hören auf Zwischentöne, das Lesen von Gesten, das Erkennen von Rollen. Weil er zeigt, wie persönliche Wünsche mit größeren Strukturen verwoben sind. Themen wie Grenzziehung, Überwachung, kulturelle Übersetzung und Zugehörigkeit bleiben aktuell. In Kims Welt spiegeln sich Debatten unserer Zeit über Migration, Loyalität und Selbstbestimmung, ohne dass der Text seine historische Eigenart verliert. Diese doppelte Perspektive verleiht ihm gegenwärtige Kraft.
Kim ist ein Klassiker, weil er das Zeitgebundene in zeitlose Form bringt. Die erzählerische Ökonomie, die Genauigkeit der Beobachtung und die lebendige Figurenzeichnung tragen über Konjunkturen hinweg. Das Buch verbindet die Freude am Erzählen mit einem Gespür für Ambivalenz. Es lädt zur Wiederlektüre ein, weil es mit jeder Rückkehr neue Facetten offenbart – in Sprache, Struktur und Blick. Wer sich auf diese Reise einlässt, erhält nicht nur Spannung, sondern auch ein Instrumentarium, die Welt aufmerksamer zu sehen. So bleibt Kim weit mehr als ein historischer Roman: Er ist Schule der Wahrnehmung und Prüfung der Haltung.
Synopsis
Kim, 1901 von Rudyard Kipling veröffentlicht, spielt im späten 19. Jahrhundert im von Großbritannien beherrschten Indien. Im Mittelpunkt steht Kimball O’Hara, ein in Lahore aufgewachsener irischer Waisenjunge mit außergewöhnlicher Beobachtungsgabe und Wandlungsfähigkeit. Der Roman verbindet Spionagehandlung, Reiseerzählung und Bildungsroman und zeichnet ein Panorama von Sprachen, Religionen und sozialen Schichten. Kiplings Geschichte setzt am Schnittpunkt von Alltagsleben und Geopolitik an und führt in die Welt des sogenannten Great Game, des Rivalitätskampfs zwischen Imperien in Zentral- und Südasien. Zugleich legt der Text eine persönliche Entwicklungsreise an, in der Identität, Zugehörigkeit und moralische Orientierung gegen wechselnde Loyalitäten und praktische Notwendigkeiten abgewogen werden.
Zu Beginn lernt der Leser Kim als Straßenkind kennen, das sich in den Gassen, Basaren und Karawanserais Lahores frei bewegt. Seine Herkunft ist mehrdeutig, seine Sprachen sind gemischt, und sein Vorteil liegt in der Fähigkeit, Rollen zu wechseln. Eine zufällige Begegnung führt ihn zu einem buddhistischen Lama aus Tibet, der nach einem mythischen Fluss der Reinigung sucht. Kim schließt sich ihm als Begleiter und Schüler an, zunächst aus Neugier und Spieltrieb. Damit wird eine Doppelbewegung vorbereitet: eine spirituelle Pilgerschaft, die innere Klarheit verspricht, und ein Weg in weltliche Intrigen, auf dem Kims Geschick für Tarnung und Botschaften Aufmerksamkeit erregt.
Auf dem Grand Trunk Road öffnet die Reise einen Querschnitt durch das Land: Händler, Soldaten, Pilger, Beamte und Bettler begegnen einander, und Kim lernt, wie Informationen umlaufen und wie kleinste Gesten Bedeutung tragen. Über den Pferdehändler Mahbub Ali, der in vertraulichen Kreisen verkehrt, erhält Kim eine erste Gelegenheit, eine heikle Nachricht weiterzugeben. Was als Botendienst beginnt, wird zum vorsichtigen Einstieg in nachrichtendienstliche Netzwerke. Der Lama bleibt dabei Richtschnur und Gegenpol: Sein stilles Ziel, den Fluss zu finden und Erkenntnis zu erlangen, steht Kims wachsenden Kontakten zur kolonialen Verwaltung und deren Interesse an Karten, Pässen und verlässlichen Kundschaftern gegenüber.
Als Kims europäische Abstammung erkannt wird, beansprucht die britische Seite ihn und weist ihn einer angloindischen Erziehung zu. Er kommt auf eine Missions- und später auf eine renommierte Schule in Nordindien, wo Disziplin, Mathematik, Vermessungskunde und Sprachen seine Talente ordnen sollen. Offiziere und zivile Experten, die um seine Fähigkeiten wissen, erkennen in ihm einen künftigen Aufklärer. Gleichzeitig bleibt der Lama präsent und fordert Treue und Einfachheit ein. Kims Alltag spaltet sich: formale Bildung und subtile Schulung in Beobachtung, Gedächtnis und Verstellung auf der einen, Pilgerwege und Gespräche über Leiden, Erlösung und Selbstüberwindung auf der anderen Seite.
In den Ferien knüpft Kim seine Verbindung zum Lama erneut und führt zugleich kleinere Aufträge aus, die seine Zuverlässigkeit und Wachsamkeit prüfen. Er übt das Lesen von Zeichen, das Erstellen unauffälliger Skizzen und das Führen mehrerer Identitäten, ohne dabei seine jugendliche Spontaneität zu verlieren. Der Gelehrte Hurree Chunder Mookerjee, ein kluger, vorsichtiger Babu, tritt als Verbündeter auf und vermittelt zwischen akademischer Neugier und praktischem Geheimdienstwissen. Lurgan Sahib, ein Händler mit Sinn für psychologisches Training, schärft Kims Sinne für Täuschungen. So wächst eine Profession heran, die auf Geduld, Improvisation und das Verständnis für Menschen und Landschaften gleichermaßen setzt.
Ein größerer Auftrag führt Kim in den Norden, wo Gebirge, Pässe und Grenzlinien Karten und Machtfragen neu definieren. Offiziell begleitet er den Lama und hilft bei dessen Weg, inoffiziell sammelt er Notizen, beobachtet Bewegungen und prüft Hinweise auf fremde Aktivitäten. Das Ringen der Imperien, im Roman oft indirekt geschildert, verdichtet sich in Spuren, Instrumenten und Messpunkten. Kim bewegt sich als Vermittler zwischen Welten: zwischen Klöstern und Vermessern, Karawanen und Expeditionsgruppen, lokalen Fürsten und europäischen Abenteurern. Damit verschärft sich auch sein innerer Konflikt: Soll er sich einer Sache verschreiben, oder kann er beweglich bleiben, ohne sich zu verlieren?
In den Hügeln kulminieren die Spannungen in einer Begegnung mit gegnerischen Agenten, die die Fragilität der Ordnung sichtbar macht. Beobachtungsgabe, Mut und die Fähigkeit, Situationen zu deeskalieren oder zu wenden, werden auf die Probe gestellt. Das Geschehen bringt riskante Augenblicke, in denen Kims Rollen ineinander greifen und der Lama als unerwartete moralische Instanz erscheint. Die Konfrontation bleibt frei von pathetischem Triumph; sie akzentuiert vielmehr, wie nahe List und Verletzlichkeit beieinander liegen. Ohne die genauen Abläufe vorwegzunehmen, lässt sich sagen, dass dieses Kapitel Kims Selbstverständnis verändert und die Grenzen zwischen Dienst, Freundschaft und persönlichem Gelübde neu absteckt.
Die Folgen des Vorfalls hallen nach, während der Lama seinem Ziel näher zu kommen scheint und Kim über Zukunft und Zugehörigkeit nachdenkt. Mentoren und Weggefährten bieten unterschiedliche Deutungen an: Pflichtgefühl, Karriere, Erkenntnis, Freiheit. Kims Körper und Geist sind erschöpft, doch sein Blick ist geschärft für das, was ihn ausmacht. Die Frage, ob die Suche nach innerem Frieden mit den Anforderungen einer weltlichen Mission vereinbar ist, wird nicht mit einer einzigen Geste gelöst. Stattdessen führt der Roman seine Linien behutsam zusammen und belässt Raum für die Vorstellung, dass Reife auch in der Annahme von Widersprüchen liegen kann.
Als Spionage- und Bildungsroman bleibt Kim wegen seiner dichten Schilderung kolonialer Räume, Sprachen und Glaubenswelten bedeutend. Kipling entwirft eine bewegliche Figur, deren Mehrsprachigkeit und kulturelle Gewandtheit Bewunderung wecken und zugleich Debatten über Loyalität, Macht und Blickregime eröffnen. Das Buch prägt die populäre Vorstellung vom Great Game, ohne dessen Ambivalenzen zu verdecken: Wissen und Kontrolle stehen neben Neugier, Freundschaft und Respekt. Die nachhaltige Botschaft zeigt sich in der Spannung zwischen Weltklugheit und spiritueller Sehnsucht. Sie lädt dazu ein, Identität nicht als feste Zugehörigkeit, sondern als bewusste, verantwortete Bewegung durch verschiedene Gemeinschaften zu begreifen.
Historischer Kontext
Kim spielt vor dem Hintergrund des späten 19. Jahrhunderts in Britisch-Indien, vor allem in Punjab und entlang der großen Verkehrsachsen Nordindiens. Nach dem Aufstand von 1857 war die Ostindien-Kompanie entmachtet; seit 1858 regierte die Krone über den Vizekönig. Dominante Institutionen prägten den Alltag: der Indian Civil Service (ICS) als Verwaltungselite, die britisch-indische Armee als Ordnungsmacht, Justiz und Polizei, Eisenbahn- und Telegrafennetze als infrastrukturelles Rückgrat. In diesem Gefüge bewegen sich Reisende, Händler, Pilger und Beamte. Kims Weg führt durch diese institutionell verdichtete Welt, deren Hierarchien und Kommunikationsmittel die Handlung überhaupt erst ermöglichen und strukturieren.
Die Nachkriegsordnung nach 1857 brachte Zentralisierung und Standardisierung. Die Königinnen-Proklamation von 1858 versprach Schutz von Religion und Eigentum, während Verwaltung und Militär neu organisiert wurden. Britische Beamte überwachten Provinzen und Fürstenstaaten, unterstützt von einheimischen Eliten und lokalen Honoratioren. Militärisch verließ man sich stärker auf regimentsweise Rekrutierung aus bestimmten Regionen. Dieses System schuf ein dichtes Netz aus Kontrolle, Loyalitäten und Patronage, in dem Informationen und Bewegungen genau beobachtet wurden. Kim spiegelt diese kontrollierte Offenheit: Mobilität ist möglich, aber sie geschieht unter den Augen staatlicher und militärischer Institutionen.
Punjab, Schauplatz zentraler Episoden, war erst 1849 nach den Sikh-Kriegen annektiert und galt den Briten als strategische Kernregion. Lahore, Verwaltungssitz und Handelszentrum, wurde zu einer kosmopolitischen Stadt mit Kasernen, Gerichten, Schulen und dem Museum, das im Roman als „Wunderhaus“ erscheint. Der gewaltige Zam-Zammah-Kanonenbrunnen vor dem Museum war realer Bezugspunkt städtischer Öffentlichkeit. Die britische Provinzverwaltung förderte Infrastruktur, Irrigation und Handel. Diese Verdichtung kolonialer Präsenz machte Punjab zu einem Knotenpunkt von Militär, Verwaltung und Wissen – genau dem Geflecht, das Kims Wanderungen ständig kreuzt.
Ein wesentliches Bindemittel dieser Ordnung waren Eisenbahn und Telegraf. Seit den 1850er Jahren wuchs das Schienennetz rasant und umfasste um 1900 Zehntausende Kilometer. Die Bahn verband Häfen, Garnisonen, Provinzhauptstädte und Grenzposten; mit ihr reisten Waren, Truppen und Nachrichten. Der Telegraf, parallel ausgebaut, erlaubte schnelle Kommandowege und koordinierte Verwaltung und Sicherheit. Fahrkarten, Fahrpläne und die standardisierte Zeit prägten zudem das Alltagsleben. Kim nutzt diese Verkehrsmittel, und die Geschwindigkeit, mit der Personen und Informationen zirkulieren, ist selbst Teil der Spannung: Macht wirkt über Netze, aber Netze eröffnen Schlupflöcher.
Über allem lag die Rivalität zwischen Großbritannien und Russland in Zentralasien – das, was im 19. Jahrhundert als „Great Game“ bezeichnet wurde. Russlands Expansion in Turkestan, britische Interessen in Afghanistan und am Himalaya, Zwischenfälle wie die Panjdeh-Krise von 1885 und Grenzziehungen wie die Durand-Linie von 1893 fütterten Befürchtungen und Planungen. Im Roman erscheinen diese Spannungen als Spionage und Vermessung entlang schwer zugänglicher Pässe. Die politische Geografie war im Fluss, die Karten wurden neu gezeichnet – eine Lage, die Aufmerksamkeit, Verletzlichkeit und Improvisation begünstigte und Kim in den Strudel imperialer Informationspolitik zieht.
Diese geopolitische Lage brachte eine institutionelle Verdichtung von Nachrichtendiensten und „Political“ Arbeit hervor. In den 1870er und 1880er Jahren professionalisierte das britisch-indische Militär seine Informationsbeschaffung; die Intelligence Branch und die Political Department koordinierten Kontakte, Beobachtungen und Grenzmissionen. Die Survey of India stützte diese Arbeit mit topografischen Daten. Lokale Agenten, Übersetzer und Vermittler waren unentbehrlich. Kims Welt zeigt ihre Methoden: Tarnung, Beobachtung, das Sammeln von Gerüchten, die Nutzung von Post- und Unterkünften. Der Roman spiegelt damit, wie informell und zugleich engmaschig diese imperialen Informationsketten funktionierten.
Ein zentraler technologisch-wissenschaftlicher Unterbau war die Vermessung. Die Great Trigonometrical Survey hatte im 19. Jahrhundert den Subkontinent vermessen; daran schlossen sich Grenzaufnahmen und geheime Erkundungen an. So setzten britische Stellen auf „pundits“, indische Vermesser, die verkleidet in Tibet und an der Nordgrenze Wege, Pässe und Entfernungen ermittelten. Diese Verbindung aus Geografie, Mathematik und Diskretion prägt den Ton des Romans. Vermessung ist nicht nur Technik, sondern Herrschaftsmittel: Wer Höhenlinien liest, kontrolliert Bewegungen. Kim verknüpft diese Wissenspraxis mit Erziehung und Loyalität – und zeigt, wie Karten zu Handlungsanweisungen werden.
Die Machtverhältnisse spiegelten sich im saisonalen Regierungskreislauf. Simla (heute Shimla) fungierte seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Sommerhauptstadt des Raj. Ministerien, Stäbe und Akten wanderten im Jahresrhythmus vom heißen Tiefland ins kühle Hügelland. Dieser Ortswechsel schuf eigene sozialen Räume: Clubs, Salons und informelle Gesprächskreise, in denen Entscheidungen vorbereitet wurden. Der Roman greift diese „Hill“-Welt auf: Entfernung von der Ebene bedeutete nicht Distanz zur Macht, sondern deren räumliche Reorganisation. Nachrichten, Boten und Bahnen hielten die Verbindung – die Topografie wurde zum Faktor der Politik.
Parallel dazu institutionalisierten die Briten ein Ethos ethnografischer Verwaltung. Ab 1871 wurden regelmäßige Gesamtzählungen durchgeführt; Provinz-Gazetteers sammelten Daten zu Sprachen, Kasten, Gemeinden und Ökonomien. Im Militär setzte sich die Lehre von „martial races“ durch, die Rekrutierung aus Punjab, den Hügeln und der Nordwestgrenze bevorzugte. Diese Katalogisierung erzeugte Stereotype und Loyalitätsprofile, mit unmittelbaren Folgen für Regimenter und Polizeiarbeit. Kims Begegnungen mit Soldaten und Untertanen der verschiedensten Gemeinschaften spiegeln dieses Raster – das koloniale Auge ordnet, benennt und verteilt Aufgaben, während die Menschen sich durch und gegen diese Schubladen bewegen.
Die Mobilität im Land war zugleich gefördert und reguliert. Die Grand Trunk Road, bereits vor-kolonial bedeutsam, wurde im 19. Jahrhundert ausgebaut; dazu kamen „dak bungalows“ für Reisende sowie ein enges Netz von Poststationen. Diese Einrichtungen ermöglichen Kim und seinem Begleiter sichere Etappen und Informationsaustausch. Gleichzeitig wurden wandernde Gruppen vermehrt überwacht; Gesetze wie der Criminal Tribes Act von 1871 spiegeln Misstrauen gegenüber mobilen Lebensformen. Der Roman thematisiert solche Regulierung nicht systematisch, doch die allgegenwärtige Beobachtung – am Straßenrand, in Herbergen, an Stationen – gehört zum Erfahrungsraum, den er abbildet.
Die religiöse und kulturelle Vielfalt Nordindiens bildete eine vielstimmige Öffentlichkeit. Hindus, Muslime, Sikhs, Christen und Buddhisten teilten Märkte, Pilgerwege und Festtage. In Punjab wirkten Reformbewegungen wie die Arya Samaj (ab 1870er Jahren) und die Singh Sabha unter Sikhs; in Nordindien gewann die Aligarh-Bewegung an Einfluss. Missionarische Einrichtungen betrieben Schulen und Hospitäler. Kim bewegt sich durch diese Landschaft als sprachlich wendiger Vermittler; sein Kontakt mit einem tibetischen Lama betont die alten Pilgertraditionen, die koloniale Grenzen teilweise durchschneiden. Der Roman zeigt so die Koexistenz von imperialen Netzen und vormodernen Routen, die ihre eigene Autorität behaupten.
Bildung war ein zentrales Feld imperialer und indischer Ambitionen. Elitenschulen in Provinzzentren und Hügelstationen schufen zweisprachige Mittler; Universitäten in Kalkutta, Bombay und Madras (gegründet 1857) und später in Punjab erweiterten die Ausbildung. Der Zugang zum ICS erfolgte über eine in London abgelegte Prüfungsordnung, die nur wenige Inder bestanden; weitaus mehr fanden als Übersetzer, Schreiber oder Lehrer Beschäftigung. Der Roman greift diese Schicht in der Figur des gebildeten „Babu“ auf – eine ambivalente Darstellung, die die damaligen Stereotype reproduziert und zugleich die unentbehrliche Rolle dieser Zwischenakteure im Informationsbetrieb sichtbar macht.
Wirtschaftlich transformierten Eisenbahn, Kanäle und neue Marktverbindungen den Norden. In Punjab entstanden seit den 1880er Jahren große Bewässerungsprojekte und „Kanal-Kolonien“, die Migration, Agrarproduktion und Steueraufkommen veränderten. Städte wie Lahore, Amritsar und Peshawar profitierten von Handel und Militärpräsenz, litten aber auch unter Preisschwankungen und Seuchen. Der Roman verweilt selten bei Agrarpolitik, doch die Dichte von Stationen, Märkten und Handwerksvierteln, durch die Kim streift, ist Produkt dieser Modernisierungsschübe. Infrastruktur schichtet Räume neu: Das alte Wegenetz bleibt, aber Schienen, Kanäle und Verwaltungsgrenzen überlagern es mit neuen Logiken.
Die Nordwestgrenze blieb Brennpunkt der Sicherheitsstrategie. Stämme jenseits fester Verwaltung, Durchgänge nach Afghanistan und das schwierige Terrain führten zu speziellen Regelungen, aus denen später die Frontier Crimes Regulation und 1901 die Schaffung der North-West Frontier Province hervorgingen. In den 1890er Jahren kam es wiederholt zu Unruhen und Feldzügen, die britische Garnisonen beschäftigten. Kims Episoden im Hügelland und seine Begegnungen mit Grenzbeamten und Pfadkundigen reflektieren diese angespannte Randlage: Hier verschränken sich Kartierung, Tribaldiplomatie und die Sorge vor fremden Einflüssen zu einem Alltag permanenter Wachsamkeit.
Wissen und Sammeln stützten die koloniale Selbstbeschreibung. Die 1861 gegründete Archaeological Survey of India inventarisierte Monumente; Museen in Kalkutta, Lahore und anderen Städten ordneten Kunsthandwerk, Artefakte und „Völkerkunde“. John Lockwood Kipling, der Vater des Autors, war Kurator des Lahore Museum – ein Umstand, der den Romananfang im „Wunderhaus“ besonders greifbar macht. Das Museum steht für eine Verwaltung, die sehen, klassifizieren und bewahren will. Kim registriert diese Schaulust und richtet zugleich den Blick auf das, was sich den Vitrinen entzieht: gelebte Religion, Geheimwissen unterwegs, die Bewegungen derer, die nicht katalogisiert sein wollen.
Rudyard Kipling kannte diese Welt aus nächster Nähe. 1865 in Bombay geboren, wuchs er in Indien und England auf und arbeitete ab den 1880er Jahren als Journalist in Lahore und Allahabad. Reportagen, Reisen mit Bahn und Postkutsche sowie Kontakte zu Militärs und Verwaltungsleuten prägten seine Beobachtungsgabe. Die genauen Orts- und Milieukenntnisse in Kim – vom Clubwesen in den Hügeln bis zu Bazaren und Bahnhöfen – lassen sich aus dieser beruflichen Sozialisation erklären. Zugleich teilte Kipling viele Annahmen seiner Zeit: Vertrauen in Technik, Skepsis gegenüber Nationalismus und die Überzeugung von einer zivilisierenden Mission des Empire.
Als Kim 1901 erstmals als Buch erschien, befand sich das Empire auf einem Höhepunkt institutioneller Selbstsicherheit, doch neue Kräfte traten hervor. Der Indian National Congress, 1885 gegründet, artikulierte vermehrt Forderungen nach Teilhabe und Reformen. Presse und Vereine schufen eine indische Öffentlichkeit, die koloniale Politik kritisch begleitete. Kim steht genau zwischen diesen Momenten: Er feiert Effizienz und Reichweite imperialer Netze und zeichnet zugleich eine vielsprachige, eigenwillige Gesellschaft. Der Roman kommentiert seine Zeit, indem er die Attraktivität von Bewegung, Wissen und Loyalität vorführt – und damit die Logik des Raj bestätigt, ohne seine Widersprüche zu verbergen.
Autorenbiografie
Rudyard Kipling (1865–1936) war einer der bekanntesten englischsprachigen Autoren der späten viktorianischen und edwardianischen Epoche. Als Lyriker, Erzähler und Kinderbuchautor prägte er die Vorstellung vom britischen Empire ebenso wie die moderne Kurzgeschichte. Seine Arbeiten verbanden erzählerische Präzision, Umgangssprache und balladenhafte Rhythmik mit technischer und kolonialer Stofflichkeit. 1907 erhielt er als erster Autor der englischen Sprache den Literaturnobelpreis, was seine internationale Stellung festigte. Zugleich lösten seine imperial geprägten Texte Bewunderung und Widerspruch aus, eine Spannung, die seine Rezeption bis heute bestimmt. Kiplings Werk bleibt ein Prüfstein für Stilkunst, populäre Mythopoetik und politische Deutung.
Geboren in Bombay im damaligen Britisch-Indien, verbrachte Kipling frühe Jahre zwischen Subkontinent und Großbritannien. Seine Schulbildung erhielt er am United Services College im norddevonischen Westward Ho!, einer Ausbildung, die Disziplin und Kameradschaftsideale betonte und später in Stalky & Co. literarisch nachhallte. In den mittleren 1880er‑Jahren kehrte er als junger Journalist nach Indien zurück und arbeitete für die Civil and Military Gazette in Lahore sowie für The Pioneer in Allahabad. Der Rhythmus der Presse, die Mehrsprachigkeit der kolonialen Stadtlandschaften und Traditionslinien der britischen Ballade prägten seine Prosakürze, Dialogführung und metrische Strenge nachhaltig.
Sein literarischer Durchbruch erfolgte mit den in Indien entstandenen Kurzgeschichten und Gedichten. Plain Tales from the Hills, Departmental Ditties, Soldiers Three und die Novelle The Man Who Would Be King etablierten ihn als markanten Chronisten des anglo-indischen Alltags und der militärischen Subkultur. Die Sammlung Barrack-Room Ballads gab einfachen Soldaten eine prägnante Stimme und fand breite Leserinnen- und Leserschaft. Kritiker hoben die Knappheit der Form, den Wechsel von Ironie und Pathos sowie die anschauliche Fachsprache hervor. Bereits vor seinem dreißigsten Lebensjahr galt Kipling als produktiver, stilistisch eigenständiger Erzähler von internationaler Reichweite.
Mit den Kinder- und Jugendbüchern erweiterte er sein Publikum. The Jungle Book und The Second Jungle Book verbanden Tierfabel, Abenteuer und eine präzise Beobachtung sozialer Ordnungen. Just So Stories demonstrierte sein Ohr für mündliche Erzähltraditionen und spielerische Sprachlust. In Captains Courageous und Kim wandte er sich maritimen und asiatischen Schauplätzen zu, verband Bildungsroman, Spionage- und Reiseliteratur und entwarf eindrucksvolle Milieus. Gleichzeitig blieb er Meister der Kurzform; zahlreiche Erzählungen zeigen technische Moderne, Aberglauben und Grenzerfahrungen in dichtem Wechsel. Diese Spannweite zwischen populärer Erzählfreude und formaler Strenge trug wesentlich zu seiner weltweiten Bekanntheit bei.
Um 1900 war Kipling eine prominente Stimme der imperialen Öffentlichkeit. Sein Gedicht The White Man’s Burden, im Kontext der Debatten über Expansion und Verwaltung kolonialer Gebiete entstanden, wurde breit rezipiert und bis heute kontrovers diskutiert. Er berichtete über den Burenkrieg, hielt sich in Südafrika auf und verarbeitete Kriegserfahrungen in Lyrik und Essays; The Five Nations bündelte viele dieser Texte. Zeitgenössische Leser schätzten seine technische und organisatorische Imaginationskraft, Kritiker warfen ihm Apologie des Empire vor. Diese doppelte Resonanz prägte sein Image als moralisch-politischer Autor, der die Ambivalenzen imperialer Ordnung mit erzählerischer Autorität ausleuchtete.
Während des Ersten Weltkriegs unterstützte Kipling den britischen Kriegsdienst publizistisch und als Redner. Persönliche Verluste verstärkten sein Engagement für würdiges Gedenken; als literarischer Berater der Imperial War Graves Commission prägte er Formulierungen und Zeremonialstil der Grabinschriften mit. In Epitaphs of the War und in der ausführlichen Regimentsgeschichte The Irish Guards in the Great War suchte er Sprache für Trauer, Tapferkeit und Pflichtbewusstsein. Die knappe Sentenzkunst, die auch in If— beispielhaft erscheint, verband sich hier mit nüchterner Dokumentation. Zugleich wurde seine Kriegsrhetorik kritisch befragt, was seinen Status als nationaler Autor komplex machte.
Nach dem Krieg publizierte Kipling weiterhin Erzählungen, Essays und späte Gedichte; Zyklen wie Puck of Pook’s Hill und Rewards and Fairies, mit dem berühmten Gedicht If—, zeigten seine Hinwendung zu Geschichte, Landschaft und Erinnerung. Er lebte über Jahrzehnte in Sussex, wo sein Haus Bateman’s heute literarischer Erinnerungsort ist. 1936 starb er; seine sterblichen Überreste wurden in der Westminster Abbey beigesetzt. Sein Vermächtnis bleibt ambivalent: stilistische Virtuosität, erzählerische Ökonomie und Erfindungskraft werden bewundert, imperialer Ton und rassische Hierarchien kritisch revidiert. Kiplings Werk steht exemplarisch für die Spannungen moderner Weltliteratur. Zugleich prägen seine Figuren und Verse bis heute Kinderliteratur, Abenteuerprosa und populäre Lyrik.
Kim (Spionageroman)
Kapitel 1.
Er saß, in trotziger Mißachtung der behördlichen Vorschriften, rittlings auf der Kanone Zam-Zammah[1], die auf ihrem Ziegel-Unterbau gegenüber dem alten Ajaib-Gher stand – dem Wunderhaus – wie die Eingeborenen das Museum von Lahore nennen. Wer Zam-Zammah, »den feuerspeienden Drachen«, im Besitz hat, besitzt das Punjab;[1q] denn das mächtige, grünbronzene Geschütz ist immer des Siegers erste Beute.
Eine Rechtfertigung gab es für Kim – er hatte Lala Dinanaths Sohn von den Kurbellagern heruntergetreten – da den Engländern das Punjab gehörte – und Kim war Engländer. Obgleich so schwarz gebrannt, wie ein Eingeborener, obgleich mit Vorliebe die Landessprache gebrauchend und seine Muttersprache in einem undeutlichen Singsang radebrechend; obschon auf völligem Gleichheitsfuße mit den kleinen Bazar-Buben verkehrend, war Kim doch ein Weißer – ein armer Weißer – von den Allerärmsten einer[2q]. Die Halbblut-Frau, die ihm Quartier gab (sie rauchte Opium und behauptete, einen Möbelhandel aus zweiter Hand an dem Platz, wo die billigen Mietwagen stehen, zu betreiben), sagte den Missionären, sie sei Kims Mutterschwester. Seine Mutter aber war Kindermädchen in der Familie eines Obersten gewesen und hatte Kimball O’Hara geheiratet, einen jungen Fahnen-Unteroffizier von den Mavericks, einem irischen Regiment. Dieser nahm später Dienst bei der Sind-Punjab-Delhi-Eisenbahn, und sein Regiment ging ohne ihn heimwärts. O’Haras Weib starb in Ferozepore an der Cholera; er ergab sich dem Trunk und trieb sich mit dem dreijährigen, blitzäugigen Kinde an der Bahnlinie herum. Vereine und Geistliche, um den Knaben besorgt, suchten ihn einzufangen. Aber O’Hara machte sich stets aus dem Staube, bis er endlich auf das Weib traf, das Opium rauchte, von ihr diese Liebhaberei lernte und starb, so wie arme Weiße in Indien sterben. Seine Hinterlassenschaft bestand aus drei Schriftstücken; das eine nannte er sein » ne varietur[2] « weil dies Wort unter seinem Namenszug geschrieben stand, das andere seinen Entlassungsschein; das dritte war Kims Geburtsschein. »Diese Dinger«, so pflegte er in seinen glorreichen Opiumstunden zu sagen, »würden den kleinen Kimbali noch zu einem Manne machen.« Auf keinen Fall dürfte Kim sich von den Papieren trennen, denn sie wirkten durch Magie – eine Magie, wie sie die Männer drüben hinter dem Museum übten, in dem großen blau und weißen Jadoo-Gher – dem magischen Hause – was wir Freimaurer-Loge nennen). Es würde, sprach O’Hara, eines Tages alles zum Rechten kommen und Kims Horn würde hoch erhoben zwischen Säulen hängen – ungeheuren Säulen – starken und schönen. Der Oberst selbst, an der Spitze des stolzesten Regimentes der Welt reitend, würde Kim aufwarten – dem kleinen Kim – der es besser haben sollte, als sein Vater. Neunhundert Teufel erster Klasse, deren Gott ein Roter Ochse auf grünem Felde war, würden Kim dienen, wenn sie nicht O’Hara vergessen hätten – den armen O’Hara, den Vorarbeiter auf der Strecke von Ferozepore. Dabei pflegte er in seinem zerbrochenen Binsenstuhl auf der Veranda bitterlich zu weinen. So geschah es, daß nach seinem Tode das Weib Pergament, Papier und Geburtsschein in ein ledernes Amulett-Etui einnähte und es Kim um den Hals hängte.
»Und eines Tages,« sprach sie, sich der Prophezeihung O’Hara’s verworren erinnernd, »wird ein großer roter Ochse auf grünem Felde zu Dir kommen und ein Oberst, auf hohem Pferde reitend, ja, und« – in’s Englische fallend – »neunhundert Teufel.«
»O,« rief Kim, »ich werde daran denken. Ein roter Ochse wird kommen und ein Oberst zu Pferde. Aber vorher, sagte mein Vater, kommen die zwei Männer, die den Grund klar machen für die Ereignisse. So machen sie’s immer, sagte mein Vater, wenn Männer Magie treiben.«
Hätte die Frau Kim mit seinen Papieren nach dem Orts-»Jadoo-Gher« gesandt, so würde er sicher von der Provinzial-Loge übernommen und in das Freimaurer-Waisenhaus im Gebirge geschickt worden sein; aber was sie von Magie gehört, machte sie mißtrauisch. Auch Kim hatte seine eigenen Ansichten. Als er in die Flegeljahre kam, ging er Missionaren und weißen Leuten von ernstem Aussehen, die zu fragen pflegten, wer er sei und was er treibe, geflissentlich aus dem Wege. Denn Kim trieb, mit großartigem Erfolge, gar nichts. Zwar die wundervolle, wallumgürtete Stadt Lahore kannte er durch und durch, vom Delhi-Tor bis zum äußersten Festungsgraben; zwar stand er auf Du und Du mit Leuten, die ein so seltsames Leben führten, wie selbst Harun al Raschid es sich nicht hätte träumen lassen; zwar lebte er selbst ein so seltsames Leben, wie in »Tausend und eine Nacht« – aber die Missionare und Beamten von wohltätigen Anstalten hätten dies alles ja nicht zu würdigen gewußt. Im Stadtbezirk war sein Spitzname »Kleiner Allerweltsfreund«. Da er klein und unauffällig war, hatte er sehr oft nächtliche Botschaften auf den belebten Hausdächern von fashionablen, geschniegelten jungen Herren auszurichten. Es waren Intriguen, natürlich – er wußte das nur zu genau, hatte er doch, seit er sprechen konnte, alles Böse kennen gelernt. Er lieble solche Streiche um ihrer selbst willen; dies heimliche Umherstreifen durch dunkle Winkel und Gäßchen, das verstohlene Hinaufschleichen durch ein Wasserrohr, den Anblick und die Laute der Frauenwelt auf den flachen Dächern und die ungestüme Flucht von Dach zu Dach im Schutze der schwülen Dunkelheit. Dann gab es heilige Männer, mit Asche beschmierte Fakire, unter ihren steinernen Schreinen bei den Bäumen am Flußufer, mit denen er ganz familiär stand. Er begrüßte sie, wenn sie von ihren Bettelreisen zurückkehrten, und, wenn es niemand sah, aß er auch mit ihnen aus derselben Schüssel.
Die Frau, die ihn in Obhut hatte, flehte unter Tränen, er solle europäische Kleider tragen: Hosen, ein Hemd und einen Schlapphut. Kim zog es vor, in ein Hindu-oder Mohammedaner-Gewand zu schlüpfen, wenn er in gewissen Geschäften unterwegs war. Einer der jungen, fashionablen Männer – es war derselbe, der in der Nacht des Erdbebens auf dem Grunde eines Brunnens tot aufgefunden wurde – hatte ihm einst einen vollständigen Anzug aus Hindu-Stoff, das Kostüm eines Straßenjungen niederer Kaste, gegeben. Kim verbarg es heimlich zwischen einigen Balken auf Nila Rams Zimmerplatz, hinter dem Punjab-Gerichtshof, dort, wo die wohlriechenden Deodar-Klötze zum Austrocknen lagerten, nachdem sie den Ravi herabgetrieben. Wenn Aussicht auf Geschäfte oder Schelmenstreiche bevorstand, holte Kim seinen verborgenen Besitz hervor und kehrte erst beim Morgengrauen zurück in die Veranda, erschöpft vom Jubilieren hinter einer Heiratsprozession her oder vom Schreien bei einer Hindu-Festlichkeit. Zuweilen fand er einen Happen im Hause, öfter aber nicht; dann ging er wieder fort und aß mit seinen eingeborenen Freunden.
Er trommelte mit den Hacken gegen Zam-Zammah und unterbrach bisweilen sein »König vom Schloß«-Spiel mit dem kleinen Chota Lal und Abdullah, des Kuchenbäckers Sohn, um dem eingeborenen Polizisten, der die Reihe von Schuhen vor dem Museum zu bewachen hatte, Grobheiten zuzurufen. Der dicke Punjabmann lächelte nachsichtig. Er kannte Kim schon lange – ebenso der Wasserträger, der die trockene Straße aus seinem ziegenledernen Sack besprengte. Auch der Jawahir Singh, der Museums-Tischler, der über neuen Packkisten gebückt dastand, war ein alter Bekannter Kims, wie überhaupt jedermann rundherum, ausgenommen die Bauern vom Lande, die nach dem Wunderhause kamen, um die Dinge anzustaunen, die in ihrer eignen Provinz ebenso wie auch anderswo angefertigt wurden. Das Museum war bestimmt für die Erzeugnisse indischer Kunst und Industrie. Wer etwas erklärt haben wollte, konnte den Direktor fragen.
»Herunter! Herunter mit Dir! Ich will hinauf,« schrie Abdullah, auf Zam-Zammah’s Rad kletternd.
»Dein Vater war Pastetenkoch. Deine Mutter stahl das »Ghi«, sang Kim. »Alle Muselmänner sind längst von Zam-Zammah heruntergefallen.«
»Laß mich hinauf!« kreischte der kleine Chota Lal, unter seiner goldgestickten Mütze. Sein Vater war vielleicht eine halbe Million Sterling wert; aber Indien ist das einzige demokratische Land der Welt.
»Die Hindu sind auch von Zam-Zammah herabgefallen. Die Muselmänner stießen sie herunter. Dein Vater war Pastetenkoch« – Er hielt inne, denn um die Ecke, vom geräuschvollen Moti-Bazar her, kam schwerfälligen Ganges ein Mann, wie ihn Kim, der alle Kasten zu kennen glaubte, nie zuvor gesehen. Er war nahezu sechs Fuß hoch und gekleidet in dunkelbraunen Stoff, der, einer Pferdedecke ähnlich, Falte auf Falte schlug; und nicht eine Falte konnte Kim in Zusammenhang bringen mit irgendeinem ihm bekannten Geschäft oder Handwerk. An seinem Gürtel hing ein eiserner Federbehälter von durchbrochener Arbeit und ein hölzerner Rosenkranz, wie ihn heilige Männer tragen. Auf dem Haupte hatte er eine Art riesiger spitzer Deckelmütze mit einem Knopf in der Mitte. Sein Gesicht war gelb und runzelig wie das von Fook Shing, dem chinesischen Schuhmacher im Bazar. Seine Augen zogen sich nach den Winkeln aufwärts und sahen aus wie kleine Spalten aus Onyx.
»Wer ist das?« fragte Kim seine Kameraden.
»Vielleicht ist es ein Mann,« sprach Abdullah hinstarrend, den Finger im Munde.
»Ohne Zweifel,« erwiderte Kim; »aber es ist ein Inder, wie ich ihn noch nie sah.«
»Ein Priester vielleicht,« meinte Chota Lal, den Rosenkranz erspähend. »Sieh, er geht in das Wunder-Haus.«
»Nein, nein,« sagte der Polizist kopfschüttelnd. »Ich verstehe Deine Rede nicht.« Der Konstabler sprach Punjabi. »He, Du! Allerweltsfreund! was sagst Du?«
»Schicke ihn hierher,« rief Kim, von Zam-Zammah herab kletternd und seine nackten Füße schwenkend. »Er ist ein Fremder und Du bist ein Büffel.«
Der Mann drehte sich hilflos um und schob sich zu dem Knaben hin. Er war alt, und sein wollenes Obergewand dunstete noch von dem übelriechenden Wermut der Gebirgspässe.
»O, Kinder, was ist dies große Haus?« fragte er in sehr klarer Urdusprache.
»Das Ajaib-Gher, das Wunder-Haus.« Kim gab ihm keinen Titel, wie Lala oder Mian, denn er konnte des Mannes Glaubensbekenntnis nicht erraten. »Ah! Das Wunder-Haus! Kann da ein jeder eintreten?«
»Es steht über der Pforte geschrieben – jeder kann eintreten.«
»Ohne Bezahlung?«
»Ich gehe ein und aus. Und ich bin kein Bankier,« lachte Kim.
»Ach! Ich bin ein alter Mann, ich wußte es nicht.« Dann, seinen Rosenkranz fingernd, wandte er sich halb dem Museum zu.
»Welcher Kaste gehörst Du an? Wo ist Dein Haus? Kommst Du von ferne her?« fragte Kim.
»Ich kam über Kulu, von jenseits der Kailas – aber was wißt Ihr von den Bergen, wo« – er seufzte – »Luft und Wasser frisch und kühl sind.«
»Aha! Khitai« (ein Chinese), sagte Abdullah stolz. Fook Shing hatte ihn einmal aus seinem Laden gejagt, weil er nach dem Joß (chinesischer Götze) gespieen, der über den Stiefeln thronte.
»Pahari« (ein Bergbewohner), meinte der kleine Chota Lal.
»Ach Kind! Ein Bergbewohner, von Bergen, die Du niemals sehen wirst. Hörtest Du schon von Bhotiyal (Tibet)? Ich bin kein Khitai, aber ein Bhotiya (Tibetaner), wenn Du es wissen mußt – ein Lama – oder sage in Deiner Sprache: ein Guru.«
»Ein Guru von Tibet,« rief Kim. »So einen Mann sah ich noch nie. Sind sie Hindus in Tibet?«
»Wir sind Pilger des ›mittleren Pfades‹ und leben in Frieden in unseren Land-Klöstern; ich aber zog aus, um die Vier Heiligen Plätze zu sehen, bevor ich sterbe. Nun wißt Ihr, die Ihr Kinder seid, so viel als ich, der ich alt bin.« Er lächelte wohlwollend auf die Knaben hernieder.
»Hast Du gegessen?«
Er tappte auf seiner Brust herum und zog eine abgenutzte, hölzerne Bettelschale hervor. Die Knaben nickten. Alle Priester ihrer Bekanntschaft bettelten.
»Ich mag noch nicht essen.« Er bewegte seinen Kopf wie eine alte Schildkröte im Sonnenschein. »Ist es wahr, daß so viele Bildnisse im Wunder-Hause von Lahore stehen?« Er wiederholte die letzten Worte, wie jemand, der sich eine Adresse einprägt.
»Das ist wahr,« sagte Abdullah. »Es ist voll von heidnischen ›Buts‹. Du bist wohl auch ein Götzendiener?«
»Höre nicht auf ihn,« sprach Kim. »Das Haus gehört der Regierung und Götzendienerei gibt es nicht darin; nur einen Sahib mit einem weißen Bart. Komm mit mir, ich will Dich führen.«
»Fremde Priester fressen Knaben,« wisperte Chota Lal.
»Und er ist ein Fremder und ein But-parast (ein Götzendiener)« sagte Abdullah, der Mohammedaner.
Kim lachte. »Er ist fremd. Lauft, versteckt Euch in Eurer Mutter Schoß, dann seid Ihr sicher. Komm!«
Kim schob sich durch das Drehkreuz am Eingang, der alte Mann folgte, blieb aber bald vor Erstaunen stehen. In der Eintrittshalle standen die größeren Figuren hellenistisch-buddhistischer Skulptur, die – Gelehrte mögen wissen vor wie langer Zeit – von vergessenen Künstlern gefertigt waren, deren Hände nicht ohne Geschick nach dem rätselhaft überkommenen griechischen Stil getastet hatten. Da waren vereinigt Hunderte von Figurenfriesen in Relief, Fragmente von Statuen und Steinplatten mit Figuren, welche die steinernen Wände der buddhistischen Stupas (bienenkorbförmige Baudenkmäler) und Viharas (Klöster) der nördlichen Gegenden bedeckt hatten, um nun, ausgegraben und etikettiert, den Stolz des Museums auszumachen. Mit staunender Bewunderung wandte der Lama sich von einem zum anderen, bis er endlich in verzückter Spannung still stand vor einem Hoch-Relief, das die Krönung oder Apotheose des Buddha wiedergab. Der »Herr« war dargestellt auf einer Lotusblume sitzend, deren Blätter so tief unterhöhlt waren, daß sie fast losgelöst erschienen. Eine anbetende Korona von Königen, Tempelältesten und Buddhas aus den Vorzeiten umgab ihn. Darunter lotusbedeckte Wasser mit Fischen und Wasservögeln. Zwei Dewas mit Schmetterlingsflügeln hielten einen Kranz über seinem Haupte; zwei andere trugen den Sonnenschirm, überragt von der juwelenstrahlenden Hauptbedeckung des Bodhisat.
»Der Herr! Der Herr! Es ist Sakya Muni selbst,« sprach der Lama mit unterdrücktem Schluchzen, und er begann mit halber Stimme die wundervolle buddhistische Anrufung:
»Zu Ihm der Weg – die Lehre groß – Den Maya trug in ihrem Schoß Des Segens Herr – der Bhodisat!«
»Und ›Er‹ ist hier! Das höchst vortreffliche Gesetz ist auch hier. Meine Pilgerfahrt hat günstig begonnen. Und welch’ ein Werk! Welch’ ein Werk!«
»Dort ist der Sahib,« sagte Kim und hüpfte zwischen den Kasten der Kunstgewerbe und Industrie-Abteilung hindurch zur Seite.
Ein weißbärtiger Engländer blickte auf den Lama hin, der ihn feierlich grüßte und nach einigem Herumtasten ein Notizbuch und einen Streifen Papier zum Vorschein brachte.
»Ja, das ist mein Name,« sprach er, lächelnd auf die plumpe, kindliche Druckschrift deutend.
»Einer von uns, der die Pilgerfahrt nach den Heiligen Plätzen gemacht – er ist jetzt Abt des Lung-Cho-Klosters – gab mir dies,« stammelte der Lama. »Er sprach zu mir von ›Diesen‹.« Seine magere Hand wies zitternd rund umher.
»Willkommen denn, Lama von Tibet. Hier sind die Götterbilder; und hier bin ich,« – er blickte in des Lamas Gesicht – »um Wissen zu sammeln. Komm mit in mein Arbeitszimmer.« Der alte Mann zitterte vor Erregung.
Das Bureau war nur ein kleiner hölzerner, von der mit Skulpturen gefüllten Galerie abgeteilter Verschlag. Kim legte sich nieder, mit dem Ohr gegen einen Riß in der von der Hitze gespaltenen Tür von Zedernholz, um, seinem angeborenen Instinkte gemäß, zu horchen und zu beobachten.
Das Hauptsächlichste des Gesprächs ging über sein Verständnis. Anfangs zögernd sprach der Lama zu dem Direktor von seinem Lama-Kloster »Suchzen«, gegenüber dem Farbigen Felsen und wohl einen viermonatlichen Marsch entfernt. Der Direktor holte ein großes Buch mit Photographien herbei und zeigte ihm das genannte, auf hoher Felsspitze thronende Kloster, das auf das Riesenthal mit den vielfach getönten Felsstufen herniederschaute.
»Ei! Ei!« Der Lama setzte eine in Horn gefaßte Brille von chinesischer Arbeit auf. »Hier ist die kleine Tür, durch die wir das Holz für den Winter tragen. Und Du – der Engländer, kennst das? Der jetzt Abt von Lung-Cho ist, sagte mir, daß Ihr es wisset, aber ich glaubte es nicht. Der Herr, der Erhabene – man ehrt ihn auch hier? Und man kennt sein Leben?«
»Es ist alles in Stein gemeißelt. Komm und schaue, wenn Du ausgeruht hast.«
Der Lama schlürfte hinaus in die Haupthalle; der Direktor schritt ihm zur Seite durch die Sammlungen mit der Andacht des Verehrers und der Hochschätzung des Kunstkenners.
Ereignis auf Ereignis in der wundervollen Geschichte bezeichnete er auf den nachgedunkelten Steinen, zuweilen selbst etwas in Verlegenheit gebracht durch die ungewohnte griechische Stilart, aber entzückt wie ein Kind bei jedem neuen Fund.
Wo die Reihenfolge unterbrochen war, wie bei der Verkündigung, ergänzte der Direktor sie mit Hilfe seiner aufgestapelten französischen und deutschen Bücher, durch Photographien und Abbildungen.
Hier war der fromme Asita, Pendant des Simeon in der christlichen Geschichte, das heilige Kind auf den Knien haltend, während die Eltern andächtig lauschten; und hier waren Vorgänge aus der Legende des Vetters Devadatta. Hier war das böse Weib, das mit schändlicher Lüge den »Herrn« der Unlautbarkeit beschuldigte – hier die Predigt im Wildpark – das Wunder, von dem die Feueranbeter überwältigt wurden – und hier der Bodhisat als Prinz im Königlichen Schmuck; die wunderbare Geburt; der Tod zu Kusinara, wo der schwache Jünger in Ohnmacht sank. Fast unzählige Wiederholungen der Meditation unter dem Bodhisat-Baum fanden sich und die Anbetung der Almosen-Schale war überall zu sehen. Nach wenigen Minuten schon wußte der Direktor, daß sein Gast kein gewöhnlicher, Rosenkranzkugeln zählender Bettler, nein, ein ganzer Gelehrter war. Und sie gingen alles noch einmal durch; der Lama schnupfend, seine Brillengläser putzend und mit Eisenbahnschnelligkeit ein wunderbares Gemisch von Urdu und Tibetanisch redend. Er hatte von den Reisen der chinesischen Pilger Fo-Hian und Hwen-Thiang[3] gehört und war begierig zu erfahren, ob Übersetzungen ihrer Berichte existierten. Mit angehaltenem Atem wendete er hilflos die Blätter von Beal und Stanislas Julien um. »Es ist alles hier – aber für mich ein verschlossener Schatz.« Dann suchte er sich zu beruhigen, um ehrfurchtsvoll den Bruchstücken zu lauschen, die ihm rasch in Urdu wiedergegeben wurden. Zum ersten Male hörte er von den Arbeiten europäischer Gelehrten, die mit Hilfe dieser und hundert anderer Dokumente die heiligen Plätze des Buddhismus festgestellt haben. Dann wurde ihm eine mächtige Karte gezeigt, fleckig, voll gelblicher Linien. Der braune Finger folgte des Direktors Stift von Punkt zu Punkt. Da war Kapilavastu, da das Königreich der Mitte und hier Mahabodhi, das Mekka des Buddhismus; und hier war Kusiganagara, der traurige Platz von des Heiligen Tod. Der alte Mann beugte für eine Weile schweigend das Haupt über die Blätter; der Direktor zündete sich eine neue Pfeife an. Kim war eingeschlafen. Als er erwachte, war die Unterhaltung noch im Flusse, aber ihm besser verständlich.
»Und so geschah es, o Brunnen der Weisheit, daß ich beschloß, nach den Heiligen Plätzen zu pilgern, die »sein« Fuß betreten. Nach dem Geburtsplatz, selbst nach Kapila; dann nach Maha Bodhi, was Buddh Gana ist – nach dem Kloster – dem Wildpark – nach dem Platz Seines Todes.«
Der Lama senkte die Stimme. »Und ich komme allein hierher. Seit fünf, sieben, achtzehn – vierzig Jahren trage ich es in meinen Gedanken, daß das Alte Gesetz nicht wohl befolgt wird. Es ist, Du weißt es, überladen mit Teufelei, Zauberei und Götzendienst. Gerade wie das Kind da draußen eben sagten ja, wie selbst das Kind sagte, mit »But parasti«.
»So ergeht es jeder Glaubenslehre.«
»Meinst Du? Die Bücher meines Klosters habe ich gelesen, und sie waren vertrocknetes Mark: und das späte Ritual, mit dem wir vom Reformierten Gesetz uns beladen haben – auch das hatte keinen Wert in diesen alten Augen. Selbst die Jünger des »Vollkommenen« leben in beständiger Fehde miteinander. Es ist alles Wahn! Ja, Maya, Wahn! Aber ich trage ein anderes Verlangen« – das gefurchte gelbe Gesicht näherte sich ganz dicht dem des Direktors und der lange Nagel des Zeigefingers tippte auf den Tisch – »Eure Gelehrten sind in diesen Büchern den Heiligen Füßen auf allen Wanderungen gefolgt; aber es gibt Dinge, denen sie nicht nachgeforscht haben. Ich weiß nichts – nichts weiß ich – aber ich gehe mich frei zu machen von dem Rad der Dinge[4], auf einem offenen, breiten Wege.« – (Rad der Dinge ist ein buddhistischer Begriff der Wiederkehr alles Seienden bis zur Erlösung.) Er lächelte mit naivem Triumph. »Als Pilger nach den Heiligen Plätzen erwerbe ich Verdienst. Aber es bleibt mehr zu tun. Höre auf ein wahres Wort. Da unser gnadenreicher Herr noch ein Jüngling war und eine Lebensgefährtin suchte, meinten die Männer an Seines Vaters Hof, daß Er zu zart zur Heirat wäre. Du weißt dies?«
Der Direktor nickte, neugierig, was nun folgen sollte.
»So wurde eine dreifache Kraftprobe mit allen herankommenden Bewerbern angeordnet. Bei der Prüfung des Bogens forderte unser »Herr«, nachdem Er den ihm überreichten Bogen durchgebrochen, einen Bogen, den keiner spannen könnte. Du weißt?«
»Es steht geschrieben. Ich habe es gelesen.«
»Und alle anderen Zeichen überschießend, flog der Pfeil fern und ferner, außer Sicht. Zuletzt fiel er; und wo er die Erde berührte, da brach ein Wasserstrahl hervor, der sogleich zum Strome wurde. Und durch unseres Herrn Gnade und das Verdienst, das Er erwarb, bevor Er Sich selbst frei machte, erhielt der Strom die Eigenschaft, jede Spur und jeden Flecken von Sünde abzuwaschen von dem, der in ihm badet.«
»So steht es geschrieben«, sagte traurig der Direktor.
Der Lama tat einen liefen Atemzug. »Wo ist der Strom, o Brunnen der Weisheit? Wo fiel der Pfeil?«
»O, mein Bruder, ich weiß es nicht.«
»O nein. Du hast es wohl vergessen – das Eine nur, was Du mir nicht gesagt. Sicher, Du mußt es wissen. Sieh, ich bin ein alter Mann! Ich frage Dich – mein Haupt zwischen Deinen Füßen – o, Brunnen der Weisheit! Wir wissen, der Wasserstrahl sprang hervor! Wo denn ist der Fluß? Ein Traum hieß mich ihn finden. So kam ich. Ich bin hier. Aber wo ist der Strom?«
»Wenn ich es wüßte, denkst Du, ich würde es nicht laut hinausrufen?«
»Durch ihn,« fuhr der Lama, ohne ihn zu beachten fort, »erlangt man Befreiung vom Rad der Dinge. Der Strom des Pfeiles! Denk’ noch einmal nach! Ein kleines Flüßchen, – mag sein – vielleicht in der Hitze vertrocknet? – Aber der Heilige würde einen alten Mann nicht so täuschen.«
»Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.«
Der Lama brachte sein tausendfach durchfurchtes Gesicht auf eine Handbreite dem des Engländers nahe.
»Ich sehe. Du weißt es nicht. Da Du der Lehre nicht angehörst, blieb Dir dieses verborgen.«
»Ach! Verborgen – verborgen.«
»Wir sind bald in Banden, Du und ich, mein Bruder. Aber ich« – er erhob sich mit einem Schwung seiner weichen, schweren Umhüllung – »ich gehe, um mich frei zu machen. Komm’ mit!«
»Ich bin gebunden,« sagte der Kurator … Aber wohin gehst Du?«
»Erst nach Kashi (Benares), wohin sonst? Dort in dem Jaina-Tempel dieser Stadt werde ich einen von der reinen Lehre treffen. Auch er ist im Geheimen ein Sucher, und von ihm kann ich möglicherweise lernen. Kann sein, daß er mit mir nach Buddha-Gaya geht. Von da nördlich und westlich nach Kapilavastu, und da will ich nach dem Flusse suchen. Nein, überall, wohin ich gehe, will ich suchen – denn der Platz, wo der Pfeil fiel, ist nicht bekannt.«
»Und wie willst Du gehen? Es ist ein weiter Ruf bis Delhi, und weiter noch bis Benares.«
»Auf der Heerstraße und mit den Zügen. Von Pathankot, nachdem ich die Hügel verlassen, kam ich hieher in einem Zug. Er fährt schnell. Anfangs wunderte ich mich sehr über die hohen Stangen an der Seite des Weges, die die Fäden aufschnappen und aufschnappen,« er erläuterte pantomimisch das scheinbare Neigen und Wirbeln der Telegraphenstangen, wenn der Zug vorbeisaust. »Aber später, ich saß so zusammengepfercht, ich wünschte, ich hätte gehen können, wie ich es gewohnt bin.«
»Und kennst Du Deinen Weg denn sicher?« fragte der Direktor.
»O, was das betrifft, ich brauche nur zu fragen und Geld zu zahlen; die angestellten Personen befördern jeden nach dem bestimmten Platz. Das wußte ich schon in der Lamaserai aus sicherer Quelle,« sagte mit Stolz der Lama.
»Und wann willst Du fort?« Der Direktor lächelte über diese Mischung von altweltlicher Frömmigkeit und modernem Fortschritt, wie sie jetzt für Indien so bezeichnend ist.
»Sobald als möglich. Ich folge den Spuren Seines Lebens, bis ich zu dem Strom des Pfeiles komme. Es gibt indes ein geschriebenes Papier von den Stunden der Züge, die südwärts gehen.«
»Und Deine Nahrung?« Lamas führen in der Regel einen guten Vorrat an Geld irgendwo bei sich, aber der Direktor wünschte sich davon zu überzeugen.
»Auf der Reise trage ich die Bettelschale wie unser Meister. Ja. So wie Er ging, so gehe ich, mit Verzicht auf meines Klosters Versorgung. Da ich die Hügel verließ, hatte ich einen Chela[5] (Schüler) bei mir, der, wie es die Regel erfordert, für mich bettelte; aber in Kulu, wo wir eine Weile hielten, ergriff ihn ein Fieber und er starb. Ich habe nun keinen Chela, aber ich will die Almosenschale tragen und den Mildtätigen Gelegenheit bieten, Verdienst zu erwerben.« Er nickte tapfer mit dem Kopf. Gelehrte Doktoren einer Lamaserai betteln nicht; aber der Lama war in diesem Punkte Idealist.
»Sei es so,« sagte lächelnd der Direktor. »Gönne mir nun, Dir einen Dienst zu erweisen. Wir beide sind Kollegen, Du und ich. Hier ist ein neues Buch, von weißem, englischem Papier, hier sind gespitzte Bleistifte, zwei und drei, dicke und dünne – alle gut für einen Schreiber. Nun erlaube mir noch Deine Brille.«
Der Direktor sah durch die Gläser. Sie waren arg zerschrammt, aber die Stärke fast genau wie die seiner eigenen Brille, welche er in des Lamas Hand gleiten ließ mit den Worten: »Versuche diese.«
»Eine Feder! Wahrhaftig, so leicht wie eine Feder auf dem Gesicht!« Der alte Mann bewegte entzückt den Kopf und runzelte die Nase aufwärts. »Kaum fühle ich sie. Wie klar ich sehe!«
»Die Gläser sind Bilaur (Krystall) und werden niemals schrammig. Mögen sie Dir zu Deinem Flusse helfen, sie sind Dein!«
»Ich will sie nehmen, und die Stifte auch und das weiße Buch, als Zeichen der Freundschaft zwischen Priester und Priester – und nun« – er tappte an seinem Gürtel herum, löste den eisernen Federbehälter von durchbrochener Arbeit los und legte ihn auf des Direktors Tisch. »Das soll ein Zeichen der Erinnerung sein zwischen Dir und mir – mein Federbehälter. Es ist etwas Altes – so wie ich bin.«
Es war eine Arbeit von altem Muster, chinesisch, von einem Eisen, wie es jetzt nicht mehr gegossen wird; und das Sammlerherz in des Direktors Brust hatte sie vom ersten Augenblick an ersehnt. Um keinen Preis wollte der Lama seine Gabe zurücknehmen.
»Wenn ich zurückkehre und den Fluß gefunden habe, will ich Dir ein geschriebenes Bild von der ›Padma Samthora‹ (heilige Lotosblume) bringen – so wie ich es in der Lamaserai auf Seide zu machen pflegte. Ja – und von dem Rad des Lebens,« sprach er mit halb unterdrücktem Lachen, »denn wir beide sind Kunstkenner, Du und ich.«
Der Kurator hätte ihn gern noch zurückgehalten; denn es gibt nur wenige in der Welt, die noch das Geheimnis der althergebrachten buddhistischen Pinselfederdarstellungen besitzen, die halb geschrieben, halb gezeichnet sind. Aber der Lama schritt bereits weitausgreifend und das Haupt hoch in der Luft, hinaus, stand einen Augenblick noch still vor der großen Statue eines Bodhisat in Meditation und schob sich sodann durch das Drehkreuz.
Kim folgte ihm wie sein Schatten. Was er erlauscht, hatte ihn wild erregt. Dieser Mann war ihm, trotz aller Erfahrung, vollständig neu und er wollte ihn weiter ergründen, genau so wie er ein neues Gebäude oder eine unbekannte Festlichkeit in Lahore ausspionierte. Der Lama war sein Fund und er wollte Besitz von ihm ergreifen. Kims Mutter war nicht umsonst eine Irländerin.
Der alte Mann hielt inne bei Zam-Zammah und schaute sich um, bis sein Auge auf Kim fiel. Der Enthusiasmus seiner Pilgerfahrt war für den Augenblick gedämpft; er fühlte sich verlassen, alt und sehr hungrig.
»Nicht unter der Kanone sitzen!« fuhr ihn der Polizist grob an.
»Hu! Du Eule!« war Kims Erwiderung an des Lamas Stelle. »Setze Dich nur unter die Kanone, wenn es Dir so gefällt. Wann hast Du der Milchfrau die Pantoffeln gestohlen, Dunnoo?«
Das war eine ganz grundlose, der Eingebung des Augenblickes entsprungene Beschuldigung; aber sie machte Dunnoo verstummen, der wußte, daß Kims gellende Stimme Legionen von bösen Bazar-Buben herbeirufen Konnte, wenn’s Not tat.
»Und wen hast Du angebetet da drinnen?« frug Kim leutselig, indem er sich im Schalten neben dem Lama niederkauerte.
»Ich betete keinen an, Kind. Ich verneigte mich vor dem Vortrefflichen Gesetz.«
Kim akzeptierte diese neue Gottheit ohne Gemütsbewegung. Er kannte schon eine gehörige Anzahl.
»Und was willst Du nun tun?«
»Ich bettle. Ich entsinne mich nun, es ist lange her, daß ich aß und trank. Wie ist der Brauch in dieser Stadt, wenn man Mildtätigkeit sucht? Tut man es schweigend, wie in Tibet, oder mit Worten?«
»Die mit Schweigen betteln, verhungern im Schweigen,« antwortete Kim, ein landesübliches Sprichwort anführend. Der Lama versuchte sich zu erheben, sank aber zurück und klagte um seinen Schüler, der in weiter Ferne, in Kulu, gestorben war. Den Kopf zur Seite, beobachtete Kim überlegend und interessiert.
»Gib mir die Schale. Ich kenne die Leute in dieser Stadt, alle, die barmherzig sind. Gib mir die Schale, ich bringe sie Dir gefüllt zurück.« Einfach wie ein Kind, reichte der alte Mann ihm die Schale.
»Ruhe Du. Ich kenne meine Leute.«
Er trottete fort zu der offenen Bude einer Kunjri-Gemüsehändlerin niederer Kaste, die gegenüber der Straßenbahnlinie am Motti-Bazar stand. Die Frau kannte Kim lange genug.
»Oho« rief sie, »bist Du ein Pogi geworden, mit Deiner Bettlerschale?«
»Nein,« sagte Kim stolz. »Es ist ein fremder Priester in der Stadt – ein Mann, wie ich noch nie einen sah.«
»Alter Priester – junger Tiger,« sprach das Weib ärgerlich. »Ich hab’ die fremden Priester satt! Die fallen wie Fliegen über unsere Ware her. Ist der Vater meines Sohnes ein Brunnen der Barmherzigkeit, um allen zu geben, die betteln?«
»Nein,« antwortete Kim: »Dein Mann ist mehr ein Pagi (Brummbär) als ein Pogi (heiliger Mann). Aber dieser Priester ist neu. Der Sahib in dem Wunderhaus sprach zu ihm wie ein Bruder. O, meine Mutter, fülle mir die Schale! Er wartet!«
»Diese Schale? Meinst Du? Die hat ja einen Bauch wie eine Kuh. Du bist nicht besser als der heilige Stier des Shiwa; der hat mir heute früh schon das Beste von einem Korb voll Zwiebeln aufgefressen, und dann soll ich noch Deine Schale füllen? Da kommt er schon wieder.«
Der ungeheure, mausgraue Brahmini-Stier schob sich mit auf-und niederschaukelnden Schultern durch die vielfarbige Menge, ein gestohlenes Bananenbüschel im Maule. Er hielt gerade auf die Bude zu, sich seiner Privilegien als geheiligtes Tier wohl bewußt, senkte den Kopf und schnüffelte heftig an der Reihe von Körben herum, ehe er seine Wahl traf. Da flog Kims holzbeschuhter kleiner Fuß in die Luft und traf ihn auf die feuchte blaue Schnauze. Er grunzte ärgerlich und stapfte über die Bahnschienen zurück; sein Widerrist zitterte vor Wut.
»Sieh, ich habe Dir mehr gespart, als es kostet, wenn Du die Schale dreimal füllst. Nun, Mutter, ein wenig Reis und getrockneter Fisch obenauf – ja, und etwas Curry-Gemüse.«
Ein Knurren kam aus dem Hintergrund der Bude, wo der Mann lag.
»Er hat den Stier vertrieben,« sagte die Frau halblaut. »Es ist gut, den Armen zu geben.« Sie nahm die Schale und gab sie, mit heißem Reiß gefüllt, zurück.
»Aber mein Pogi ist keine Kuh,« sagte Kim ernsthaft, mit seinen Fingern ein Loch in den Reisberg machend. »Ein wenig Curry ist gut, und ein gebackener Kuchen und etwas eingemachte Frucht würden ihm behagen.«
»Das Loch ist so groß wie Dein Kopf,« sprach murrend das Weib. Aber sie füllte es trotzdem mit gutem, heißem Currygemüse, klappte einen getrockneten Kuchen oben darauf mit einem Stückchen geklärter Butter, legte ein Häufchen Tamarinden-Konserve an die Seite – und Kim betrachtete wohlgefällig die Ladung.
»So ist’s gut, wenn ich im Bazar bin, soll der Ochs nicht wieder an diese Bude kommen. Er ist ein frecher Bettelmann.«
»Und Du?« lachte die Frau. »Aber sprich nicht schlecht von Ochsen. Hast Du mir nicht gesagt, daß eines Tages ein Roter Ochse aus einem Felde kommen wird, um Dir zu helfen? Nun halte alles gerade und fordere des heiligen Mannes Segen für mich. Vielleicht weiß er auch ein Mittel, die kranken Augen meiner Tochter zu heilen? Fordere auch dies, Du kleiner Allerweltsfreund.«
Doch Kim war fortgetanzt vor dem Ende dieser Rede, herrenlosen Hunden und hungrigen Bekanntschaften aus dem Wege gehend.
»So betteln wir, die wir die Sache verstehen, sprach er stolz zu dem Lama, der die gefüllte Schale erstaunt betrachtete. »Iß nun und – ich will mit Dir essen. Heda! Bhisti!« er rief dem Wasserträger, der die Erotons (Krebsblumen) bei dem Museum begoß, »bring’ Wasser. Wir Männer sind durstig.«
»Wir Männer!« lachte der Bhisti. »Ist ein voller Schlauch genug für so ein Paar? Trinkt denn, im Namen des Erbarmers.«