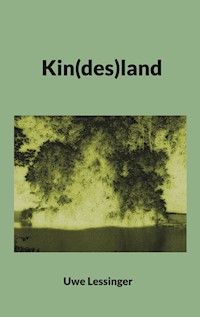
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Paul ist ein Junge aus der ostdeutschen Provinz, der mit seinen Freunden Harald und Peter so manches Abenteuer beschreitet. Dabei dreht sich alles um Ihr Geheimversteck mit dem Namen Kindesland.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 253
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Der Gedanke
Unsere Ankunft
Jahr um Jahr
Harald von Schlütte
Wir sehen uns...
Mutters Kunst
Das Versteck
Peter
Kindesland
Die Nachricht
Der Fremde kommt nach Hause
Die Verhandlung
Peterchens Reise
Die Zeit vor danach
Peterchens Rückkehr
Der Anruf bei Harald
Wieder vereint am Ende der Welt
Der Brief
Kindesland
Wie langweilig wäre die Welt, würde jeder Gedanke aus Wahrheit bestehen. Sind es nicht die Unwahrheiten, die uns inspirieren in der Wirklichkeit zu leben
Für meine Frau und meine Kinder
Der Gedanke
Wir schufen ein System, welches in der Natur so nicht vorkommt und laufen Gefahr, dass dieses System uns entindividualisiert.
Jeder Mensch ist an eine Gesellschaft gebunden. Auch Einzelgänger, Einsiedler, Verschollene und andere, die sich aus dem System lösten oder gelöst wurden, stammen aus einer Gesellschaft, auch wenn es nur die Gesellschaft der eigenen Mutter war und dies hinterlässt bei jedem von uns Spuren. Betrachten wir menschliches Zusammenleben, dann erkennen wir, dass jede Tat auch auf andere Taten Einfluss hat.
Wäre es dem Doktoranden ohne Weiteres möglich eine bahnbrechende Entdeckung zu machen, wenn seine Lebensrahmenbedingungen nicht stimmen würden?
Unzählige Taten von unzähligen Personen sorgen dafür, dass eine einzelne Person ihre Möglichkeiten ausschöpfen kann. Im Gegenzug reiht sich diese Person oft unbewusst in die Gruppe der unzähligen Täter ein, um wiederum andere Personen zu unterstützen. All das geschieht meistens eigennützig, denn der Mensch stellt in der Regel Eigennutz vor Allgemeinwohl, doch das System „Gesellschaft “ scheint damit zu funktionieren.
Wir produzieren bis zu 50.000 Gedanken am Tag, doch verwerfen wir die meisten wieder. Wir nehmen sie nicht mal wahr. Unser Gehirn lässt nur die relevantesten in unser Bewusstsein und auch dort sortieren wir weiter aus. Am Ende bleibt ein modelliertes Gedankenmodell, welches ständig erweitert wird an uns und unsere Umwelt angepasst.
Bei diesen Vorgängen verhält sich unser Gehirn evolutionär. Ständig neu produzierte Gedanken werden immer wieder aussortiert und nur die zum Konstrukt des Denkenden passenden Gedanken überleben.
Richtungsändernde Mutationen, also revolutionäre Gedanken, werden spätestens von der Gesellschaft ausgelöscht. Nur wenige solcher Gedankensprünge können sich manifestieren.
Der evolutionäre Gedanke unterscheidet sich vom revolutionären Gedanken durch Anpassung.
Revolutionäre Gedanken sind der Motor unserer Gedankenwelt. Sie treiben uns und unsere Gesellschaft voran. Der evolutionäre Gedanke lässt unsere Spezies überleben, grundlegend wichtig, doch wenig innovativ.
Doch können solche revolutionäre Gedanken natürlich auch negativ genutzt werde und endloses Leid über eine Gesellschaft bringen.
Milliarden von Menschen produzieren rund um die Uhr evolutionäre Gedanken, um die Grundlage für die wenigen Menschen, die revolutionäre Gedanken bilden zu schaffen. Sobald ein revolutionärer Gedanke sich manifestiert und verbreitet hat und er Früchte in Form von Taten trägt, wird er in die Gesellschaft aufgenommen und bildet wiederum die Grundlage für evolutionäre Gedanken.
Der evolutionäre Gedanke bildet die Grundlage für den revolutionären Gedanken, dass dieser wieder zur Grundlage weiterer evolutionärer Gedanken werden kann.
Dieser Überlegung folgend möchte ich ihnen ein Geheimnis offenbaren.
Ich merke, dass es in mir brodelt, in mir gärt, und da mein Leben aus mehr Vergangenheit als Zukunft besteht, möchte ich reinen Tisch machen. Tabula rasa mit mir und dem, was war.
Ich möchte beginnen mit dem, was ich für wichtig halte. Ob es wichtig ist, müssen andere entscheiden.
Was war, wird immer sein, gefangen in Raum und Zeit.
Zu verbergen können wir versuchen, aber vergessen wird nichts.
So geschah es, dass ich in eine für damalige Zeit aufgeschlossenen, gar moderne Familie geboren wurde.
Die Bildung meiner Eltern ging über das in Schulen vermittelte Wissen weit hinaus. Sie lernten ihr Leben zu nehmen, wie es kam, jede Sekunde als einzigartig zu verstehen, fröhlich sein auch bei aller Traurigkeit. Sie liebten, was sie hatten und sie vermissten nichts, was sie nicht hatten. Glück findet sich oft im Kleinen, im Unscheinbaren. Das Leben war ihr bester Lehrer.
Wer an einem lauen Sommerabend mit geliebten Menschen auf einer Wiese sitzt, lacht, das Gras riecht, die Wärme des Bodens spürt, weiß, was ich meine.
Der Einzelne braucht wenig, die Gesellschaft viel. Ein Mensch wird von ihr mitgerissen, muss funktionieren, darf sich nicht zu weit umschauen. Tut er es doch, wird auf ihn eingeschlagen, bis er sich wieder fügt. So ist das Spiel und so war es schon immer.
Nun lebte ich in der richtigen Familie zur falschen Zeit.
Eine Zeit, die nur eines im Sinne hatte, zu unterdrücken und zu zerstören. Es blieb uns nichts übrig, als in den letzten Winkel des abgelegensten Landstrichs zu ziehen, um dort von der Hand in den Mund zu leben.
Als kleine Bauern in der Gunst eines wohlhabenden Großgrundbesitzers schafften es meine Eltern ein Dasein zu führen, in dem mir an nichts fehlte. Im Gegenteil, wenn ich zurückblicke, war es eine Zeit im Überfluss.
Unser Haus, das mehr als baufällig war, lag an einem sandigen Weg zwischen endlos scheinenden Weizenfeldern, die in der Sommersonne wie ein einzig großes goldenes Meer wirkten, in das man am liebsten eingetaucht wäre. Diese wie flüssig wirkende Landschaft wurde nur durch das kleine Bauernhaus und den um das Haus stehenden Birkenbäume, die im Wind wie dickbäuchige Tänzerinnen hin und her wehten, unterbrochen. Das Gold der Felder, das Grün der Bäume, unterbrochen vom Rot der Ziegelsteine, küssten den weiß blauen Himmel so als wollte alles miteinander verschmelzen.
Das Leben schenkte uns ein Ort, an dem wir noch leben durften, wie wir es wollten. Mein Vater stand im Dienst des Herrn von Schlütte, einem alten hageren Mann mit großen, aufgeweckten Augen, eingefallenen Wangen und einem riesigen gezwirbelten Schnauzer, der an seinen beiden Spitzen steil nach oben zeigte.
Herr von Schlütte entstammte einem ostpreußischen Landadelsgeschlecht, das schon viele Jahrhunderte den verschiedensten Herren diente und sich auch mit den damaligen Herren arrangierte.
Im Schutze des guten ostpreußischen Namens und den regelmäßigen Getreidelieferungen an die Oberen konnten wir hier alle leben. Wir hätten auch bei dem Bösen leben können, der Schein wäre gewahrt gewesen, doch es wäre eine Lüge gewesen und dies wollten meine Eltern nicht. Obgleich unser gewähltes Leben im Grunde auch eine Lüge war, oder gibt es einen Unterschied zwischen Vortäuschen und Verstecken?
Das Gut der Herren von Schlütte lag außer Sichtweite unseres Hofes und war ein wunderschönes Gutsgebäude, einem Schloss ähnlich mit unzähligen Fenstern, gekrönt von einem Mittelbau mit großer Treppe, die an einer massiven, oben abgerundeten Eichentür mit zwei Flügeln, an der an jeder Seite ein schweres, aus Messing gefertigtes Schloss mit Griff angebracht war, endete. Allein die Türgarnitur zeugte vom Wohlstand des Besitzers und dieser Eindruck setzte sich am ganzen Haus fort. Umgeben war das Gutshaus von mehreren größeren und kleineren Gebäuden und Scheunen, die wie ein Dorf um den Prachtbau gebaut waren. Wege, Bäume und Rasenflächen rundeten das Idyll ab.
Ich ging oft den Pfad an unserem Haus entlang, einen kleinen Stich hinab, bis ans Ende der Felder, wo die großen Bäume die Grenze zu Wiesen und Weiden bildeten und sich eine schmale, gut befestigte Straße an den Bäumen vorbei schlängelte, bis sie ihrerseits in das große Eingangstor vorm Gut mündete.
Dort stand ich oft und spürte, was es hieß zu sein, was ich nicht war. Doch ich stand nicht deswegen dort, sondern ich wartete auf meinen besten Freund Harald von Schlütte, dem Enkel des Herrn. Der lebte dort mit seiner Mutter Amelie und beide warteten, dass Ihr Vater und Mann zurückkehrte. Der war zu dem Bösen gegangen, um nicht für dieses zu kämpfen, sondern für sein Land, welches für ihn einen großen Unterschied machte. Viele wussten, dass er dort mit dem Feuer spielen wird. Harald und ich lebten in verschiedenen Welten, aber wir schufen uns unser eigenes Universum, in dem wir waren, was wir sein wollten. Fast jeden Nachmittag trieben wir uns zusammen rum und machten das Umland unsicher.
Harald wurde privat unterrichtet, sein Großvater hatte einen jungen Lehrer aus der Stadt in seinen Diensten, welcher auch auf dem Gut wohnte, nachmittags sah man ihn oft im Park neben dem Gutshaus umher stolzieren, als wäre er auf einem Boulevard mitten in Paris. Stets mit feinem Leinen und glänzenden schwarze Lackschuhen bekleidet und als Tupfer einen wohlgeformten Strohhut auf dem Haupt, schlendert er über die Wege. Seine Nase zwischen den Seiten eines kleinen Gedichtbandes, welches er tagtäglich aufs Neue zu lesen schien. Franz Schneider war sein Name, Ende zwanzig und ohne Bindung verbrachte er seine besten Jahre dort, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagten.
Ich im Gegensatz musste meine Pflicht in der alten verrotteten Dorfschule absitzen. Umgeben von zwanzig anderen, zwischen sechs und fünfzehn Jahren, alle in einem Raum und mit einem Lehrer, der auch der Pfarrer im Ort war.
Und alle hingen wir am Wohlwollen der Herren von Schlütte, denn sie waren es, die dem Dorf Arbeit gaben, auch meinem Vater.
Unser Dorf, wenn man es Dorf nennen mag, war ein Haufen Backsteinhäuser, an denen meistens noch eine Scheune hing. Die Dorfstraße war mehr Acker als Straße, dennoch war sie sehr breit und die wenigen Fuhrwerke, die auf ihr verkehrten, verloren sich ein wenig.
Inmitten des Dorfgeschehens stand am Ende der Straße eine hohe, sehr breite Buche, hinter deren Geäst sich das größte Gebäude des Dorfes versteckte. Der Dorfkrug, ein dreigeschossiges Backsteingebäude, in dessen Mitte eine Treppe in die Wirtschaft führte. Die Sandsteintreppe, deren Stufen kaum mehr als solche zu erkennen waren, zeugte vom regen Besuch der Schenke. Der Wirt Holger Stenzel war ein großer dicker Mann, immer bekleidet mit schwarzer Hose und weißem Hemd, dessen Ärmel stets hochgekrempelt waren. Ein Geschirrtuch war sein ständiger Begleiter, wie eine Schürze hatte er das Tuch im Gürtel stecken.
Jeden Mittag Punkt zwölf öffnete Stenzel seine Wirtschaft, die aber vor fünf Uhr von kaum jemanden besucht wurde.
Er stand bis dahin hinter dem Tresen und polierte mit seinem Tuch die Biergläser blank. Dabei bewegte er sich genauso rhythmisch wie die Birken im Wind auf unserem Hof. Die Knöpfe seines Hemdes drohten bei jeder Bewegung wie Geschosse wegzufliegen. Ich kann mich daran so genau erinnern, da ich fast jeden Tag, meist kurz nach zwei, ein Dutzend Eier zu ihm brachte.
Der Verkauf von Eiern war ein Teil des Lebensunterhaltes meiner Eltern.
Der Wirt hat einen Sohn mit dem Namen Peter, dieser war bei mir in der Klasse und mein zweitbester Freund.
Um ehrlich zu sein, ich hatte nur zwei Freunde.
Harald, Peter und ich, Paul, waren ein wunderbarer Haufen. Jeden Tag den ich mit den beiden erlebte, war ein Abenteuer. Wir kamen alle drei aus den unterschiedlichsten Familien und doch waren wir gleich.
Ich erinnere mich im Grunde nur an Bruchstücke meiner Kindheit, alles scheint zu einem langen einzigen Tag verschmolzen zu sein. Doch an eines kann ich mich erinnern, als wäre es erst gestern geschehen. Die Geschichte vom Kindesland....
Kapitel 1 Unsere Ankunft
Ich war das einzige Kind meiner Eltern, Karl und Alice Krämer geborene Mülriegel. Sie lernten sich beim Studium kennen. Beide studierten in München Kunst an der Akademie. Mein Vater Bildhauerei, meine Mutter bildende Kunst. Doch nach dem Studium holte sie schnell die Realität der damaligen Zeit ein. Für ihre Kunst schien dort kein Platz gewesen zu sein. Meine Eltern, so sagten sie es mir später, hatten inmitten von „denen“ keine Luft zum Atmen mehr. Darum gingen Sie ans Ende der Welt, so nannten Sie den kleinen Flecken, wo wir fortan lebten. Dort war das Leben selbst die Kunst, die sie brauchten. Die Natur und das einfache Leben waren es, was sie inspirierte und anspornte weiterzumachen.
Ich wurde noch in München geboren, war dort aber nie zu Hause, meine Heimat war am Ende der Welt.
Ich war zwei Jahre alt, als wir in das Dorf kamen, warum wir gerade hier landeten, weiß ich nicht genau.
Mutter sagte, wir hätten, nachdem sie geheiratet haben, einfach unsere Sachen gepackt und in den erst besten Zug gestiegen. Dort, wo es sich gut anfühlte, wären sie ausgestiegen und hätten gewartet. Sie warteten auf irgendetwas, ein Zeichen, ein Impuls oder einfach nur auf den richtigen Moment. Scheinbar kam dieser richtige Moment, denn nach kurzem Aufenthalt auf dem Bahnsteig packten sie mich und ihre anderen Habseligkeiten und gingen durch das Bahnhofsgebäude vorbei am Schalter des Fahrkartenverkäufers auf die Dorfstraße. Dort standen sie nun vor ihnen die große Eiche und dahinter der Dorfkrug, rechts und links ein paar rot glänzende Backsteinhäuschen und hinten am Horizont, zwischen Bäumen erkennbar, ein kleiner weißer Kirchturm.
„Was wollen wir hier“, würde ich meine Eltern heute fragen. Vielleicht fragten sie sich das auch, wer weiß?
Doch jetzt war es zu spät. Hinter sich alle Brücken abgebrochen, mussten sie genau hier neu anfangen, denn das letzte Geld ging für die Fahrkarten drauf. So entschied am Ende ihr Portemonnaie, was zu meiner Heimat werden sollte.
Mutter erzählte mir später, wie dort alles angefangen hat ...
„Kann ich Ihnen helfen“, fragte eine kräftige, aber doch angenehme Stimme die zu einem vornehm wirkenden Mann auf einer Kutsche, welche vor dem Bahnhof anhielt, gehörte.
"Ja können Sie, wir brauchen eine Bleibe, Arbeit und Freunde, danke“, antwortete Mutter forsch.
„Hahaha“ dröhnte die Stimme. „Gestatten Herr von Schlütte. Sie haben aber Schneid, gnädige Frau. Nun, eine Bleibe habe ich für Sie, Arbeit auch. Nur Freunde, die müssen Sie sich gefälligst selbst suchen“, sprach er schelmisch und ergänzte, „Kommen Sie in zwei Stunden auf mein Gut und wir schauen, was wir machen können“.
Sprachlos blieben meine Eltern zurück, als der ältere edle Herr seine Fahrt fortsetzte.
Bevor wir zum Gutshof gingen, erklärte uns der Bahnhofsvorsteher den Weg, ohne gefragt worden zu sein, denn die Neugierde ließ ihn das Gespräch mithören und kaum war der Herr abgefahren, stand er hinter meinen Eltern und sprach „Schüssel wie Topf mein Name, gehnse einfach da runter an de Weide vorbei, lasse se de kleinen Wech links liege, immer weiter. Hinner de lange Kurve erscheint es Schlössje, gehnse los, is schon e Strecke“.
Mit einem Lächeln im alten dürren Gesicht sprach er weiter „Lasse se eier Sache do, kommse später hole, ich laaf net weg“.
Meine Eltern nahmen das Angebot dankend an und machte sich auf den Weg zu dem Gut. Ich denke, damals haben sie in jenem Moment Ihren ersten Freund gefunden, denn in den folgenden Jahren hat uns Herr Schüssel immer wieder besucht, um mit meinen Eltern stundenlang über das Geschehen der Zeit mit seinen ganz eigenen Ansichten zu debattieren.
Oft kam Herr Schüssel mit seinem alten Fahrrad zu uns gefahren, über den staubigen Weg den wir damals links liegen lassen sollten. In der Nacht fuhr er dann in Schlangenlinien denselben Weg zurück nach Hause.
Meine Eltern liebten solche Abende, an denen über alles gesprochen werden durfte.
So gingen Sie den Weg hinab durch eine wunderschöne sommerliche Landschaft, neben ihnen, dass im Wind sanft wehende Getreide und dem gegenüber die riesigen Weidenbäume, deren grünes Kleid sich mit der Frucht auf dem Acker um die Wette zu wogen schien.
Hinter den Bäumen, Wiesen so weit das Auge reicht, tiefgrünes Gras, auf dem sich eine Handvoll Rinder tummelte, die Aussicht vollendet von einem farbenreichen Waldrand. Am Ende der Welt ist es so schön und man scheint unsichtbar zwischen all dem Wundersamen. Noch zumindest.
Am Gutshaus angekommen, erschien die Anlage meinen Eltern wie ein weiteres Dorf. Hinter einem schmiedeeisernen Tor, welches von einer aus dem Nichts kommenden und ins Nichts gehenden Sandsteinmauer gehalten wurde, entfaltet sich ein eigener Kosmos mit großen und kleinen Gebäuden, alle eingebettet in einen Park, gekrönt von einem herrschaftlichen Gutshaus. Viele verschiedene Hecken und Bäume spendeten immer wieder schattige Plätze und erfüllten durch ihre verschiedenen Farben und Formen den Ort mit einer Aura wie auf einem Gemälde aus eines Meisters Hand.
Meiner Eltern sagten mir, dass sie sehr beeindruckt waren, obwohl sie diesen Lebensstil eher ablehnten.
Sie gingen durch das Tor den Kiesweg entlang weiter Richtung Haupthaus und dort sahen sie, seitlich erscheinend, den älteren Herrn von eben auf der großen Eingangstreppe stehen. Seinen weißen Hut ziehend verharrte er in der Pose mit leicht schrägem Kopf, bis meine Eltern und ich, aus einer langen Kurve kommend, unten an der Treppe ankamen.
„Guten Tag, da sind Sie ja endlich“, sagte er freundlich.
„Entschuldigen Sie, äh sind wir etwa zu spät, oder ...?“, stammelte mein Vater.
„Nein, nein, ich bin nur manchmal ungeduldig“, erwiderte der Hausherr.
„Kommen Sie rein, Hilda hat Tee gemacht, wir setzen uns in den Salon, darf es für den Kleinen etwas Milch und ein paar Kekse sein. Hilda macht die besten Kekse“, kam ein Wort nach dem anderen von unserem Gastgeber.
„Danke, machen Sie sich bitte keine Umstände“, erwiderte meine Mutter.
„Das sind doch keine Umstände“, widersprach Herr von Schlütte.
„Los Hilda, bring uns eine Stärkung, hopp, hopp“, raunte er zu der etwas pummeligen, in Spitze gekleideten Haushälterin, deren Backen rund und rot wie leckere Äpfel aussahen.
Ohne nur mit der Wimper zu zucken, verschwand sie durch eine riesige weiße Flügeltür. Dabei war ein leises Gemurmel von ihr zu hören.
„Was kann ich für Sie tun“, fragte der Freiherr, der mittlerweile in einem reich bestickten Ohrensessel Platz nahm.
„Oh wie unhöflich, nehmen Sie doch Platz“, fügte er hastig hinzu.
Meine Eltern ließen sich auf dem rechts hinter ihnen stehenden Sofa nieder und ich, so meine Mutter später, saß dort auch schon ohne Aufforderung.
„Nun, wie meine Frau schon sagte, wir bräuchten Arbeit und ein Dach über dem Kopf“, sagte mein Vater mit leiser Stimme.
Normalerweise hat er keine leise Stimme, sondern eine laute, kräftige, immer optimistische Stimme. Doch diesmal, wohl beeindruckt von der Situation, schien es anders.
Kaum hatte Vater fertig gesprochen, kam aus der Tür, aus der sie gegangen war, die Haushälterin zurück. Vor ihr ein großes silbernes Tablett mit allerlei Tassen und Kannen und einem Berg von Keksen darauf.
„Da bist du ja endlich, wir warten schon“, sprach Herr von Schütte zu der unter der Last schnaufenden Haushälterin.
Diese ließ sich nicht beeindrucken und stellte auf einem dunklen, glänzenden Tisch Ihre Last ab. Kaum fertig verschwand sie wieder murmelnd in der besagten Tür, aber nicht ohne vorher Tee in die Tassen gefüllt zu haben.
„Nicht doch, wir können doch selber ...“, versuchte meine Mutter sie noch davon abzuhalten, aber ohne Erfolg.
„Ich habe und sie brauchen“, tönte der alte Herr, der dabei in seiner Tasse rührte, ohne vorher Milch oder Zucker hinein gegeben zu haben.
„Einer meiner Höfe steht seit Kurzem leer und müsste schnellstmöglich wieder vergeben werden. Sie scheinen mir geeignet. Die Ernte muss bald rein und das Haus geheizt werden, dass können Sie doch? Zum Haus gehören auch ein Stall, zwei Ochsen, ein Pferd, eine Kuh, ein paar Hühner und allerlei Arbeitsgeräte. Über die Pacht sprechen Sie mit meinem Verwalter“, sprach der Freiherr.
„Aber Sie wissen ja noch nicht mal unseren Namen“, sagte meine Mutter.
„Sie haben recht, aber nützt mir denn ihr Name was?“, fragte der Herr.
„Nun, ich glaube nicht, aber ...“, probierte mein Vater zu ergänzen.
„Sehen Sie! Den Rest machen Sie mit Herrn Eberhard, der kommt auf Sie zu. Eckhard wird ihnen den Weg zeigen, guten Tag“, unterbrach ihn der alte Kauz.
Kaum gesagt verschwand auch er, ohne auch nur vom Tee gekostet zu haben, in derselben Tür wie seine Bedienstete.
Die Situation noch nicht verstanden, stand plötzlich ein hagerer, großer Mann in der Tür. Mit strengem Blick und gekleidet wie ein Bauer stand er im Türrahmen und schaute uns grimmig an.
„Herr Eberhard“, fragte mein Vater vorsichtig.
„Eckhard. Ich zeige Ihnen den Hof, Herr Pächter“, kam es aus dem Mann mit sanfter, fast weicher Stimme.
Ungläubig standen meine Eltern auf, schnappten mich an der Hand und zerrten mich von dem Teller Keksen weg, an dem ich mich schon reichlich bedient hatte.
Meine Mutter erzählte mir später, dass ich damals der Einzige war, der sich am Teetisch gestärkt hätte.
Sie erzählten mir weiter, dass Eckhard uns aus dem Haus führte. Vorbei an zwei großen Doggen, die im weitläufigen Flur, der eher an eine Eingangshalle erinnerte, dösend das Treiben beobachteten.
„Hasso, bleib“, sagte Eckhard plötzlich mit kräftiger Stimme, als einer der beiden Hunden seinen Kopf hob und den Anschein weckte, er wolle aufstehen.
Kaum hatte Eckhard ausgesprochen, senkte der Hund auch schon wieder sein Haupt. Vor dem Haus stand eine Kutsche, was sie noch nicht tat, als wir ins Haus gingen, auf der Pritsche unsere Sachen.
„Darf ich Sie nun auf Ihren Hof fahren“, surrte Eckhard beim Aufsteigen.
Stumm stiegen meine Eltern mit mir auf die Kutsche. Als wir vom Gut fuhren, kam uns ein junges Pärchen in einem Horch 853 Sport Cabriolet entgegen. Mein Vater schwärmte lange von diesem Augenblick, als er das erste Mal dieses Auto sah. Diese beispiellose Eleganz, die weit noch hinten gezogenen Kotflügel, die das Auto vorne bullig und hinten schmal machten, ließen ihn nicht mehr los. Wie gerne wäre er auch einmal solch ein Auto gefahren.
Wie ich später erfuhr, saßen damals wohl Amelie und Balthasar von Schlütte, Sohn und Erbe von Franz von Schlütte in dem wundervollen Wagen.
Ihr gemeinsamer Sohn Harald sollte einmal mein bester Freund werden!
Als Auto und Kutsche aneinander vorbei fuhren, griff Eckhard hektisch zu seiner Mütze und nahm sie vom Kopf, unterstützt von einem kräftigen nicken.
Wir fuhren den Weg zurück, den wir gekommen waren. Vorbei an den Bäumen und Feldern bis zu dem Weg, den wir nicht nehmen sollten und in diesen bog die Kutsche ab. Von nun an wurde die Fahrt ungemütlicher und ich hob bei jedem Schlagloch ein Stück von der Sitzbank ab, erzählte mir mal Vater.
Zwischen endlosen Feldern, auf denen goldgelbes Getreide stand, schien die Fahrt endlos zu sein. Doch langsam erkannte man am blauen Horizont die Spitzen von herrlich grünen Birken.
Und als dieser grüne Tupfer immer größer wurde, entdeckte meine Vater darunter ein kleines Gebäude, einem Wohnhaus mit Scheune oder Stall ähnelnd. Als wir ankamen, sahen wir, dass auch unser Gut ein Tor hatte, eher ein Bretterzaun, aber ein Tor. Auch die noch erkennbare Mauer um das Gehöft war mehr als endlich.
Alles, was ich hier erzähle, lebt in meinen Gedanken, als sei ich dabei gewesen. Nun, ich war ja dabei, doch erinnern kann ich mich nicht. Ich habe das alles so oft von meinen Eltern erzählt bekommen, dass ich es sehen kann.
Da standen wir nun vor unserem neuen Leben. Vor wenigen Stunden stiegen wir aus dem Zug und wussten nicht, wo wir die nächste Nacht verbringen sollten und jetzt hatten wir Land und Vieh. Doch war es so einfach?
Manchmal ja!
Meine Eltern waren wohl zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Zufall, Schicksal, Fügung, wer weiß, ich weiß es nicht. In dem Augenblick, als meine Eltern staunend und nicht fassend vor dem Hof standen, lud Eckhard das Gepäck ab und eh man sich versah, fuhr er weiter, ohne auch nur ein Wort der Verabschiedung.
„Sollen wir reingehen“, fragte meine Mutter, ohne dabei ihre Augen vom Gebäude abzuwenden.
„Warum nicht!“, antwortete mein Vater. Sein Blick auch zum Haus gewandt.
So gingen wir zum Eingang, der nicht abgeschlossen war. Langsam öffnete mein Vater die knarrende Tür ein Stück und streckte durch den Spalt seinen Kopf und je weiter er sie öffnete, je mehr rückte er mit seinem Körper nach.
"Hallo, Haaalloo“, machte er auf sich aufmerksam.
Meine Mutter dränge von hinten, ihre eine Hand auf der Schulter meines Vaters, die andere Hand auf der meinen.
Mehr oder weniger drückte sie meinen Vater immer weiter ins Haus und mich zog sie hinterher.
Hinter der Eingangstür befand sich ein langer schmaler Flur, der durch die links befindliche Treppe, die zum ersten Stock führte, noch schmaler wirkte. Gegenüber dem steilen Treppenaufgang befand sich die Küche. Ein Raum mit hölzernem Küchenschrank, einem Tisch, vier Stühle und einer Anrichte, die neben einem alten, aber schönen Holzofen stand, auf dem sich noch ein Topf befand. Durch die Glasscheiben des Schrankes erkannte man einen Stapel Teller und ein paar Becher. Neben dem Ofen war eine Tür, deren weißer Lackbezug schon an einigen Stellen abblätterte. Nach näherer Betrachtung stellte mein Vater fest, dass es sich um einen Vorratsraum handelte. Dies war nicht schwer zu erkennen, da sich auf den Regalböden noch allerlei Eingemachtes und in einer Ecke ein kleiner Berg Kartoffeln befand. Ging man den Flur weiter an der Treppe vorbei, gelangte man in den letzten Raum des Erdgeschosses. Es war die Wohnstube, vielleicht vier Meter breit und noch etwas länger. Gegenüber der Tür an den Außenwänden, zwei Sprossenfenster aus Holz, auch weiß gelackt. Die Scheiben waren schon recht blind und arg verstaubt.
In einer Ecke ein schmaler Ofen, dessen Ofenrohr schräg und improvisiert in die Wand ragte.
Auch hier befand sich ein Schrank, ein Tisch mit Stühlen und an der Wand neben dem Ofen stand eine kleine Couch mit dunkelrotem, samtigen Bezug.
Ging man die Treppe hinauf, kam man in einen winzigen Flur. Rechts und links je eine Tür und an der Stirnseite eine kleine Waschküche, in der eine gusseiserne Wanne stand und allerlei Schnüre für Wäsche gespannt war.
Beide Räume waren je mit einem Bett und einem einfachen Schrank ausgestattet. Der kleinere Raum sollte mein Zimmer werden.
Im ganzen Haus befand sich außer zum Teil zerfransten Tapeten, auch allerlei Bilder an den Wänden. Fotos von alten Menschen, gemalten Landschaften und ein paar Heiligenbilder. Alles fremd, alles alt und tot.
Im Laufe der nächsten Jahre werden meine Eltern nichts Grundlegendes ändern, aus Respekt. Doch wandelte sich das verlassene Haus mehr und mehr zu einem Heim, in dem es wieder Leben gab.
Vor dem Haus war ein gemauerter Brunnen, welcher wohl zu unserer Wasserversorgung dienen sollte. Im Stall neben dem Haus waren die Gatter mit frischem Stroh ausgelegt, in den Raufen war Heu. Aber die Tiere fehlten.
Über den Stallungen auf dem Heuboden quoll Heu und Stroh aus allen Ritzen und Spalten, eine schmale hölzerne Leiter führte dort hinauf.
„Wo sind die nur“ stammelte Vater vor sich hin gelehnt an die Leiter zum Heuboden.
Dabei meinte er nicht die Tiere, nein, sondern die Menschen, die hier lebten und die scheinbar alles stehen und liegen gelassen hatten und gingen.
„Die hatten die Schnauze voll“, tönte es plötzlich in dem Stall.
Als Vater sich umdrehte, stand ein dicker Mann mit kariertem Sakko und Batschkappe hinter ihm. Enge schwarze Reiterstiefel ließen den Herrn wie ein Kastanienmännchen aussehen. Hinter ihm meine Mutter mit mir auf dem Arm, meinen Vater fragend anschauend.
„Ich bin der Verwalter. Herr von Schlütte teilte mir mit, dass er neu Pächter gefunden hat. Ich soll Ihnen den Pachtvertrag aushändigen und die Tiere bringen lassen“, fuhr er fort.
„Ich komme die Durchschrift morgen abholen. Sie können doch lesen, oder? Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, nehmen sie das Angebot an“, sagte er und ging während er noch sprach durch das Scheunentor zu seinem Pferd, welches er an einem Pfosten festgemacht hatte.
„Karl, lass uns verschwinden, hier stimmt was nicht“, seufzte meine Mutter und lehnte ihren Kopf an den Oberarm meines Vaters.
„Nein, warum? Wir haben nichts getan! Die brauchen neue Pächter. Gut! Wir sind da. Mach dir keine Sorgen, ist alles gut“, tröstete er sie.
Und genau an diesen Moment kann ich mich seltsamerweise selbst erinnern. Den Moment, als Mutter in Vaters Arm lag und ich an Ihrem Rockzipfel zog in der halbdunklen Scheune, an einem Sommerabend am Ende der Welt.
Bilder aus der Erinnerung
Wenn man in seinen Erinnerungen kramt, entstehen Bilder von dem gedachten Moment. Irgendwie wird es wieder real fühlbar und dies ist das Schöne an Erinnerungen. Alles was war, ist, nur anders an einem anderen Ort, in unserem Kopf. Alles um uns ist auch in unserem Kopf, dort wird es zusammengefügt und wahrnehmbar. Die Vergangenheit, Gegenwart und vielleicht unsere Zukunft ist dort gespeichert. Aus diesem Schatz habe ich ein paar Skizzen gefertigt, damit auch andere mein Erlebnis wahrnehmen können.
Unser Hof
Kapitel 2 Jahr um Jahr
Ich war zwei Jahre, als wir hier ankamen. Am Abend der Ankunft brachte Eckhard mit weiteren Knechten die Ochsen, die Kuh und das Pferd zurück. Auch die Hühner wurden gebracht. Alles, wie es von Herrn von Schlütte versprochen wurde. In den folgenden Jahren wuchsen meine Eltern und ich immer mehr in unser neues Leben hinein. Vater entwickelte sich zunehmend zu einem Landwirt und meine Mutter ging in der Rolle der Bäuerin regelrecht auf. Auch mir gefiel mein Leben, ich kannte ja kein anderes.
Besonders die Sommermonate sind mir in Erinnerung.
Jene Abende im Hof, an dem Vater ein Feuer entzündete und Mutter fröhlich ausgelassen vor diesem saß und lauthals Lieder aus ihrer Jugend sang. Vater klimperte dazu auf seiner Gitarre und versuchte ihm bekannte Zeilen mitzusingen. Kartoffeln lagen in der Glut, die wunderbar orange leuchtete und unzählige Funken stiegen zum tiefschwarzen, mit Sternen durchzogenen Nachthimmel auf, als wollten sie sich zu den Sternen gesellen. Um uns Dunkelheit, unsere Sicherheit war das erhellende Feuer, dessen Lichterspiel an der Hauswand flackerten. Der Rauch schmerzte in den Augen und erschwerte das Atmen. Dieser bittersüße Schmerz, das Lachen und Grölen schenkte einem das unbeschreibliche Gefühl von Freiheit, ein Gefühl, welches nur ein Sommerabend am Lagerfeuer erwecken kann.
So verging Tag um Tag auf den Sommer folgte der Herbst nach diesem der Winter. Unser leben richtet sich nach der Natur weniger nach dem Kalender, erst recht nicht nach der Uhr.
Vater säte, er erntete und er säte wieder. Das war der Rhythmus, nach dem wir lebten. Es gelang meinen Eltern sogar, einen sehr bescheidenen Wohlstand aufzubauen, sodass sie auch wieder künstlerisch tätig werden konnten. Ihrer wahren Berufung, immer noch.
Es schien, als hätte uns die Welt vergessen, umgekehrt taten wir dies schon lange. Das Dorf und unser Hof war alles, was wir brauchten. Im Dorf konnten wir kaufen und verkaufen. Besonders ein Tag, viele Jahre waren schon vergangen, blieb mir in Erinnerung.
Ich fuhr mit meinem Vater auf dem Ochsenkarren zu Schulzes Laden.
Oskar Schulze war der Gemischtwarenhändler im Dorf.
In seinem Laden fand man besonders als Kind allerlei interessante Sachen. Von Süßigkeiten über Spielereien bis hin zu Geheimnisvollem. Herr Schulze hatte alles.
Vater verkaufte dort einen Teil von unserem Getreide, Milch, Eier, eben alles, was wir zu verkaufen hatten.
Herr Schulze kaufte solche Produkte von uns und anderen Bauern und verkaufte sie dann weiter.
So geschah es, dass wir auch an jenem Tag zu dem Laden fuhren, um Milch abzugeben und auch um einzukaufen.
Als wir am Laden ankamen, war Herr Schulze vor demselben und kehrte den schmalen gepflasterten Bürgersteig vor dem Schaufenster entlang. Vater hielt den Karren vor dem Laden an und sprang mit einem lauten „Tag Herr Schulze, wir haben was für Sie“, ab.
„Ach, schau mal an. Lebt ihr auch noch“, polterte Schulze zurück.





























