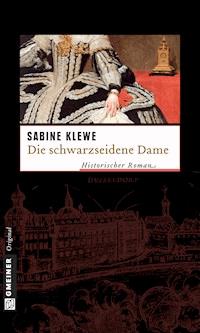Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Fotografin Katrin Sandmann
- Sprache: Deutsch
Fast zeitgleich werden in Düsseldorf zwei Leichen gefunden. Anwaltsgattin Claudia Heinrich beging offensichtlich Selbstmord und Bierbrauer Andreas Schäfer hatte einen tragischen Arbeitsunfall. Nichts deutet darauf hin, dass es zwischen den beiden Vorfällen einen Zusammenhang geben könnte. Dann aber stirbt noch jemand. Und diesmal ist es eindeutig Mord. Haben die drei Todesfälle womöglich doch etwas miteinander zu tun? Ist es bloß ein Zufall, dass alle drei Opfer erstickt sind oder treibt in Düsseldorf ein wahnsinniger Serienmörder sein Unwesen? Amateurdetektivin Katrin Sandmann begibt sich wieder auf Spurensuche, und ihre Ermittlungen führen sie zurück in das Jahr 1977 und zu einem grauenvollen Verbrechen, das nie gesühnt wurde …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sabine Klewe
Kinderspiel
Der zweite Fall für Katrin Sandmann
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2005 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Satz/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © photocase.de
ISBN 978-3-8392-3204-0
Widmung
Für Gerda
1
Im Grunde ist fast jeder gewaltsame Tod ein Erstickungstod. Dem Opfer bleibt im wahrsten Sinne des Wortes die Luft weg. Das Gehirn und die inneren Organe werden mit Sauerstoff unterversorgt, bis die Körperfunktionen schließlich zusammenbrechen. Wird die Sauerstoffzufuhr vollständig unterbrochen, tritt schon nach etwa zehn Sekunden Bewusstlosigkeit ein, und nach wenigen Minuten ist das Gehirn irreversibel geschädigt.
Die Möglichkeiten, den Sauerstoffmangel herbeizuführen, sind nahezu unbegrenzt; Erwürgen, Erdrosseln, Erhängen und Ertrinken sind alles letztendlich Variationen des Erstickens. Auch manche Gifte, wie etwa Curare oder Zyankali, verschlagen einem schlichtweg den Atem. Und sogar an einem Lungenschuss erstickt man.
Fast jede zweite Selbsttötung findet durch Sauerstoffentzug statt. Allerdings gibt es nur sehr wenige Morde, bei denen das Opfer erstickt wird. Wenn es um fremde Menschen geht, werden offensichtlich andere Formen des Tötens bevorzugt. Ersticken ist also die Todesart der Selbstmörder. Meistens jedenfalls.
Er wusste alles über das Ersticken, hatte Nachschlagewerke der forensischen Medizin gewälzt, Fachzeitschriften studiert und sich im Institut für Rechtmedizin in den Hörsaal geschmuggelt, wenn eine Vorlesung zum Thema Erstickungstod anstand. Er hatte es sogar ausprobiert, an sich selbst, die Zeige- und Mittelfinger auf die Halsschlagadern gepresst, das Schwindelgefühl genossen und die sanfte, süße Euphorie, die der Sauerstoffmangel auslöst.
Was das Erstickenanging, kannte er sich aus wie kein zweiter. Da machte ihm niemand etwas vor.
Ein funkelnder Sternenteppich spannte sich über den Rhein, und der Mond tauchte den Fluss in gespenstisches Licht. Ein einsamer Steinkauz auf Beutejagd stieß einen gellenden Schrei aus. Vom anderen Ufer sah die hell erleuchtete Altstadt wie eine Ansammlung von Spielzeughäuschen aus, die jemand liebevoll aufgebaut hatte. Die Menschen, die dort in den Gassen spazierten oder mit einem Glas Bier vor einer Kneipe standen und tratschten, sahen jedoch weder den Mond, noch hörten sie den Steinkauz. Und auch der junge Mann, der im Gärkeller der Brauerei zugange war, bekam von alledem nichts mit.
Mit sicheren, routinierten Handbewegungen rollte er den Wasserschlauch auf und deponierte ihn auf dem Fußboden. Dann griff er nach der Leiter, hievte sie über den Rand und platzierte sie auf dem Grund des tiefen, silberfarbenen Tanks. Er schnappte sich die Kerze, die vor seinen Füßen stand, und zündete sie an. Vorsichtig beugte er sich ein letztes Mal vor und atmete tief ein. Alles in Ordnung. Die Luft war frisch und sauerstoffhaltig. Das Wasser aus dem Schlauch hatte das Kohlendioxyd aufgewirbelt und der Ventilator in der Ecke des kleinen Gärkellers hatte es abgesaugt. Er warf einen Blick auf den CO2-Gas-Detektor an der Wand. Das Gerät zeigte 0,7 Volumen Prozent an. Ein guter Wert. Er konnte einsteigen. Die Kerze in der Hand, schwang er sich behutsam über den Rand und kletterte Stufe für Stufe die Leiter hinunter. Er setzte sie auf dem Grund des Bottichs ab und stieg nochmals hinauf, um den Eimer mit dem Putzzeug und den Schrubber zu holen. Dann stellte er das Putzzeug ebenfalls auf den Boden. Nur den Schrubber behielt er in der Hand. Mit einem kurzen Blick auf das kleine Gerät, das an seinem Gürtel befestigt war, vergewisserte er sich, dass wirklich alles okay war. Hier unten waren 0,9 Volumen Prozent Kohlendioxyd in der Luft. Auch das war noch in Ordnung.
Er richtete sich auf und ließ seinen Blick kreisen. Kritisch musterte er die silberfarbenen Wände des Bottichs. Er seufzte. Die Ränder waren wie immer dunkelbraun verfärbt und dick verkrustet. Die Hefe hatte ihre Spuren hinterlassen. Als er beschlossen hatte, Bierbrauer zu werden, hätte er niemals gedacht, wie viel von dieser Arbeit aus Putzen, Schrubben und Blankwienern bestand. Seinen halben Arbeitstag verbrachte er damit, die Sudpfannen, Lagertanks und Gärbottiche zu reinigen. Trotzdem liebte er seinen Beruf, den Duft nach jungem, würzigem Bier, das verwinkelte, altmodische Brauhaus und seinen Arbeitsplatz mitten in der Düsseldorfer Altstadt zwischen teuren Boutiquen, argentinischen Restaurants, Antiquariaten und unzähligen Kneipen, aus denen bei schönem Wetter die Menschen auf die Straße quollen, so dass man das Gefühl hatte, sich in einem überdimensionalen Ameisenhaufen zu befinden. An solchen Tagen roch die Altstadt, als läge sie am Mittelmeer und nicht am Rhein, nach Knoblauch, frisch gegrillten Speisen und Sonne.
Ein eindringlicher Piepston riss ihn aus seinen Gedanken. Verwirrt blickte er hinunter auf seinen Gürtel. Der Detektor zeigte jetzt 2,3 Volumen Prozent an. Hastig glitt sein Blick zu der Kerze, die auf dem Boden des Bottichs stand. Sie brannte ruhig. Verwirrt klopfte er mit der Fingerspitze auf den kleinen Gas-Detektor. Das Gerät hatte in letzter Zeit ein paar Mal verrückt gespielt. Irgendwas war damit nicht in Ordnung. Er beschloss, das hartnäckige Piepsen zu ignorieren. Mit fester Hand umfasste er den Schrubber und wollte auf den Putzeimer zugehen, als ein plötzlicher Schwindel ihn erstarren ließ. Ihm war schummerig, seine Schläfen pochten und er hörte sein eigenes Blut unnatürlich laut in seinen Ohren rauschen. Wieder wanderte sein Blick zu der Kerze am Boden, diesmal langsam, wie in Zeitlupe, denn jede Bewegung fiel ihm mit einem Mal unendlich schwer. Die Flamme flackerte unruhig, dann erlosch sie. Ein hauchdünner Rauchfaden schlängelte sich am Docht empor. Immer noch ertönte der Piepston in regelmäßigen Abständen an seinem Gürtel.
Das konnte doch gar nicht sein. Er war immer noch irritiert. Er hatte gerade erst alles ausgespült. Und er erinnerte sich genau, dass er den Ventilator angestellt hatte, der das Kohlendioxyd aus dem kleinen, engen Gärkeller absaugte. Oder doch nicht? Er spürte, wie ihm der Schweiß ausbrach und in winzigen Tröpfchen seine Schläfen und seinen Rücken hinunterperlte. Er machte einen unsicheren Schritt auf die Leiter zu, aber seine Beine wollten ihm nicht gehorchen. Panik stieg in ihm auf und rollte durch seinen schwitzenden Körper wie eine heißkalte Flutwelle. Er wusste, dass er nur noch wenige Sekunden hatte, bis die Bewusstlosigkeit einsetzen würde. Übelkeit breitete sich in seinem Magen aus.
Wieder zwang er sich, einen Schritt zu machen, aber seine Beine waren schwer wie Blei. Sein Atem ging schneller. Vor seinen Augen tanzten bunte Lichtpunkte. Er versuchte zu schreien, brachte aber nur ein heiseres Krächzen hervor. Ein dunkelgrauer Nebel legte sich vor sein Blickfeld. Die rettende Leiter verschwand hinter einer undurchdringlichen Wolke. Seine Beine knickten ein. Er japste hektisch und riss den Mund auf wie ein Fisch auf dem Trockenen. In seinem Kopf drehte sich alles. Dann ergriff die Benommenheit von ihm Besitz. Das Gefühl war merkwürdig, sogar angenehm, beinahe wie fliegen, fast schwerelos.
Er versuchte nun nicht mehr, die Leiter zu erreichen. Für den Bruchteil einer Sekunde streifte ein Lächeln seine Züge. Dann wurde es langsam dunkel. Was für ein lächerlicher Tod, war das Letzte, das er dachte. Er spürte nicht mehr, wie er auf dem harten Boden des Gärbottichs aufschlug.
Katrin Sandmann rührte in ihrer Tasse. Sie beobachtete den Mann, der ihr gegenüber am Frühstückstisch saß und temperamentvoll gestikulierend eine Geschichte erzählte, während er gleichzeitig ein üppiges Frühstück in sich hineinschaufelte. Sie fragte sich, wieso er jedes Mal zuerst ein dickes Stück von seinem Brötchen abbiss, bevor er anfing zu reden. Manfred Kabritzky erzählte und kaute gleichzeitig. Seine Augen leuchteten vor Begeisterung und das Marmeladenbrötchen in seinen Händen schwankte gefährlich über der Tischdecke. Katrin musste lächeln. Im Anfang hatte sie seine ungestüme Art verabscheut, hatte ihn für oberflächlich und selbstgefällig gehalten. Aber mittlerweile kannte sie ihn besser. Sie wusste, dass dieses oft ungeschickte, überschäumende Temperament Teil seiner Warmherzigkeit, seiner Menschlichkeit war, und sie sah ihm gern zu, wenn er ganz aufging in einer Geschichte, fast wie ein kleines Kind, das über einer einzigen Sache, die ihm gerade wichtig ist, alles andere vergisst.
Sie hatte eine Weile gebraucht, um das zu begreifen. Sie erinnerte sich noch genau an ihre erste Begegnung auf dem Korridor des Polizeipräsidiums vor gut einem Jahr. Er hatte sie beinahe über den Haufen gerannt, und sie hielt ihn für den ungehobeltesten und arrogantesten Menschen, der ihr je begegnet war. Dann hatte sie ihn sogar des Mordes verdächtigt. Und selbst nachdem sie den wahren Täter gefunden hatte, war sie auf Distanz geblieben, vorsichtig. Misstrauisch. Aber Manfred war ausdauernd und hartnäckig. Er ließ sich nicht so leicht abwimmeln, und mittlerweile war er zu einem festen Bestandteil ihres Lebens geworden, das er bisweilen gehörig aufmischte.
»Hörst du mir überhaupt zu?«
Manfred legte das angebissene Brötchen auf den Teller und verschränkte in spielerischem Zorn die Arme vor der Brust.
»Ich rede wohl wieder zu viel, was?«
Katrin schüttelte den Kopf und lächelte erneut.
»Du weißt, dass ich dir gern zuhöre.«
Er warf ihr einen immer noch misstrauischen Blick zu und wollte gerade wieder nach seinem Brötchen greifen, als sein Handy klingelte. Katrin beobachtete wie seine Gesichtszüge sich verwandelten, während er lauschte. Manfred war Journalist, er arbeitete als Reporter für die Lokalredaktion einer Düsseldorfer Zeitung. Wenn sie seinen Blick richtig deutete, dann hatte er soeben etwas Interessantes erfahren. Vermutlich würde er gleich aufgeregt aufspringen, alles stehen und liegen lassen und ohne viele Erklärungen aus der Wohnung stürmen.
Manfred legte das Telefon weg und trank in hastigen Schlucken seinen Kaffee aus. Dann schob er den Stuhl zurück. Er eilte mit langen Schritten in die Diele und stieg in seine Schuhe. Katrin wartete. Sie wusste, dass sein Mitteilungsbedürfnis größer war als ihre Neugier. Vermutlich handelte es sich sowieso nur eine von diesen unsäglichen Klatschgeschichten, auf die sie gern verzichten konnte. Manfred kam in die Küche zurück. Er hatte sich die alte, abgewetzte Ledertasche über die Schulter gehängt, die er auch schon dabei gehabt hatte, als sie sich das erste Mal begegnet waren. Sie hatte seinem Vater gehört, der auch Journalist gewesen war. Manfred schnappte sich das Handy und stopfte es in die Tasche. Katrin stand auf.
»Und wer räumt das hier weg?« Sie deutete auf den überladenen Frühstückstisch und fixierte ihn herausfordernd.
»Lass stehen. Ich mach das später.«
Er hastete zur Tür. Dann drehte er sich noch einmal um.
»Kennst du eigentlich Claudia Heinrich? Das ist die Frau von diesem Staranwalt, Thomas Heinrich. Hat der nicht beruflich mit deinem Vater zu tun?«
»Klar kenne ich die. Meine Eltern sind mit den Heinrichs befreundet. Schon seit Jahren. Thomas Heinrich hat mit meinem Vater zusammen studiert. Er ist fast so was wie ein Onkel für mich. Als ich ein kleines Mädchen war, hat er mir manchmal abends Gruselgeschichten erzählt. Die waren wahnsinnig spannend.«
Katrin stockte.
»Warum fragst du? Was ist passiert?«
Manfred zuckte die Schultern. »Ich weiß noch nichts Genaues. Aber es sieht so aus, als hätte Claudia Heinrich sich umgebracht.«
Er rauschte davon, knallte die Tür ins Schloss und ließ Katrin allein mit einem Haufen wirrer Erinnerungen an eine dunkelhaarige, schweigsame Frau, die ihr immer ein wenig unheimlich gewesen war, und die sie als Kind in Gedanken manchmal als Hexe bezeichnet hatte, weil sie eine so dunkle Stimme hatte und eine lange, leicht gebogene, unglaublich faszinierende Nase.
2
Hauptkommissar Klaus Halverstett hörte ein Auto mit quietschenden Reifen am Bordstein halten. Er drehte sich um und sah Manfred Kabritzky aus seinem grünen Geländewagen klettern. Der Polizeibeamte war gerade im Begriff gewesen, selbst in sein Auto zu steigen, hielt aber jetzt inne. Er kannte den Journalisten seit Jahren, und er mochte ihn, auch wenn ihm seine penetrante Art bisweilen auf die Nerven ging. Er streckte ihm die Hand entgegen.
»Vor dir ist man wohl nirgends sicher«, scherzte er.
»Morgen, Halverstett.« Manfred schüttelte ihm kräftig die Hand. »Und? Ist es Selbstmord? Gibt es einen Abschiedsbrief? Was sagt ihr Mann?«
Der Kommissar seufzte. »Du Aasgeier. Schämst du dich eigentlich nicht?« Dann nickte er. »Ja, es war wohl Selbstmord. Sie war offensichtlich seit Jahren depressiv. Wir haben keinen Brief gefunden, aber jede Menge Antidepressiva. Ihr Mann hat uns erzählt, dass sie wegen Schlafstörungen und Depressionen in Therapie war. Er ist völlig am Boden zerstört. Er hat sie gefunden. Kein schöner Anblick. Sie war schon seit fünf Tagen tot. Und das bei der Hitze.«
Halverstett starrte in den Himmel, dessen tiefes Blau von keinem einzigen Wölkchen getrübt wurde. Seit einer Woche lähmte eine Hitzewelle das Land. Die Temperaturen kletterten schon am frühen Morgen gefährlich nah an die Dreißig-Grad-Marke, und selbst nachts kühlte es kaum ab. Dabei war bereits der achte September. Der Sommer sollte eigentlich langsam ausklingen, aber das Wetter hielt sich dieses Jahr nicht an den Kalender.
Halverstett fingerte ein Taschentuch aus der Hosentasche und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Er war ein eher etwas behäbiger Mensch, nicht allzu schlank und mit einem leichten Bauchansatz. Er geriet schnell ins Schwitzen. Mit einem lautlosen Stöhnen dachte er an den langen Arbeitstag, der vor ihm lag, in seinem schlecht klimatisierten Büro, und sehnte sich nach seinem Garten in Gruiten, weit außerhalb der Großstadt, wo immer ein kühler Wind ging und wo er im Schatten unter einem Baum liegen und lesen konnte.
Er stopfte das Taschentuch zurück in die Tasche. Kabritzky stand neben ihm und musterte nachdenklich die schicke, exklusive Villa, in deren kiesgestreuter Einfahrt ein Leichenwagen parkte. Er beobachtete, wie zwei Männer einen schlichten Zinksarg auf die Ladefläche hievten.
»Wieso hat es fünf Tage gedauert, bis sie gefunden wurde? Wo war denn ihr Mann?«
»Auf einer Lesereise. Er ist Anwalt und hat vor kurzem ein Buch mit seinen spektakulärsten Fällen veröffentlicht. Natürlich alles mit abgeänderten Namen und reißerisch aufgepeppt. Das verkauft sich wohl wie verrückt. Er ist heute Morgen zurückgekommen.«
»Ach klar. Von dem Buch habe ich gehört. Wollte ich eigentlich auch lesen.« Kabritzky starrte immer noch Richtung Leichenwagen. »Und sonst war niemand hier? Die Heinrichs haben doch sicher Personal?«
»Die Haushälterin hatte eine Woche Urlaub. Sie war bei ihrer Schwester in Köln. Sie ist vorhin überstürzt zurückgekehrt.«
Der Leichenwagen bog aus der Einfahrt und rollte langsam an ihnen vorbei. Manfred Kabritzky sah ihm nach, wie er den Kaiser-Friedrich-Ring entlang fuhr. Die Karosserie blinkte im Sonnenlicht, und dahinter flimmerte der Rhein wie ein schmales, silbernes Band. Die anhaltende Trockenheit hatte ihn auf die Hälfte seiner eigentlichen Breite dezimiert.
»Wie hat sie sich umgebracht?«
»Plastiktüte über dem Kopf.«
Manfred Kabritzky zuckte zusammen. »Etwas ungewöhnlich, oder nicht?« Er zögerte, als Halverstett nicht sofort antwortete. »Ich meine, würde eine Frau wie sie nicht eher eine andere Methode wählen, Tabletten nehmen oder so?«
»Schon möglich«, antwortete der Kommissar bedächtig. Die Sonne knallte auf seinen nur spärlich bewachsenen Schädel, aber der Gedanke an den völlig überhitzten Dienstwagen hielt ihn davon ab, endlich einzusteigen. »So ungewöhnlich aber auch wieder nicht. Es ist ein recht schneller und angenehmer Tod. Kommt häufiger vor, als du vielleicht denkst.«
Kabritzky nickte langsam. Auch ihm standen die Schweißperlen auf der Stirn.
»Eins ist allerdings komisch«, fuhr Halverstett nachdenklich fort. »Die Tüte. Sie gibt uns ein kleines Rätsel auf. Sie stammt von einer holländischen Supermarktkette. Weder Frau Heinrich noch ihr Mann waren jemals in Holland einkaufen, und auch die Haushälterin schwört, dass sie so eine Tüte noch nie gesehen hat.«
Katrin stellte ihr Rad vor dem Antiquariat ab, das schräg gegenüber der Brauerei lag. So früh am Morgen hatte die Altstadt ein völlig anderes Gesicht als abends. Lieferwagen ratterten durch die engen Gassen, Kellner mit müden Augen rückten Tische zurecht und schleppten Bierfässer und Kisten mit frischem Fisch. Sie ließ das Schloss einschnappen und warf einen Blick auf die Uhr. Zwanzig nach neun. Um halb zehn war sie mit Andreas Schäfer verabredet, der sie in der Brauerei herumführen sollte.
Katrin war Fotografin und träumte von einer künstlerischen Karriere. Kürzlich hatte sie einen Bildband über Wales veröffentlicht, auf den sie sehr stolz war. Trotzdem musste sie häufig Aufträge wie diesen annehmen, und Werbeaufnahmen für Prospekte und Broschüren knipsen. In diesem speziellen Fall war es allerdings schon fast wieder eine Ehre, dass man sie als Fotografin ausgewählt hatte. Denn das Brauhaus war eines der berühmtesten in Düsseldorf und weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt.
Katrin ging auf den Seiteneingang zu, der an der Bergerstraße lag. Sie hatte ihre Fotoausrüstung nicht dabei. Heute wollte sie sich erst einmal umsehen und sich einen Eindruck verschaffen, um dann in der nächsten Woche die Aufnahmen zu machen. Sie betrat das Brauhaus. Das Büro befand sich im ersten Stock. Katrin klopfte an und trat ein. Drei ausladende Schreibtische füllten den kleinen Raum fast vollständig aus. Die beiden hinteren waren unbesetzt. Am vorderen saß eine Frau um die dreißig und telefonierte. Sie winkte Katrin herein und bedeutete ihr, an einem kleinen Tischchen in der Ecke Platz zu nehmen. Während die Frau ihr Gespräch führte, blickte Katrin sich neugierig um. Es herrschte ein wirres, sympathisches Stilgemisch. Auf den alten, abgenutzten Schreibtischen standen hochmoderne Computer, und an der Decke hing ein kitschiger, antiquierter Kronleuchter. Die Fenster, die zur Bergerstraße gingen, waren leicht geöffnet, um ein wenig von der morgendlichen Brise hereinzulassen, bevor die Temperaturen wieder unerträglich wurden.
Die Frau beendete das Telefonat.
»Sie müssen Frau Sandmann sein.« Sie stand auf und reichte Katrin die Hand. »Mein Name ist Heubel. Herr Schäfer müsste eigentlich jeden Augenblick kommen. Ich verstehe gar nicht, wo er bleibt. Kann ich Ihnen solange etwas anbieten? Einen Kaffee, ein Wasser?«
Katrin lehnte dankend ab. Frau Heubel begann daraufhin, sich in einen Aktenordner zu vertiefen. Katrin lauschte den Geräuschen aus der Küche, die rechts neben der Treppe lag und wo bereits emsiges Treiben herrschte.
Etwa zehn Minuten später blickte Frau Heubel auf die Uhr.
»Ich verstehe das nicht«, murmelte sie und lächelte Katrin entschuldigend an. »Er hatte gestern bis spät abends zu tun, musste noch den einen Bottich reinigen. Wahrscheinlich hat er ein bisschen verschlafen. Obwohl das eigentlich gar nicht seine Art ist …«
Sie griff zum Telefonhörer und wählte eine Nummer.
»Sag mal, habt ihr den Andy heute schon gesehen? Der sollte eigentlich um halb zehn die Fotografin rumführen.«
Sie hörte einen Augenblick lang zu. »Na, gut«, sagte sie dann. »Sollte er bei euch auftauchen, schickt ihn bitte zu mir hoch, ja?« Sie legte auf und sah Katrin kurz an. Dann wählte sie erneut eine Nummer.
»Das ist sein Handy. Mal sehen, ob er ran geht«, erklärte sie Katrin, während sie dem Rufzeichen lauschte.
Niemand hob ab. Frau Heubel stand jetzt auf. Sie ging zu einem Aktenschrank und zog einen Ordner hervor. »Hier stehen alle seine Termine drin. Er macht ja öfter Führungen durch die Brauerei. Auch für Reisegruppen und so. Vielleicht habe ich die Zeit falsch eingetragen.« Sie blätterte. Dann schüttelte sie den Kopf. »Nein, Donnerstag, achter September, Frau Sandmann, Führung. Hier steht es. Komisch.« Sie stellte den Ordner zurück.
In diesem Augenblick kam ein Mann zur Tür herein. Er war korpulent und trug sein rötliches Haar ein wenig zu lang, so dass es wirr von allen Seiten des Kopfes abstand. Auf der Nasenspitze ruhte eine Brille, deren dicke Gläser seine Augen unnatürlich vergrößerten. In der rechten Hand schwenkte er ein kleines, silbernes Mobiltelefon.
»Ist das nicht Andys?«, fragte er. »Ich hab’s vor dem Gärkeller auf dem Boden gefunden. Aber auch nur, weil es gerade geklingelt hat. Es lag ganz versteckt in der Ecke, hinter einem Eimer.«
Frau Heubel nahm das Telefon entgegen. »Also ist er doch schon im Haus. Bestimmt ist er im Gärkeller. Vielleicht ist er gestern mit dem Saubermachen nicht ganz fertig geworden. Könntest du Frau Sandmann vielleicht dort hinführen? Sie hat bei ihm einen Termin für eine Führung. Sie ist die Fotografin.«
»Ah, Tag, Frau Sandmann. Mein Name ist Willich. Wie die Stadt. Gerd Willich. Kommen Sie mit.«
Er marschierte los. Auf dem Treppenabsatz drehte er sich noch einmal um.
»Und halten Sie sich dicht hinter mir, sonst verlaufen Sie sich. Das hier ist bestimmt die verwinkelteste Brauerei der Welt.« Er grinste.
Dann lief er mit langen Schritten weiter und Katrin folgte ihm dicht auf den Fersen durch ein Gewirr von schmalen Gängen und engen Treppen, vorbei an den Schankräumen bis vor eine kleine Tür mit einem Glasfenster.
»Das ist der Gärkeller. Hier wird der Würze die Hefe zugesetzt«, erläuterte Gerd Willich, »aber der Andy kann das alles noch viel besser erklären als ich.«
Er stieß die Tür auf, und sie betraten einen kleinen, engen Raum mit niedriger Decke. Es war schwül, und die Luft war schwer und drückend. Auf der linken Seite befanden sich drei riesige, silberfarbene, in den Boden eingelassene Becken. Die beiden vorderen waren bis zum Rand gefüllt. Braunbeige gescheckter Schaum schwamm zuoberst, so dass die Bottiche aussahen wie zwei gigantische, übervolle Badewannen. Das hintere Becken schien leer zu sein.
»Hier ist er ja gar nicht«, stellte Gerd Willich erstaunt fest, wandte sich ab und wollte wieder gehen. Katrin folgte ihm nicht sofort, sondern machte ein paar Schritte in den Raum hinein. Sie ging auf den hinteren Bottich zu.
»Dürfte ich mal kurz einen Blick da rein werfen?«, fragte sie. »Ich würde gern sehen, wie tief diese Dinger sind.«
Der Mann lachte. »Diese Dinger heißen Gärbottiche. Gucken Sie nur rein, aber beugen Sie sich nicht zu tief runter, sonst kippen Sie mir nachher um. Da drinnen sammelt sich oft das Kohlendioxyd.«
Katrin ging zum hinteren Bottich und beugte sich neugierig über den Rand. Sie starrte hinunter. Ihr wurde schwindelig. Sie schnappte nach Luft und ihre Hände tasteten hilflos nach Halt.
Doch es war nicht die schlechte Luft, die ihr den Atem verschlug. Es war der Anblick des Mannes, der sich auf dem Grund des Gärbottichs befand. Er lag mit angewinkelten Beinen auf dem Rücken. Seine Finger umkrallten einen Schrubberstiel. Sein Körper war leicht verdreht, so als wäre er einfach zusammengesackt und seine schmalen Lippen in dem starren Gesicht waren bläulich verfärbt. Es gab keinen Zweifel daran, dass er tot war.
3
Als Klaus Halverstett den Obduktionssaal betrat, fiel sein Blick als Erstes auf den schlanken, jungen Mann, der mit dem Rücken zu ihm in der Mitte des Raums stand und nervös mit seinem Wagenschlüssel herumspielte. Der Hauptkommissar kannte ihn. Es war Fischer von der Staatsanwaltschaft. Der Mann war ein erfahrener Ermittlungsbeamter und gar nicht mehr so jung, wie er auf den ersten Blick wirkte. Er konnte knallhart sein, wenn die Situation es erforderte. Nur bei den obligatorischen Sektionsterminen wirkte er immer wie ein kleiner Schuljunge vor einer schwierigen Mathearbeit.
Er und Halverstett hatten schon unzähligen Obduktionen gemeinsam beigewohnt. Trotzdem fürchtete der Polizist jedes Mal, der Staatsanwalt würde bereits vor dem ersten Schnitt in Ohnmacht fallen.
Fischer verstaute den Schlüssel in der Hosentasche, drehte sich um und grinste den Kommissar schief an.
»Morgen, Halverstett. Gut gefrühstückt?«
Halverstett grüßte zurück. Fischer sah heute besonders bleich und dürr aus, und Halverstett fragte sich, ob er überhaupt jemals etwas aß. Er beobachtete, wie der Staatsanwalt ein Päckchen Zigaretten aus der Jacketttasche fischte, einen Augenblick lang in den Händen hin und her drehte und wieder verschwinden ließ.
Halverstett durchfuhr plötzlich der Gedanke, dass er eigentlich gar nichts über den Mann wusste. Von den meisten Menschen, mit denen er regelmäßig beruflich zu tun hatte, kannte er wenigstens in etwa die privaten Verhältnisse, konnte sich nach dem Befinden der Frau erkundigen oder nach dem Fortkommen der Kinder in der Schule. Aber von Fischer wusste er überhaupt nichts. Hatte er eine Familie? Lebte er vielleicht noch zu Hause bei seiner Mutter oder womöglich in einer vergammelten Junggesellenbude? Halverstett ertappte sich bei dem Gedanken, dass er Fischer für den Typ Mann hielt, der wohl noch sein Abendessen von Mama vorgesetzt und seine Hemden von ihr gebügelt bekam.
Die Tür öffnete sich und eine Frau betrat mit hastigen Schritten den Obduktionssaal. Sie war groß und schlank, und ihr rotes Haar hatte sie zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, damit es sie bei der Arbeit nicht behinderte. Sie war ausgesprochen attraktiv.
Über Fischers Gesicht lief eine hektische Röte, als sie durch die Tür kam, und plötzlich begriff Halverstett den Grund seiner Nervosität. Er lächelte innerlich, riss sich aber zusammen und reichte der Frau die Hand. Diese ergriff zuerst das Wort.
»Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Maren Lahnstein. Sie sind Hauptkommissar Halverstett?«
Halverstett erwiderte ihren Gruß. Er hatte bereits von ihr gehört: Krankhaft ehrgeizig. Geht über Leichen. Ein ziemlich zynischer Kommentar über eine Gerichtsmedizinerin. Aber vielleicht waren die männlichen Kollegen ja auch nur eingeschnappt, weil sie sich nicht gleich von jedem anbaggern ließ, sondern auf Distanz blieb.
Maren Lahnstein drehte sich jetzt zu Fischer um und begrüßte ihn. Halverstett konnte ihr Gesicht nicht sehen, da sie ihm den Rücken zuwandte, aber er registrierte das verlegene Lächeln auf Fischers Lippen. Die Ärztin drückte kurz seine Hand und machte dann einen Schritt auf den Tisch zu, auf dem sich der Leichnam von Claudia Heinrich befand.
Maren Lahnstein arbeitete ruhig und konzentriert. Der dürre, pickelige Sektionsgehilfe hastete hin und her und reichte ihr Skalpell und Gläser, während sie mit routinierten, sicheren Bewegungen ihre Arbeit ausführte. Halverstetts Blick wanderte zwischen ihr und Fischer hin und her, der, sichtlich bemüht, Haltung zu bewahren, ihre Tätigkeit verkrampft und mit verschränkten Armen aus sicherer Distanz verfolgte.
Während die Frau im Obduktionssaal ihrer für sie selbst alltäglichen, doch für Außenstehende hoch befremdlichen Arbeit nachging, sammelte die Septembersonne draußen noch einmal ihre ganze Kraft. Als Halverstett zusammen mit Fischer gegen elf Uhr aus dem Gebäude trat, hatte sich die sengende Hitze erneut in der Stadt breit gemacht wie eine ungeliebte, angeheiratete Großtante, die an der Kaffeetafel die üppigsten Tortenstücke in sich hineinschaufelt und dabei schwitzt und stinkt, so dass allen anderen Familienmitgliedern der Kuchen förmlich im Hals stecken bleibt.
Verdeckt von anderen Gebäuden rauschte auf der Witzelstraße der Verkehr; das Gelände der Universitätskliniken jedoch breitete sich lautlos und träge vor ihnen aus. Ein einzelner Radfahrer im weißen Kittel strampelte den Bürgersteig entlang. Für einen Augenblick blieben die Männer auf dem Treppenabsatz vor dem Institut für Rechtsmedizin stehen. Fischer steckte sich eine Zigarette an.
»Und? Was denken Sie, Halverstett?«
Der Polizist zuckte vage die Achseln. Sekundenlang spielte er mit dem Gedanken, zu fragen, ob Fischer den Fall Claudia Heinrich oder Frau Dr. Lahnstein meine. Dann entschied er, dass das wohl doch ein wenig zu weit gehen würde.
Da Halverstett nicht sogleich etwas erwiderte, beantwortete der Staatsanwalt seine Frage selbst.
»Die Sachlage ist schwierig. Mir wäre ein eindeutiges Obduktionsergebnis lieber gewesen.« Er zog an der Zigarette, bevor er weiter sprach. »Thomas Heinrich ist ein prominenter Anwalt mit viel Einfluss. Ich kenne ihn. Wenn wir den Tod seiner Frau als Selbstmord zu den Akten legen, dann will ich hundert Prozent sicher sein, dass es auch wirklich ein Selbstmord war.«
Mit diesen Worten ließ er Halverstett stehen, marschierte zu einem schwarzen BMW, warf seine Zigarette auf die Straße, stieg ein und fuhr davon. Der Kommissar starrte ihm nach und fragte sich, ob er zu seiner Mutter auch so sprach, wenn sie seine Hemden nicht ordentlich gefaltet hatte. Dann fiel ihm ein, dass er ja gar nicht wusste, ob Fischer wirklich noch zu Hause wohnte. Er nahm sich vor, ihn bei nächster Gelegenheit zu fragen.