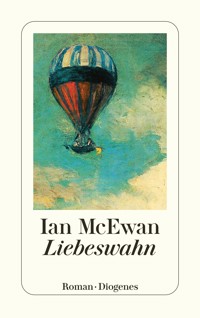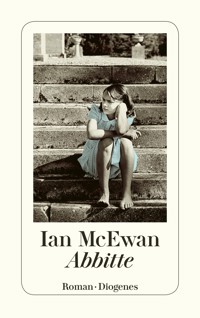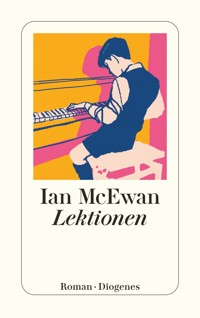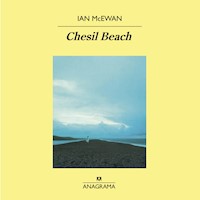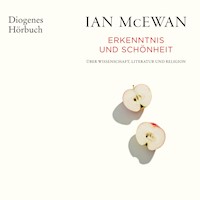10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Scheidungen, Sorgerecht, Fragen des Kindeswohls – das ist das Spezialgebiet der Richterin Fiona Maye. In ihrer eigenen, kinderlosen Ehe ist sie seit über dreißig Jahren glücklich. Bis zu dem Tag, als ihr Mann ihr einen schockierenden Vorschlag unterbreitet und ihr ein dringlicher Gerichtsfall vorgelegt wird, in dem es für einen 17-jährigen Jungen um Leben und Tod geht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Ian McEwan
Kindeswohl
Roman
Aus dem Englischen vonWerner Schmitz
Titel der 2014 bei
Jonathan Cape Ltd., London,
erschienenen Originalausgabe: ›The Children Act‹
Copyright ©2014 by Ian McEwan
Die deutsche Erstausgabe erschien 2015 im Diogenes Verlag
Die Gedichtzeilen aus W. B. Yeats’ Down by the Salley Gardens
(Beim Weidengarten unten), in der Übersetzung
von Mirko Bonné, aus: W. B. Yeats, Die Gedichte,
Luchterhand Literaturverlag, München 2005
Die Rechte an der Nutzung der Übersetzung von
Mirko Bonné liegen beim Luchterhand Literaturverlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Covermotiv: Elizabeth Peyton, ›Craig‹, 1998
Watercolor on paper, 34.3 x 27.9cm (131/2 x 11 in)
Copyright ©Gemälde von Elizabeth Peyton
Mit freundlicher Genehmigung der
Gladstone Gallery New York und Brüssel
Für Ray Dolan
Alle deutschen Rechte vorbehalten
Copyright ©2016
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 24377 2 (1. Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60452 8
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
»In jeder Frage der Sorge für diePerson eines Kindes… hat dasWohl des Kindes dem Gericht alsoberste Richtschnur zu dienen.«
Abschnitt 1 (a) des britischenChildren Act 1989
[7] 1
London. Sonntagabend, eine Woche nach dem Ende der Gerichtsferien. Nasskaltes Juniwetter. Fiona Maye, Richterin am High Court, lag zu Hause auf der Chaiselongue und starrte über ihre bestrumpften Füße hinweg quer durch den Raum. Ihr Blick streifte den Rand der Einbauregale, den Kamin und, neben dem hohen Fenster, die winzige Renoir-Lithographie einer Badenden, die sie vor dreißig Jahren für fünfzig Pfund erworben hatte. Wahrscheinlich eine Fälschung. Darunter, in der Mitte eines runden Walnusstischs, eine blaue Vase. Keine Erinnerung, wie sie zu der gekommen war. Oder wann sie das letzte Mal Blumen darin hatte. Der Kamin seit einem Jahr nicht mehr angezündet. Auf dem Rost vergilbte Zeitungsknäuel, auf die sporadisch, mit einem tickenden Geräusch, rußgeschwärzte Regentropfen fielen. Ein Buchara-Läufer auf den breiten gewachsten Dielen. Am Rand des Blickfelds ein schwarz glänzender Stutzflügel, darauf Familienfotos in Silberrahmen. Auf dem Fußboden neben der Chaiselongue, in Reichweite, der Entwurf eines Urteils. Und Fiona lag rücklings da und wünschte das alles auf den Meeresgrund.
In ihrer Hand der zweite Scotch mit Wasser. Sie fühlte sich immer noch zittrig nach der schlimmen Szene mit ihrem Mann. Sie trank selten, aber der Talisker mit [8] Leitungswasser war gerade Balsam für ihre Nerven, und sie überlegte, ob sie zur Anrichte gehen und sich ein drittes Glas einschenken sollte. Weniger Scotch, mehr Wasser, denn morgen hatte sie Gerichtstermine, und heute musste sie für dringende Fälle auf Abruf bereitstehen. Auch jetzt, wo sie sich auf der Chaiselongue von dem Gespräch erholte. Er hatte ihr mit seinem schockierenden Geständnis eine unzumutbare Bürde auferlegt. Zum ersten Mal seit Jahren hatte sie tatsächlich geschrien, und ein schwaches Echo klang ihr noch immer in den Ohren. »Du Idiot! Du verdammter Idiot!« Laut geflucht hatte sie seit ihren unbeschwerten Besuchen in Newcastle als Teenager nicht mehr, obwohl sich manchmal Kraftausdrücke in ihre Gedanken drängten, wenn sie sich eigennützige Falschaussagen oder juristische Haarspaltereien anhören musste.
Und gleich darauf hatte sie, keuchend vor Empörung, mindestens zweimal laut gesagt: »Wie kannst du es wagen!«
Das war schwerlich als Frage gedacht, aber er antwortete ruhig: »Ich brauche das. Ich bin neunundfünfzig. Das ist meine letzte Chance. Für ein Leben nach dem Tod fehlt meines Wissens bislang jeder Beweis.«
Eine prätentiöse Bemerkung, zu der ihr nichts eingefallen war. Sie starrte ihn nur an, womöglich mit offenem Mund. Erst jetzt auf der Chaiselongue, zu spät, hatte sie eine Antwort: »Neunundfünfzig? Jack, du bist sechzig! Wie erbärmlich, wie banal!«
Tatsächlich hatte sie nur lahm erwidert: »Das ist doch einfach lächerlich.«
»Fiona, wann haben wir das letzte Mal miteinander geschlafen?«
[9] Ja, wann? Er hatte sie das schon öfter gefragt, mal klagend, mal gereizt. Aber es kann schwerfallen, sich an die ereignisreiche jüngere Vergangenheit zu erinnern. Am Familiengericht wimmelte es von seltsamen Meinungsverschiedenheiten, Berufungen auf Sonderfälle, vertraulichen Halbwahrheiten und bizarren Anschuldigungen. Und wie auf allen juristischen Gebieten mussten feinkörnige Einzelheiten der Sachverhalte im Höchsttempo memoriert und verarbeitet werden. Vorige Woche hatte sie die Schlussplädoyers im Scheidungsverfahren jüdischer Eheleute gehört, die, in ungleichem Maße orthodox, darüber stritten, wie ihre Töchter erzogen werden sollten. Die Endfassung ihres Urteils lag neben ihr auf dem Boden. Morgen würde eine verzweifelte Engländerin erneut vor ihr erscheinen, hager, blass, gebildet, Mutter eines fünfjährigen Mädchens. Trotz dem Gericht vorliegender gegenteiliger Zusicherungen war sie überzeugt, dass der Vater, ein marokkanischer Geschäftsmann und strenggläubiger Muslim, plante, die gemeinsame Tochter der britischen Gerichtsbarkeit zu entziehen und nach Rabat zu verbringen, wo er ein neues Leben anfangen wollte. Dazu die üblichen Rangeleien um den Wohnort der Kinder, um Häuser, Renten, Einkünfte, Erbschaften. Es waren die größeren Vermögen, die vor dem High Court landeten. Reichtum garantierte nur selten anhaltendes Glück. Eltern wurden sehr bald mit dem neuen Vokabular und den geduldigen Mühlen der Justiz vertraut und fanden sich auf einmal, zu ihrer Verblüffung, in erbitterter Fehde mit dem Menschen wieder, den sie einmal geliebt hatten. Und hinter den Kulissen warteten Jungen und Mädchen, in den Gerichtsakten nur mit Vornamen geführt, Bens und Sarahs, die sich ängstlich [10] aneinanderklammerten, während die Götter über ihnen sich bis zur letzten Instanz zerfleischten, vom Familiengericht zum High Court bis zum Berufungsgericht, dem Court of Appeal.
All diesem Leid war vieles gemeinsam, viel allgemein Menschliches, aber es faszinierte sie immer noch. Sie war überzeugt, dass sie Rationalität in aussichtslose Situationen hineinbringen konnte. Im Großen und Ganzen glaubte sie an die Bestimmungen des Familienrechts. In optimistischen Momenten hielt sie es für einen Meilenstein des zivilisatorischen Fortschritts, dass der Gesetzgeber die Bedürfnisse der Kinder über die der Eltern gestellt hatte. Ihre Tage waren ausgefüllt, in letzter Zeit auch die Abende: diverse Essenseinladungen, in Middle Temple – einer der vier Anwaltskammern – ein Empfang für einen in Ruhestand gehenden Kollegen, ein Konzert in Kings Place (Schubert, Skrjabin), Taxifahrten, U-Bahnfahrten, Sachen von der Reinigung abholen, für den autistischen Sohn der Putzfrau einen Brief an eine Sonderschule aufsetzen, und schlafen. Wo war der Sex geblieben? Im Augenblick konnte sie sich nicht daran erinnern.
»Als ob ich Buch darüber führen würde.«
Er breitete die Hände aus: Keine weiteren Fragen.
Sie hatte ihn beobachtet, als er durchs Zimmer ging und sich einen Scotch einschenkte, den Talisker, den sie jetzt auch trank. Er drehte ihr den Rücken zu, und sie hatte ein kaltes Vorgefühl von Verstoßensein, von der Demütigung, für eine jüngere Frau verlassen zu werden, zurückgelassen zu werden, nutzlos und allein. Sie fragte sich, ob sie nicht einfach allem zustimmen sollte, was er verlangte, verwarf den Gedanken aber gleich wieder.
[11] Er war mit dem Glas zu ihr zurückgekommen. Er bot ihr keinen Sancerre an wie sonst immer um diese Zeit.
»Was willst du, Jack?«
»Ich werde diese Affäre haben.«
»Du willst die Scheidung.«
»Nein. Ich will, dass alles bleibt wie es ist. Ohne dich zu hintergehen.«
»Das verstehe ich nicht.«
»Doch, das verstehst du. Hast du nicht selbst einmal gesagt, dass langverheiratete Paare immer mehr wie Geschwister miteinander leben? An diesem Punkt sind wir jetzt, Fiona. Ich bin dein Bruder geworden. Das ist schön und behaglich, und ich liebe dich, aber bevor ich tot umfalle, will ich noch eine große, leidenschaftliche Affäre haben.«
Er missverstand ihr Schnauben als Lachen, als Spott vielleicht, und sagte grob: »Ekstase, vor Erregung fast ohnmächtig werden. Erinnerst du dich? Ich will das noch ein letztes Mal, auch wenn du das nicht willst. Oder vielleicht ja doch.«
Sie starrte ihn ungläubig an.
»Da hast du’s.«
Jetzt hatte sie endlich ihre Stimme wiedergefunden und ihm gesagt, was für ein Idiot er war. Sie war im Recht, da hatte sie nicht den geringsten Zweifel. Dass er ihr, soweit sie wusste, immer treu gewesen war, machte sein Ansinnen umso empörender. Oder falls er sie in der Vergangenheit betrogen hatte, dann offenbar äußerst geschickt. Den Namen der Frau kannte sie bereits. Melanie. Nicht unähnlich dem Namen einer tödlichen Form von Hautkrebs. Sie wusste, seine Affäre mit dieser achtundzwanzigjährigen Statistikerin konnte ihr Ende bedeuten.
[12] »Wenn du das tust, ist es aus mit uns. So einfach ist das.«
»Ist das eine Drohung?«
»Ein feierliches Versprechen.«
Inzwischen hatte sie sich wieder gefangen. Und es schien ja auch wirklich einfach. Der richtige Augenblick, um eine offene Ehe vorzuschlagen, war vor der Hochzeit, nicht fünfunddreißig Jahre danach. Alles aufs Spiel zu setzen, nur damit er den flüchtigen Sinnenrausch noch einmal erleben konnte! Als sie sich so etwas für sich selbst vorzustellen versuchte – ihre »letzte Affäre« wäre ihre erste −, dachte sie nur an Störungen, heimliche Verabredungen, Enttäuschungen und Anrufe zur Unzeit. Das komplizierte Prozedere, bis man im Bett mit jemand Neuem zurechtkam, neu ersonnene Zärtlichkeiten, der ganze Schwindel. Und dann die Notwendigkeit, sich wieder zu lösen, die Anstrengung, offen und ehrlich zu sein. Und hinterher nichts mehr, wie es vorher war. Nein, sie zog ein unvollkommenes Dasein vor, dasjenige, das sie jetzt hatte.
Aber auf der Chaiselongue stieg es vor ihr auf, das wahre Ausmaß der Kränkung: dass er tatsächlich bereit war, für sein Vergnügen mit ihrem Elend zu bezahlen. Rücksichtslos. Sie hatte schon miterlebt, wie er seinen Willen auf Kosten anderer durchsetzte, meist im Dienst einer guten Sache. Das hier war neu. Was hatte sich verändert? Aufrecht hatte er dagestanden, breitbeinig, sich den Single Malt eingeschenkt und mit den Fingern der freien Hand einen Takt geschlagen, zu irgendeinem Song in seinem Kopf vielleicht, den er mit jemandem gehört hatte, aber nicht mit ihr. Ihr weh zu tun und sich nichts daraus zu machen – das war neu. Er war immer gütig gewesen, loyal und gütig, und Güte, das zeigte sich [13] tagtäglich im Familiengericht, war das entscheidende menschliche Merkmal. Fiona besaß die Macht, herzlosen Eltern ein Kind wegzunehmen, und manchmal tat sie es. Aber sich selbst vor einem herzlosen Gatten zu schützen? Schwach und unglücklich, wie sie war? Wo war der Richter, der ihr zu Hilfe kam?
Selbstmitleid bei anderen machte sie verlegen, und für sie kam es schon gar nicht in Frage. Dann lieber einen dritten Scotch. Doch sie nahm nur ein paar symbolische Tropfen mit viel Wasser und ging zur Chaiselongue zurück. Ja, das war eins dieser Gespräche gewesen, bei dem sie hätte Notizen machen sollen. Um sich genau zu erinnern, um die Kränkung sorgfältig auszuloten. Auf ihre Drohung, die Ehe zu beenden, falls er mit seiner Affäre ernst mache, war ihm nichts Besseres eingefallen, als sich zu wiederholen, nochmals zu beteuern, dass er sie liebe, immer lieben werde, dass es für ihn nur dieses Leben gebe, dass seine unerfüllten sexuellen Bedürfnisse ihn todunglücklich machten, dass er jetzt diese eine Gelegenheit habe und sie mit ihrem Wissen und, so hoffe er, mit ihrer Zustimmung nutzen wolle. Er rede im Geist der Aufrichtigkeit mit ihr. Er hätte es auch »hinter ihrem Rücken« tun können. Ihrem schmalen, unversöhnlichen Rücken.
»Oh«, flüsterte sie. »Wie anständig von dir, Jack.«
»Na ja, also eigentlich…«, sagte er und verstummte.
Sie nahm an, jetzt käme das Geständnis, dass die Affäre längst begonnen hatte, und das wollte sie nicht hören. Das hatte sie nicht nötig. Sie sah es ja. Da arbeitete eine hübsche Statistikerin an der Verringerung der Wahrscheinlichkeit, dass ein Mann zu seiner verbitterten Frau zurückkehrte. Sie sah einen sonnigen Morgen, ein fremdes Bad, darin Jack mit [14] seiner noch recht sportlichen Figur, wie er sich auf seine ungeduldige Art ein halb aufgeknöpftes, frisches weißes Leinenhemd über den Kopf zog; ein anderes Hemd, achtlos Richtung Wäschekorb geworfen, hing noch an einem Ärmel an der Kante, ehe es auf den Fußboden fiel. Der Untergang. Es würde passieren, mit oder ohne ihre Zustimmung.
»Die Antwort lautet Nein.« Sie hatte die Stimme erhoben wie eine gestrenge Schulmeisterin. »Hast du denn was anderes erwartet?«
Sie fühlte sich hilflos und wollte nicht mehr weiterreden. Bis morgen musste sie ein Urteil für die Veröffentlichung im Familiengerichtsbulletin überarbeiten. Das weitere Schicksal zweier jüdischer Schulmädchen war mit der Entscheidung, die sie im Gericht verkündet hatte, bereits besiegelt, aber der Text musste noch geglättet und daraufhin durchgesehen werden, dass er ja keine religiösen Gefühle verletzte und somit Berufungsgründe bot. Draußen schlug Sommerregen an die Fenster; weiter weg, jenseits von Gray’s Inn Square, zischten Reifen über nassen Asphalt. Er würde sie verlassen, und die Welt würde sich weiterdrehen.
Mit angespannter Miene zuckte er die Schultern, wandte sich ab und ging aus dem Zimmer. Beim Anblick seines Rückens überkam sie wieder diese kalte Angst. Am liebsten hätte sie ihm nachgerufen, doch die Furcht, ignoriert zu werden, hielt sie zurück. Und was hätte sie auch sagen sollen? Halt mich fest, küss mich, nimm das Mädchen. Sie hörte seine Schritte im Flur, ihre Schlafzimmertür ins Schloss fallen, dann nur noch Stille in der Wohnung, Stille und Regen, der seit einem Monat nicht aufhören wollte.
* * *
[15] Zunächst die Tatsachen. Beide Parteien entstammten der ultraorthodoxen Gemeinde der Charedim im Norden Londons. Die Ehe der Bernsteins war von den Eltern arrangiert worden, Widerspruch dabei nicht zu erwarten gewesen. Arrangiert, nicht erzwungen, beteuerten beide Parteien in seltener Einmütigkeit.
Dreizehn Jahre später waren sich alle Beteiligten einig – Mediator, Sozialarbeiterin und Richterin mit eingeschlossen −, dass die Ehe nicht mehr zu retten war. Das Paar lebte jetzt getrennt. Mühsam teilten die beiden die Betreuung ihrer zwei Kinder zwischen sich auf. Rachel und Nora wohnten bei der Mutter und hatten regen Kontakt mit dem Vater. Der Verfall der Ehe hatte bereits in den ersten Jahren begonnen. Nach der schwierigen Geburt der zweiten Tochter, die einen radikalen medizinischen Eingriff erforderlich machte, konnte die Mutter nicht mehr schwanger werden. Der Vater hatte sich eine große Familie in den Kopf gesetzt: Das war der Anfang vom schmerzlichen Ende. Nach einer depressiven Phase (lang, sagte der Vater; kurz, sagte die Mutter) begann sie ein Studium an der Open University, erwarb einen ordentlichen Abschluss und trat, sobald die jüngere Tochter eingeschult war, eine Stelle als Grundschullehrerin an. Das passte weder dem Vater noch der zahlreichen Verwandtschaft. Bei den Charedim, die seit Jahrhunderten an ihren Traditionen festhielten, hatten Frauen Kinder zu erziehen, je mehr, desto besser, und sich um den Haushalt zu kümmern. Ein Universitätsabschluss und ein Beruf waren höchst ungewöhnlich. Das bekräftigte auch der ältere Herr, ein angesehenes Mitglied der Gemeinde, den der Vater als Zeugen benannt hatte.
[16] Auch den Männern wurde nicht viel Ausbildung zuteil. Ab dem fünfzehnten Lebensjahr erwartete man von ihnen, dass sie den Großteil ihrer Zeit dem Studium der Thora widmeten. Im Allgemeinen gingen sie nicht zur Universität. Unter anderem deshalb hatten viele Charedim nur ein bescheidenes Auskommen. Nicht so die Bernsteins, wiewohl sich das nach Begleichung ihrer Anwaltsrechnungen ändern würde. Ein Großvater, Mitinhaber eines Patents für eine Olivenentkernungsmaschine, hatte dem Paar gemeinschaftlich Geld vermacht. Ihr gesamtes Vermögen würde für ihre jeweiligen Kronanwältinnen draufgehen, beide der Richterin gut bekannt. Oberflächlich betrachtet, ging es bei dem Streit um Rachels und Noras Schule. Auf dem Spiel aber stand der ganze Kontext, in dem die Mädchen aufwachsen sollten. Es war ein Kampf um ihre Seelen.
Charedische Jungen und Mädchen wurden, um ihre Reinheit zu bewahren, getrennt erzogen. Modische Kleidung, Fernsehen und Internet waren verboten, ebenso der Umgang mit Kindern, denen solche Zerstreuungen erlaubt waren. Besuche bei Familien, die die Koscher-Regeln nicht streng befolgten, waren tabu. Feste Bräuche bestimmten jeden Aspekt des Alltagslebens. Die Schwierigkeiten hatten mit der Mutter angefangen, die der Gemeinde den Rücken gekehrt hatte, wenn auch nicht dem Judentum. Gegen den Widerspruch des Vaters hatte sie die Mädchen bereits an einer gemischten jüdischen Oberschule angemeldet, wo Fernsehen, Popmusik, Internet und der Umgang mit nichtjüdischen Kindern gestattet waren. Zudem sollten die Mädchen über das sechzehnte Lebensjahr hinaus zur Schule gehen und danach, wenn sie wollten, zur Universität. In ihrer schriftlichen [17] Aussage erklärte sie, ihre Töchter sollten mehr darüber erfahren, wie andere Menschen lebten, sie sollten toleranter werden, Karrierechancen bekommen, die sie selbst nie hatte, sie sollten als Erwachsene finanziell unabhängig sein und die Möglichkeit haben, einen Mann mit einer guten Ausbildung kennenzulernen, der seinen Beitrag zum Unterhalt einer Familie leisten könne. Im Gegensatz zu ihrem Mann, der seine gesamte Zeit dem Studium der Schriften widmete und lediglich acht Stunden die Woche und ohne Bezahlung die Thora lehrte.
So vernünftig sie ihre Sache auch vortrug, Judith Bernstein – kantiges blasses Gesicht, krauser hellroter Haarschopf, gebändigt von einer riesigen blauen Spange – war im Gerichtssaal nicht leicht zu ertragen. Ständig schob sie ihrer Anwältin mit fahrigen, sommersprossigen Fingern Notizen zu, stöhnte gedämpft auf, verdrehte die Augen und schürzte die Lippen, wann immer die Anwältin ihres Mannes sprach, wühlte und stöberte in ihrer übergroßen, hellbraunen Lederhandtasche, entnahm ihr einmal am Tiefpunkt eines langen Nachmittags ein Päckchen Zigaretten und ein Feuerzeug – in den Augen ihres Mannes gewiss provokante Gegenstände – und legte sie vor sich hin, um sie griffbereit zu haben, wenn das Gericht sich vertagte. Fiona bekam das alles von ihrem erhöhten Sitz aus mit, ließ es sich aber nicht anmerken.
MrBernsteins schriftliche Aussage sollte die Richterin davon überzeugen, dass seine Frau eine Egoistin mit »Aggressionsbewältigungsproblemen« sei (im Familiengericht ein häufiger, oft gegenseitiger Vorwurf), die ihre Ehegelöbnisse nicht mehr ernst nehme, sich mit der Gemeinde und [18] seinen Eltern streite und die Mädchen von ihnen abzuschotten versuche. Ganz im Gegenteil, sagte Judith im Zeugenstand, es seien ihre Schwiegereltern, die sie und ihre Kinder erst wieder sehen wollten, wenn sie auf den rechten Lebensweg zurückgefunden, der modernen Welt, einschließlich sozialer Medien, abgeschworen hätten und Judith wieder einen Haushalt führe, der nach deren Maßstäben koscher sei.
MrJulian Bernstein, lang und dünn wie die Binsen, die einst den kleinen Moses bargen, beugte sich schüchtern über die Gerichtsakten, und seine Schläfenlocken bebten verdrossen, während seine Anwältin seiner Frau Unfähigkeit vorwarf, ihre eigenen Bedürfnisse von denen ihrer Kinder zu trennen. Was sie als deren Bedürfnisse ausgebe, sei das, was sie sich selbst wünsche. Sie reiße die Mädchen aus der Geborgenheit einer vertrauten, strikten, aber liebevollen Umgebung, deren Regeln und Vorschriften allen Wechselfällen des Lebens Rechnung trügen, deren Identität klar umrissen sei, deren Methoden sich über viele Generationen bewährt hätten und deren Mitglieder im großen Ganzen ein glücklicheres und erfüllteres Leben führten als die Menschen in der säkularen Konsumgesellschaft da draußen – einer Welt, die für das spirituelle Leben nur Hohn und Spott übrig habe und deren Massenkultur Mädchen und Frauen in den Schmutz ziehe. MrsBernsteins Wünsche seien leichtfertig, ihre Methoden respektlos, ja destruktiv. Sie liebe ihre Kinder weit weniger als sich selbst.
Worauf Judith mit belegter Stimme antwortete, nichts ziehe einen Menschen, ob Junge oder Mädchen, mehr in den Schmutz, als wenn man ihm eine ordentliche Ausbildung [19] und die Würde anständiger Arbeit vorenthalte; ihre ganze Kindheit und frühe Jugend lang habe man ihr gesagt, ihr einziger Lebenszweck bestehe darin, ihrem Mann ein schönes Heim zu bereiten und für ihre Kinder zu sorgen – auch dies ziehe ihr Recht in den Schmutz, sich selbst ein Ziel im Leben zu setzen. Als sie, unter erheblichen Schwierigkeiten, an der Open University studiert habe, sei sie verlacht, verspottet und ausgestoßen worden. Sie habe sich vorgenommen, den Mädchen solcherlei zu ersparen.
Die Anwältinnen beider Seiten stimmten aus taktischen Gründen darin überein (denn die Richterin sah die Sache ganz eindeutig so), dass es hier nicht lediglich um eine Frage der Schulbildung ging. Das Gericht hatte, im Namen der Kinder, zu entscheiden zwischen totaler Religion und einer leichten Abweichung davon. Zwischen Kulturen, Identitäten, Gefühlslagen, Lebensentwürfen, Familienbeziehungen, fundamentalen Grundsätzen, elementaren Loyalitäten und unabsehbaren künftigen Entwicklungen.
In solchen Gemengelagen gab es immer eine latente Neigung zugunsten des Status quo, sofern dieser nicht schädlich schien. Fionas Urteilsentwurf, einundzwanzig Seiten lang, lag fächerartig ausgebreitet neben ihr auf dem Fußboden, Textseite nach unten, die Blätter warteten nur darauf, einzeln von ihr aufgehoben und mit weichem Bleistift korrigiert zu werden.
Kein Geräusch aus dem Bad, nichts als das Surren des Verkehrs im Regen. Sie ärgerte sich über sich selbst, dass sie mit gespitzten Ohren und angehaltenem Atem auf ihn lauschte, auf das Knarren einer Tür oder Diele. Sie sehnte sich danach, ihr graute davor.
[20] Richterkollegen lobten Fiona Maye, selbst in ihrer Abwesenheit, ob ihrer klaren, beinahe ironischen, beinahe warmherzigen Prosa und der Knappheit, mit der sie einen Streitfall darzulegen vermochte. Der Lordoberrichter persönlich hatte einmal beim Lunch beiläufig über sie gesagt: »Göttliche Distanz, teuflische Klugheit, und dabei immer schön.« Sie selbst fand, dass sie von Jahr zu Jahr mehr zu einer Genauigkeit neigte, die manch einer Pedanterie genannt hätte, sie bemühte sich um unanfechtbare Definitionen, die eines Tages, wer weiß, nicht minder zitierfähig wären als die von Hoffmann in Sachen Piglowska gegen Piglowski oder von Bingham oder Ward oder dem unverzichtbaren Scarman, auf die sie hier alle zurückgegriffen hatte. Hier, das war die noch nicht korrigierte erste Seite, die sie schlaff in den Fingern hielt. Stand ihr Leben vor einer Umwälzung? Würden Anwälte aller Kammern demnächst beim Lunch hier in Gray’s oder in Lincoln’s Inn oder in Inner oder Middle Temple ehrfürchtig flüstern: Und dann hat sie ihn vor die Tür gesetzt? Vor die Tür der bezaubernden Wohnung am Gray’s Inn Square, wo sie allein und einsam sitzen würde, bis die Miete oder die Jahre, beide träge anschwellend wie die Themse bei Flut, am Ende auch sie hinausgeschwemmt hätten?
Zur Sache. Erster Abschnitt: ›Hintergrund‹. Nach Routineerläuterungen zur Wohnsituation der Familie, Aufenthaltsort der Kinder und Kontakt zum Vater beschrieb sie in einem gesonderten Absatz die Gemeinschaft der Charedim, deren Leben vollständig von der Ausübung ihrer Religion bestimmt sei. Die Unterscheidung zwischen dem, was des Kaisers und was Gottes ist, sei für sie fast ebenso [21] bedeutungslos wie für fromme Muslime. Ihr Bleistift blieb in der Schwebe. Muslime und Juden in einem Atemzug zu nennen, könnte das als überflüssig oder provozierend aufgefasst werden, zumindest vom Vater? Nur wenn er unvernünftig war, und dafür hielt sie ihn nicht. Bleibt.
Ihr zweiter Abschnitt trug die Überschrift ›Moralische Differenzen‹. Das Gericht sah sich vor der Aufgabe, über die Erziehung der zwei Mädchen zu entscheiden, Wertvorstellungen gegeneinander abzuwägen. Und in Fällen wie diesem war der Verweis auf das, was in der Gesellschaft allgemein akzeptiert war, wenig hilfreich. An dieser Stelle zitierte sie Lord Hoffmann. »Hierbei handelt es sich um Werturteile, über die vernünftige Menschen unterschiedliche Meinungen haben können. Da Richter auch Menschen sind, ist ein gewisses Maß an Unterschieden in der Anwendung von Wertmaßstäben unausbleiblich…«
Auf dem Rest der Seite – in letzter Zeit entwickelte sie eine Vorliebe für gründliche, anspruchsvolle Exkurse – widmete Fiona zunächst einige hundert Wörter einer Definition von Wohlergehen sowie einer Erörterung der Kriterien, an denen Wohlergehen zu messen sei. Dabei hielt sie sich an Lord Hailsham, dem zufolge dieser Begriff untrennbar mit dem des Wohlbefindens verbunden war und alles in sich schloss, was für die Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes von Bedeutung sein konnte. Mit Tom Bingham bekannte sie sich zu ihrer Pflicht, mittel- und langfristig zu denken, ein Kind von heute, merkte sie an, könne durchaus bis ins zweiundzwanzigste Jahrhundert leben. Sie zitierte ein Urteil von Lordrichter Lindley aus dem Jahre 1893, wonach Wohlergehen nicht unter rein finanziellen Gesichtspunkten oder [22] ausschließlich im Hinblick auf physisches Wohlbefinden zu bemessen sei. Es gehe ihr um eine möglichst breite Betrachtungsweise. Wohlergehen, Glück, Wohlbefinden sollten die philosophische Vorstellung vom guten Leben umfassen. Sie zählte einige Elemente auf, mögliche Ziele der Entwicklung eines Kindes. Ökonomische und moralische Freiheit, Anstand, Mitgefühl und Altruismus, befriedigende, anspruchsvolle Arbeit, ein gedeihendes Netzwerk persönlicher Beziehungen, das Erlangen von Ansehen, das Streben nach einem höheren Sinn des eigenen Daseins und im Zentrum all dessen eine oder mehrere wichtige Beziehungen, die im Wesentlichen von Liebe bestimmt sind.
Ja, in dieser Hauptsache hatte sie selbst versagt. Der verwässerte Scotch stand unberührt neben ihr, der Anblick der harngelben Flüssigkeit und ihr aufdringlicher Korkgeruch stießen sie jetzt ab. Eigentlich sollte sie zorniger sein, sie sollte mit einer alten Freundin reden – sie hatte mehrere –, sie sollte ins Schlafzimmer marschieren und Klarheit verlangen. Aber sie fühlte sich zusammengeschrumpft auf einen geometrischen Punkt, auf ein nervöses Pflichtgefühl. Ihr Urteil musste bis morgen druckfertig sein, sie musste arbeiten. Ihr Privatleben bedeutete nichts. Oder sollte nichts bedeuten. Ihre Aufmerksamkeit sprang zwischen dem Blatt in ihrer Hand und der fünfzehn Meter entfernten, geschlossenen Schlafzimmertür hin und her. Sie zwang sich, einen langen Absatz zu lesen, einen, an dem ihr in dem Augenblick, als sie ihn im Gerichtssaal vorgetragen hatte, Zweifel gekommen waren. Aber was konnte es schaden, das Offensichtliche klar und deutlich auszusprechen? Wohlbefinden war etwas Soziales. Das komplizierte Gewebe der Beziehungen [23] eines Kindes zu Familie und Freunden war das Entscheidende. Kein Kind eine Insel. Der Mensch ein soziales Lebewesen, in Aristoteles’ berühmter Wendung. Mit vierhundert Wörtern zu diesem Thema stach sie in See, zahlreiche gelehrte Anspielungen (Adam Smith, John Stuart Mill) bauschten ihre Segel. Genau der kultivierte Rückenwind, den jedes gute Urteil braucht.
Sodann: Wohlbefinden war ein variabler Begriff, der nach den Maßstäben vernünftiger Männer und Frauen von heute zu beurteilen war. Was einer früheren Generation noch genügt hatte, reichte heutzutage vielleicht nicht mehr. Im Übrigen war es nicht Sache eines weltlichen Gerichts, religiöse Konflikte oder theologische Differenzen zu entscheiden. Alle Religionen verdienten gleichermaßen Respekt, vorausgesetzt, sie waren, mit Lordrichter Purchas zu sprechen, »rechtlich und gesellschaftlich akzeptabel«, und nicht, in Lordrichter Scarmans dunklerer Formulierung, »unmoralisch oder gesellschaftlich anstößig«.
Was Interventionen gegen die religiösen Grundsätze der Eltern anging, waren Gerichte zu größter Zurückhaltung verpflichtet. Manchmal mussten sie, im Interesse des Kindes, eingreifen. Aber wann? Sie zitierte einen ihrer Lieblinge, den weisen Lordrichter Munby vom Court of Appeal. »Die unendliche Vielfalt menschlicher Lebensbedingungen schließt willkürliche Festlegungen aus.« Die hübsche Shakespeare’sche Note. Das Alter kann sie nicht welken noch Gewohnheit schal machen ihre unendliche Vielfalt. Die Worte warfen sie aus der Bahn. Sie kannte die Rede des Enobarbus auswendig, hatte die Rolle als Studentin gespielt (das ganze Stück war nur mit Frauen besetzt), an einem sonnigen [24] Mittsommernachmittag auf einem Rasen in Lincoln’s Inn Fields. Kurz nachdem ihr die Last des Anwaltsexamens vom schmerzenden Rücken genommen worden war. Um diese Zeit hatte Jack sich in sie verliebt, und wenig später sie sich in ihn. Zum ersten Mal miteinander geschlafen hatten sie in einer geborgten Mansarde, unter einem in der Nachmittagssonne glühenden Dach. Ein Bullaugenfenster, das sich nicht öffnen ließ, gewährte Aussicht nach Osten, auf ein Stück Themse kurz vor dem Pool of London.
Sie dachte an seine zukünftige oder jetzige Geliebte, seine Statistikerin, Melanie – sie hatte sie einmal gesehen −, eine stille junge Frau mit Bernsteinkette und einer Vorliebe für die Art von Stilettos, die alte Eichenfußböden ruinieren konnten. Andre Weiber sätt’gen, die Lust gewährend: Sie macht hungrig, je reichlicher sie schenkt. Vielleicht würde es genau so sein, eine unheilvolle Obsession, eine Sucht, die ihn von zu Hause forttrieb, ihn bis zur Unkenntlichkeit verformte, ihre gemeinsame Vergangenheit und Zukunft verzehrte und die Gegenwart dazu. Oder aber Melanie fiel, wie Fiona es eindeutig tat, in die Kategorie »andre Weiber«, die sättigen – und in zwei Wochen wäre er wieder da, Appetit gestillt, und würde Pläne für den Familienurlaub schmieden.
So oder so, es war unerträglich.
Unerträglich und faszinierend. Und irrelevant. Sie zwang sich, zu ihrem Text zurückzukehren, zu ihrer Zusammenfassung der Aussagen beider Parteien – konzise und nüchtern verständnisvoll. Dann gab sie das Gutachten der vom Gericht bestellten Sozialarbeiterin wieder. Eine mollige, wohlmeinende junge Frau, die oft außer Atem geriet. Zerzaustes Haar, die aufgeknöpfte Bluse nicht eingesteckt, chaotisch, [25] zweimal verspätet erschienen, angeblich wegen irgendwelcher Komplikationen mit Autoschlüsseln und Dokumenten, die sie in ihrem Auto eingeschlossen hatte, und eines Kinds, das sie von der Schule abholen musste. Aber statt des üblichen Herumeierns und Ja-keine-Seite-verärgern-Wollens hatte die Frau vom Jugendamt einen sachlichen und geradezu prägnanten Bericht abgeliefert, aus dem Fiona zustimmend zitierte. Nächster Punkt?
Sie sah auf und erblickte am anderen Ende des Zimmers ihren Mann, der sich noch einen Scotch einschenkte, einen großen, drei Fingerbreit, vielleicht vier. Er war jetzt barfuß, so lief er, der akademische Bohemien, im Sommer oft zu Hause herum. Daher sein lautloses Eintreten. Wahrscheinlich hatte er auf dem Bett gelegen, eine halbe Stunde lang den ziselierten Stuck an der Decke betrachtet und über ihre Unvernunft nachgegrübelt. Die Spannung seiner hochgezogenen Schultern, die Art, wie er den Korken wieder einschlug – ein Stoß mit dem Handballen –, verriet, dass er auf Streit aus war. Sie kannte die Zeichen.
Er wandte sich um und kam mit seinem unverdünnten Scotch auf sie zu. Die jüdischen Mädchen, Rachel und Nora, mussten warten und wie christliche Engel hinter ihr schweben. Die für sie zuständige weltliche Gottheit hatte ihre eigenen Probleme. Von ihrer niedrigen Chaiselongue aus konnte sie diskret seine Zehennägel betrachten – sauber geschnitten und gepflegt, helle jugendliche Halbmonde, nichts von den Pilzschlieren, die ihre eigenen Zehen verunstalteten. Er hielt sich in Form mit Tennis an der Uni und einem Satz Hanteln in seinem Arbeitszimmer, hundertmal Hantelnheben im Laufe des Tages, das hatte er sich vorgenommen. Sie [26] tat nicht viel mehr, als ihre Aktentasche durchs Gerichtsgebäude in ihr Büro zu schleppen, wobei sie immerhin die Treppe benutzte, nicht den Aufzug. Er war auf eine widerborstige Art gutaussehend, das kantige Kinn ein wenig schief, dazu ein breites, zu allem bereites Grinsen im Gesicht, das seine Studenten – unter einem Professor für Alte Geschichte stellte man sich gemeinhin keinen Lebemann vor – für ihn einnahm. Es wäre ihr nie eingefallen, dass er mit diesen Mädchen etwas haben könnte. Jetzt schien alles anders. Vielleicht war sie trotz ihrer lebenslangen Beschäftigung mit menschlichen Schwächen naiv geblieben, blauäugig hatte sie sich selbst und Jack für Ausnahmen von der Regel gehalten. Mit seinem einzigen Buch für eine nicht-akademische Leserschaft, einer flott geschriebenen Caesar-Biographie, war er für kurze Zeit beinahe berühmt geworden, auf eine dezente, ehrbare Weise. Womöglich hatte sich da irgendein naseweises kleines Luder an ihn herangemacht. Sein Büro war, früher jedenfalls, mit einem Sofa ausgestattet. Und mit einem Türhänger, ne pas déranger, den sie vor Ewigkeiten, am Ende ihrer Flitterwochen, aus dem Hôtel de Crillon hatten mitgehen lassen. Diese Gedanken waren neu, so fraß sich der Wurm des Argwohns in die Vergangenheit.
Er nahm auf dem Sessel neben ihr Platz. »Du konntest meine Frage vorhin nicht beantworten, also sag ich’s dir. Vor sieben Wochen und einem Tag. Sei ehrlich, ist dir das genug?«
»Hat diese Affäre schon angefangen?«, erwiderte sie ruhig.
Er wusste, dass man eine schwierige Frage am besten mit einer Gegenfrage beantwortete. »Meinst du, wir sind zu alt? Ist es das?«
[27] Sie sagte: »Weil, wenn es schon angefangen hat, kannst du deine Sachen packen und gehen.«
Ein unbedachter, selbstzerstörerischer Schachzug, ihr Turm gegen seinen Springer, aberwitzig, der Rückweg abgeschnitten. Wenn er blieb: Demütigung. Wenn er ging: der Abgrund.
Er ließ sich in seinen Sessel zurücksinken, ein mit Messingnägeln beschlagenes Ledermonstrum, das an mittelalterliche Folterinstrumente erinnerte. Sie hatte noch nie etwas für Neogotik übriggehabt, und noch nie so wenig wie jetzt. Er schlug die Beine übereinander, legte den Kopf schief und sah sie an, nachsichtig oder mitleidig, und sie wandte sich ab. Sieben Wochen und ein Tag klang auch irgendwie nach Mittelalter, wie aus dem Erlass eines alten Assisengerichts. Ihr kam der beunruhigende Gedanke, dass seine Klage vielleicht berechtigt war. Lange Jahre hatten sie ein anständiges Sexleben gehabt, regelmäßig und lustvoll unkompliziert, an Wochentagen frühmorgens gleich nach dem Aufwachen, bevor die alles erdrückenden Tagesgeschäfte sich durch die schweren Schlafzimmervorhänge drängten. An Wochenenden nachmittags, manchmal nach dem Tennis, geselligen Doppeln am Mecklenburgh Square. Das ließ alle Schelte für die verpatzten Schläge des Partners vergessen. Ja, ein höchst angenehmes Liebesleben, auch zweckmäßig, insofern, als es sie geschmeidig in den Rest ihres Daseins entließ; und nie wurde ein Wort darüber verloren, auch das war schön daran. Nicht einmal ein Vokabular hatten sie dafür – einer der Gründe, warum es ihr weh tat, ihn jetzt davon reden zu hören, und warum sie das langsame Schwinden von Leidenschaft und Häufigkeit kaum bemerkt hatte.
[28]