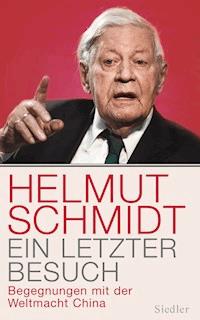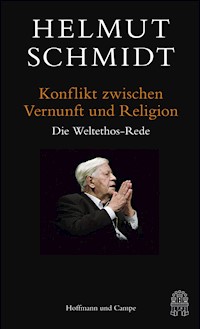12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Pantheon
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wie Kinder und Jugendliche das »Dritte Reich« erlebten
Sieben befreundete Menschen erzählen von der Zeit, als sie beim BDM und der Hitlerjugend waren, von Gewissensnöten und den Ängsten im Krieg. Sie hatten ganz unterschiedliche Schicksale, und der prominenteste von ihnen – Helmut Schmidt – hat sie vor Jahren schon zusammengebracht, damit sie Zeugnis ablegen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 456
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Das Unbegreifliche begreifen
WOLF JOBST SIEDLER, 1992
Es scheint sehr schwer zu sein, sich in eine vergangene Welt hineinzudenken. Das wird gerade jetzt wieder deutlich, wo die Lebenswirklichkeit des eben erst untergegangenen sozialistischen Systems uns plötzlich fern und fremd geworden ist. Was eben noch Gegenwart war, ist mit einem Mal ein Gegenstand von Vergangenheitserkundung geworden, von Geschichtsschreibung.
Nur mit Mühe macht man sich heute deutlich, wie die Menschen die Herrschaft des zerbrochenen Sozialismus erfuhren und wie sie wirklich unter ihm lebten. Der Stasi-Verdacht, unter den inzwischen fast jedermann geraten ist, macht deutlich, daß nachträglich schon ein Gespräch mit den Behörden des Staates verdächtig macht. Die Grenzen zwischen Tätern und Opfern sind undeutlich geworden, und plötzlich muß sich rechtfertigen, wer mit dem Bestehenden einen Modus vivendi zu finden suchte. Aber schien die Macht nicht gestern noch für alle Zeiten gesichert? Für die drinnen wie für die draußen?
Schon vor zwei Jahrzehnten sprach ein bekanntes Buch von den Deutschen im anderen Teil des gemeinsamen Landes als von fremden Nachbarn und meinte damit die Schwierigkeit, den Menschen gerecht zu werden, die das Schicksal in die Welt östlich der Elbe gestellt hatte. Der Schritt über die Grenze machte auf den ersten Blick schon deutlich, daß es mehr war als die fremden Hoheitszeichen, die das eigene Leben von dem sozialistischen Herrschaftsgebiet trennte. Dort nannte man ein Brathähnchen einen Broiler und sprach von den altvertrauten Schrebergarten-Lauben als von Datschen. An solchen sprachlichen Wendungen wurde deutlich, daß es ein anderes Klima war, das das Leben diesseits und jenseits der Barriere bestimmte.
Das alles fand erst gestern statt; wir haben es sozusagen mit unserer Gegenwart zu tun. Wieviel ferner ist uns die andere Herrschaft gerückt, die nun schon ziemlich genau sechs Jahrzehnte zurückliegt. Wurde der Nationalsozialismus denn eigentlich, aus der Nähe betrachtet, als Gewaltherrschaft verstanden? Hatten die Menschen das Gefühl, einer Diktatur unterworfen zu sein? Eines der bedeutenden Bücher, das über Verlauf und Zerbrechen des Dritten Reiches geschrieben wurde, hatte den Titel »Verführung und Gewalt«, und es wollte damit zum Ausdruck bringen, daß die Nachlebenden allzu leicht von einem Terrorregime sprachen, wo viele Mitlebende vor allem Vitalität, Energie und Aufbruch erlebten; zeitweise wohl auch Glanz.
Das Ausmaß der Verbrechen des Regimes bestimmt heute alles Sprechen über das Leben in der damaligen Zeit; angesichts von Auschwitz scheint es unmöglich geworden, von den kleinbürgerlichgemütlichen Zügen zu sprechen, die das Regime auch hatte. Nach dem Untergang des Reiches schien es, als hätten Reglementierung, Verfolgung und auch Terror die ganze Wirklichkeit der Menschen beherrscht. Unterdrückung war aber nur das eine Gesicht des Dritten Reiches, das andere war Zustimmung, die sich den Besuchern aus dem Ausland für viele Jahre in einem Maße aufprägte, das die inneren Gegner des Regimes, die späteren Verschwörer, verzweifeln ließ. Nicht die Instrumente der Unterdrückung drängten sich dem fremden Beobachter auf, sondern die freiwillige Folgsamkeit, die auf Akklamation weithin eher bauen konnte als auf Furcht.
Das läßt sich aus dem Abstand von mehr als einem halben Jahrhundert schwer begreifen, vor allem da sich die vergangene Wirklichkeit allmählich verwischt und unkenntlich wird. In den Dokumenten der Historiker spielen die Sonnenwendfeiern der frühen dreißiger Jahre eine gewisse Rolle, aber es ist schwer, einen Überlebenden zu finden, der jemals eines jener germanischen Thing-Spiele mitgemacht hat, die in der Tat in den Anfangsjahren hier und da praktiziert wurden. Aus dem Vokabular einer untergegangenen Welt läßt sich deren Wirklichkeit nur unzulänglich rekonstruieren; das muß bei Wörterbüchern aus unmenschlicher Zeit immer beachtet werden.
Die Heimabende des »Bundes Deutscher Mädel« sind in der Vorstellung der Nachgeborenen Veranstaltungen, die von der Partei reglementiert wurden, aber in Wirklichkeit wurden die Vierzehnjährigen dort vorzugsweise in Handwerksarbeiten unterwiesen und zu gemeinschaftlichem Singen von Volksliedern angehalten. Die Reisen und Sommerlager des Jungvolkes haben natürlich am Ende der Wehrertüchtigung gedient; aber damals wurden sie nicht selten als Befreiung aus der städtischen Welt empfunden und erinnerten mehr an das Leben der Pfadfinder als an das der uniformierten Scharen, als das sich ihr Anblick den Außenstehenden präsentierte. Waren sie sehr verschieden von den Fahrten des »Wandervogels«? Nur das macht ja begreiflich, weshalb die Zwölfjährigen in die »Fähnlein« der HitlerJugend drängten, lange bevor sie Staatsjugend wurde. Schnitzeljagden und Mutproben sind den heute sich erinnernden Siebzigjährigen zumeist deutlicher in Erinnerung als politische Schulungsabende, auf denen die Grundsätze der Partei gelernt werden mußten.
Auch das veränderte sich im Lauf der Jahre. In den letzten Jahren vor dem Kriege hatte die Reglementierung der Jugend eine andere Form angenommen als in den Anfangsjahren, wo noch mancher Enthusiasmus das Erleben bestimmte. In den Kriegsjahren dann beherrschten zwei Jahre kriegerische Triumphe das Leben der Heranwachsenden; dann kam die Zeit der Niederlagen, der Rückzüge und schließlich der Bombenangriffe. Schulungsabende in ideologischer Doktrin traten aber auch dann wenig in Erscheinung. Wer sich heute an jene Zeit erinnert, sieht eher Jahre der Bedrückung als solche der Unterdrückung vor sich, und es ist zu vermuten, daß es bald ähnlich mit Veranstaltungen wie der »Jugendweihe« sein wird, die zur Verwunderung vieler im Westen sich nach dem Fall der Mauer in der Konkurrenz zur Konfirmation und Kommunion behauptet.
Mit dem Abstand der Jahre wird sich auch hier herausstellen, wieviel des vom Regime Inszenierten unfraglicher Lebensbesitz im anderen Deutschland geworden war. Wäre die Zwangsherrschaft stets als Gewaltherrschaft zu erkennen gewesen, hätte sie keine Verführung ausgeübt, die Millionen in ihren Bann zog. Das muß immer im Bewußtsein haben, wer die Vergangenheit zu erfassen sucht.
Eben dieser Bemühung gilt der Band »Kindheit und Jugend unter Hitler«, in dem sich sieben Angehörige der Generation zwischen 1915 und 1935 zusammengetan haben, die auf die eine oder andere Weise ihre Erfahrung von Jugendjahren im Dritten Reich teilten. Sie haben wenig miteinander zu tun; die meisten kommen aus bürgerlichen oder kleinbürgerlichen Kreisen, einige aus Arbeitervierteln. Der eine wurde in Berlin geboren und verbrachte entscheidende Jahre in Schlesien, während die andere aus Hannover kommt, wo sie für die Arbeiterwohlfahrt zur Sekretärin ausgebildet wurde. Zwei junge Leute dienten dann vom ersten Tag des Krieges an in der Armee, in der sie es schließlich zu Offizieren brachten; ein junges Mädchen wurde eine Führerin im »Bund Deutscher Mädel« und hing bis zum Tage des Zusammenbruchs gläubig der Idee an. Zwei Freunde aus Kindertagen zählten aber früh schon zur sozialistischen Arbeiterjugend und gehörten zu jener »Kinderrepublik«, in der sich der Widerstandswille der untergehenden Weimarer Republik eine Bastion schaffte.
Zusammengeführt hat diese Gruppe einerseits der Zufall des Lebens, vor allem aber die frühere oder spätere Nähe zu Helmut Schmidt, der die verbindende Mitte dieses Freundeskreises abgibt. Das eine junge Mädchen heiratete ihn noch während des Krieges, der andere Generationsgenosse wurde, als Helmut Schmidt Kanzler geworden war, Wehrbeauftragter des Bundestags, und wiederum eine Autorin war später eine seiner vertrautesten Mitarbeiterinnen und steht ihm noch heute zur Seite. Es sind persönliche Verbindung und Bindung, die im Hintergrund dieses Buches stehen, und bei seiner Lektüre wird deutlich, daß dieselben Generationserfahrungen die meisten Unterschiede politischer und sozialer Herkunft ausglichen. Das gemeinsame Erleben verband stärker als das familiäre Herkommen.
So ist dieser Band unversehens repräsentativ für eine ganze Altersgruppe geworden, die vom Dritten Reich und vom Krieg geprägt wurde, auch wo sie seinen Lagern und Kriegen entkam. Nach dem Ersten Weltkrieg schrieb Ernst Glaeser einen schnell berühmt gewordenen Roman über jenen »Jahrgang 1902«, dem der Autor selber angehörte. Der Roman sollte schon durch seinen Titel deutlich machen, daß die Zugehörigkeit zum selben Geburtsjahrgang eine Gemeinsamkeit über alles Trennende hinweg schafft.
Von Lebenshintergrund in diesem Sinne ist die Bundesrepublik bestimmt. Drei Generationen haben den Staat von Bonn aufgebaut und getragen. Zuerst kamen die Überlebenden der Republik von Weimar, Konrad Adenauer wie Theodor Heuss, Kurt Schumacher wie Ernst Reuter. Die heutige Republik wird von den Jungen getragen, die nach der Katastrophe aufwuchsen, Kohl wie Engholm. Aber dazwischen waren die damals jungen Leute am Zuge, die Diktatur und Krieg noch als Heranwachsende erlebt hatten und die Vergangenheit mit der Zukunft verknüpften. Das waren Willy Brandt und Helmut Schmidt, die eine ganz neue Epoche für die Bundesrepublik heraufführten, das sozialdemokratische Jahrzehnt. Diese Generation kommt hier zu Wort, und sie erinnert sich an ihre sie prägenden Erlebnisse der Jugendzeit. Das macht die Bedeutung des Buches »Kindheit und Jugend unter Hitler« aus.
Es ist diese Zeitzeugenschaft, die alle Autoren dieses Buches verbindet und die über manche literarische Unbeholfenheit triumphiert. Natürlich ist hier und da sprachliche Laienhaftigkeit zu spüren, aber solche stilistische Unbeholfenheit legt eben Zeugnis ab von der Unmittelbarkeit des Erlebten und Beobachteten. Das Buch will nicht schön, sondern wahr sein, und eben diese Authentizität muß es am Ende rechtfertigen.
Natürlich bezieht das Buch seine Bedeutung vor allem daher, daß einer der Autoren später der Bundeskanzler und eine der maßgebenden Gestalten des neuen Staates wurde; vermutlich wird der Band auch seine Wirkung in der Öffentlichkeit der Rolle verdanken, die Helmut Schmidt erst nach den in diesem Buch geschilderten Ereignissen gewann. Aber im Grunde ist es eher das Alltägliche, nicht das Besondere, das diese Erinnerungen kennzeichnet.
Keiner der Autoren gehörte dem Widerstand an oder verbrachte Jugendjahre im Zuchthaus. Aber auch keiner spielt eine hervorgehobene Rolle im Dritten Reich; nicht ein einziger war Mitglied der Partei und mußte, als alles vorüber war, »entnazifiziert« werden. Die Autoren gehörten natürlich alle der Staatsjugend an, dem Jungvolk, der Hitler-Jugend oder dem Bund Deutscher Mädel, die einen widerstrebend, die anderen gleichgültig, wenige begeistert. Aber die Ideologie des Nationalsozialismus scheint ihnen allen wenig bedeutet zu haben, eher ein vages Gemeinschaftserlebnis charakterisierte sie und nur sehr selten eine Bindung an die Heilsgestalt, die sich ihnen als Führer präsentierte. Die Jungen absolvierten jene Mutproben, an deren Ende die Verleihung des »Fahrtenmessers« stand, und manche von ihnen waren stolz, wenn sie jenen Lederknoten tragen durften, der die Aufnahme in den Bund Deutscher Mädel symbolisierte. Sie gingen in die »Spielscharen«, besuchten Hochschulen der Partei für Musikerziehung oder für Lehrerbildung. Aber das Eigentliche war doch, daß man zum Beispiel als Bratschistin im BDM seinen jeweiligen Interessen nachgehen durfte – gefangen in einem System, lebte man sein eigenes Leben. War das die wahre Wirklichkeit Deutschlands unter der Herrschaft Hitlers?
Vor ein paar Jahren noch wäre all das Archäologie gewesen, Suche nach den Spuren eines Regimes, das langsam im Dunkel versinkt. Inzwischen ist ein zweites Herrschaftssystem zusammengebrochen, und paradoxerweise ist es das Naheliegende, das uns das Ferne besser verstehen läßt. Die heutigen Historiker, meist ein oder zwei Generationen jünger, haben Mühe, die Wirklichkeit des Dritten Reiches zu begreifen, schon weil die Untaten des Regimes so alles Maß sprengen und die Folgen ganz Europa umgestürzt haben. Man hält es nicht für möglich, daß man im Rahmen dieses Reiches von erschreckender Energie zum Bösen durchaus im Herkömmlichen lebte; man geht von der Allgegenwart des Terrors aus, der auch das alltägliche Leben bestimmt habe.
Aber so war es nicht, und man konnte in dieser Welt sein privates Leben führen und von dem verordneten Reglement wenig Notiz nehmen. Hin und wieder mußte man an Aufmärschen teilnehmen, in Sportstadien dem neuen Reich huldigen und an Ferienlagern in der Schorfheide teilnehmen. Aber den wenigsten ist aus den Jahren des Friedens mehr in Erinnerung geblieben, und vielleicht zählt zu dem eigentlich Bedrückenden, daß die wahre Natur des Dritten Reiches den damals Lebenden so ganz und gar verborgen blieb.
Solange man Schüler war, absolvierte man die Lager in den Sommerferien; aber kam man aus Arbeitervierteln in Hamburg oder dem Häusermeer Berlins, so waren das für das Gefühl Wochen der Freiheit in ungebundener Natur. Was spielte es für eine Rolle, daß hin und wieder ein Fahnenappell stattfand, der durch das abendliche Lagerfeuer bei weitem aufgewogen wurde. Später dann übte man im Arbeitsdienst mit geschultertem Spaten Paraden, und kaum daß man achtzehn geworden war, leistete man seine Wehrpflicht ab, wobei man sich damit behalf, daß das ja in ganz Europa galt.
Wer begriff das alles als Vorbereitung auf einen Eroberungskrieg, der erst Europa zum Ziel hatte und dann die unabsehbare Ländermasse im Osten, wo man »Neubauern« freies Land gewinnen wollte? Aber auch das wurde ja höchst zivil, in klassischen Versen umschrieben: »Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben,/ / Der täglich sie erobern muß! / Solch ein Gewimmel möcht ich sehn, / Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn!«
Goethe wurde im Deutschunterricht häufiger zitiert als die Strophen Schirachs oder Anackers. Sicher, Zerkaulen, Steguweit und Luserke, das waren die Dichter, die an den Schulungsabenden empfohlen wurden; aber die Ausleihzahlen der Leihbüchereien zeigen, daß ganz andere Bücher gelesen wurden: Wiechert, Bergengruen oder von Frank Thieß der Roman von Byzanz mit dem vieldeutigen Titel »Das Reich der Dämonen«, wenn es nicht Saint-Exuperys »Wind, Sand und Sterne« oder Margaret Mitchells »Vom Winde verweht« waren, die Bestseller mitten im Dritten Reich.
Solche Dinge werden zumeist mit dem Blick von heute gesehen, aus dem Nachhinein. Damals, als die »Kindheit und Jugend unter Hitler« stattfand, empfand man besten- oder schlimmstenfalls das ständige Reglementieren, das aber weniger bedrohlich als lästig war. Die Pflicht, ein- oder zweimal in der Woche an einem »Heimabend« teilzunehmen, der meist sehr unpolitisch verlief, war das eigentlich Ärgerliche, nicht aber das Wissen, daß dies alles die Jugend zu einem »Volkskörper« zusammenschließen sollte, der ein Werkzeug in der Hand der Staatsführung sein würde, die zu ganz anderem entschlossen war.
Den Nachlebenden kommt es mitunter so vor, als habe es in den dreißiger Jahren gar kein freies Leben mehr gegeben, aber jenseits dieser »Erfassung« der Jugend fand das Leben im Familien- oder Freundeskreis in der alten Manier statt. Keine Heere von fahlen Arbeitslosen bestimmten das Straßenbild mehr; da sah man über die marschierenden Kolonnen hinweg, die ja aber selten genug in Erscheinung traten – bei nationalen Feiertagen, den Erntedankfesten, deren Höhepunkt in Bückeburg stattfand, bei Führer-Geburtstagen und bei ausländischen Staatsbesuchen, wo man dem König von Afghanistan Unter den Linden so zugejubelt hatte wie jetzt dem Duce Italiens auf dem Reichssportfeld.
Schaut man zurück, so kommt einem die Epoche des Dritten Reiches als eine einzige Zeit des Feierns vor; die Städte waren eigentlich unaufhörlich beflaggt, und irgendein Erfolg des Regimes wurde ständig gefeiert: die Fertigstellung eines Reichsautobahnabschnitts, die Errichtung eines Koogs in der Nordsee und der Bau einer aus gewaltigen Quadern errichteten Brücke über irgendwelche Ströme im Osten oder in Alpentälern im »Altreich«.
Aber dieses Reich – und mit ihm die Jugend – feierte auch seine vergangenen Niederlagen. Zur Erinnerung an den gescheiterten Putsch von 1923 fanden Totenrituale statt, wo ganze Straßen mit schwarzen Tüchern behängt wurden und bei dumpfen Trommelklängen nächtliche Kolonnen im Fackelschein ewiges Erinnern gelobten. Sollte das die heranwachsende Jugend nicht beeindrucken?
Es ist schwerer, die Normalität des Dritten Reiches zu begreifen als seine verbrecherische Natur, und insofern liegt die Bedeutung des Buches von Helmut Schmidt und seinen Freunden eher darin, daß es vergangene Lebenswirklichkeit sichtbar macht, als daß es eine Erkundung in die Landschaft des Schreckens darstellt.
Wer all das damals aus anderer Perspektive und in vielem anders erlebt hat, wird geradezu darauf gestoßen, wie partiell unser Wirklichkeitsbild immer ist und mit welcher Vorsicht man Memoiren begegnen muß. Nicht daß sie fälschen oder gar lügen, sondern daß jeder nur seine eigene Wirklichkeit erzählt, macht sie zu so unzuverlässigen Zeugen des Gewesenen. Vor mehr als einem Jahrzehnt hat der Autor dieser Einleitung eigene Erinnerungen an seine Jugend im Dritten Reich zu erzählen gesucht, und so sei der Passus hier eingerückt, wie er damals in einer Rede zur Eröffnung der 750-Jahr-Feier Berlins gegeben wurde.
Wenn man noch immer in demselben Berliner Haus lebt, in dem man seine Kindheit verbrachte und Abschied von Eltern und Großeltern nahm, macht es keine Mühe, Empfindungen der Anhänglichkeit an die Stadt seines Lebens zu entwickeln. Fallen die Stationen des eigenen Weges aber mit denen des Gemeinwesens zusammen, so schimmert durch beiläufige Erinnerungen die Epoche hindurch. Berlin, das war der Schulweg durch stille Villenstraßen, in denen das Geräusch des Rasensprengers deutlicher zu hören war als der Marschtritt der Bürgerkriegsarmeen, die ja längst entmachtet waren, die eine Seite wie die andere, SA wie Rotfront. Nahm der Zehnjährige etwas wahr von der Wirklichkeit des Dritten Reiches, wenn er mit den Eltern in den großen Ferien an die See fuhr, die Bäder auf Usedom oder Wollin? Wohl nur, daß auf den Strandburgen Feldzeichen gleich verschiedene Fähnchen im Seewind knatterten, die pommerschen Farben hier, die preußischen dort, wenn es nicht Phantasieflaggen waren, die kaiserliche Standarte oder der Nivea-Wimpel. Die Doppeldecker jedenfalls, die oben über die Steildünen Spruchbänder zogen, warben für Zigarettensorten, Kurkonzerte und Seebäderdienste nach Rügen oder Zoppot. Politische Parolen sind dem Rückschauenden nicht im Gedächtnis.
War es eher die Normalität als die Vulgarität, die wenige Jahre später dem Internatsschüler an Berlin auffiel, wenn er aus der Hermann-Lietz-Schule in Thüringen zu den Ferien ins elterliche Haus zurückkehrte? Im dörflichen Ettersburg wie im kleinstädtischen Weimar hatte man beim Bäcker mit dem Namen des »Führers« grüßen müssen, wenn man einen Mohrenkopf oder einen Amerikaner verlangte; mit dergleichen hätte man sich in der Reichshauptstadt lächerlich gemacht.
Aber inzwischen war die Unschuld dahin. Der Pücklersche Park der Schloß-Schule Ettersburg grenzte ja an den Forst von Buchenwald, und zwischen Haselnußsträuchern und Robiniengebüsch war man beim morgendlichen Waldlauf auf Warnschilder mit dem Totenkopf gestoßen, der auf elektrisch geladene Sperrzäune aufmerksam machte; hin und wieder war es vorgekommen, daß die Schüler nachts durch Alarmsirenen und Hundegebell geweckt wurden. Die Dorfbewohner erzählten am nächsten Morgen, daß ein Häftling – womit man sehr ungenaue Vorstellungen verband – einen Fluchtversuch gemacht oder im geladenen Drahtverhau den Tod gesucht hatte.
Da kehrte man dann nach Berlin wie in die Geborgenheit zurück; schon im Internat hatte man die Spielpläne studiert, und zu Hause galt die erste Sorge Grabbes »Hannibal« in Heinrich Georges Schiller-Theater und Shaws »Heiliger Johanna« in der Volksbühne. Das war in den Osterferien des Jahres 1940 gewesen, in vier Wochen würde der Frankreich-Feldzug beginnen. Als er vorüber war, hatte die Mutter, deren Vater schon in den ersten Schlachten 1914 als Regimentskommendeur gefallen war, am Tage der Siegesparade in Paris sich am Familientisch verwundert, daß »dem Mann« alles in ein paar Wochen gelinge, was im ersten Krieg in vier langen Jahren fehlgeschlagen war. Da hatte der Vater nur knapp bemerkt, mit der Parade der Deutschen auf den Champs-Elysees fange es an und mit der Parade der Russen Unter den Linden werde es enden. An der Tafel, der Vierzehnjährige verfolgte jedes Wort, hatte man eingeworfen, man dürfe es mit dem Haß auch nicht übertreiben, diesmal seien die Russen die Verbündeten, nicht die Gegner. Unvergeßlich die väterliche Antwort in das Schweigen hinein: »Es fragt sich nur, wie lange noch.«
Das war Berlin in jenem Sommer 1940. In den benachbarten Häusern fanden im Herbst die Gartenfeste statt, auf denen die Tanzstundenfreunde der Schwester als dekorierte junge Offiziere von den Tabletts die Fruchtgetränke nahmen; schräg gegenüber der neunzehnjährige Fahnenjunker Pabst von Ohain hatte das Glück einer Verwundung gehabt, die es ihm erlaubte, einen Stock mit einer Silberkrücke zu tragen und sich elegant darauf zu stützen. Im Jahr darauf kamen aus Afrika und Rußland die Anzeigen mit den Kreuzen des Abschieds; in den Zeitungen, die man zu Hause las, war von stolzer Trauer selten die Rede; die Wendung vom Tod für Führer und Vaterland gab es in den Trauerkarten der Verwandten nicht.
Noch einmal zwei Jahre, und der Siebzehnjährige fand sich wegen einer Sache in der Zelle, die das Gericht Heimtücke und Wehrkraftzersetzung nannte; erst nach einem Dreivierteljahr wurde er gnadenweise zur Frontbewährung entlassen. Die Halbwüchsigen, zu denen als bester Freund der Sohn Ernst Jüngers zählte, der später bei einem Himmelfahrtskommando an der italienischen Front fiel, hatten zudem noch Lebensmittelkarten für Juden gesammelt, die hier in Kohlenkellern und dort auf Dachböden versteckt lebten. Otto Hahn, der spätere Nobelpreisträger und enge Freund des Vaters, hatte sie verteilt, ohne daß die Sechzehnjährigen wußten, wer die Empfänger waren.
Man hat nur noch in Erinnerung, daß man darüber und überhaupt über vieles nicht sprechen durfte, wenn das Mädchen gerade servierte, wie sie denn ihren freien Tag bekam, wenn Freunde der Eltern mit dem Judenstern kamen. Begriff man die ganze Ungeheuerlichkeit der Verfolgung derer, die eben noch zu einem gehörten? Was ist politische Leidenschaft, was jugendlicher Widerspruchsgeist, wenn Siebzehnjährige gegen die Epoche rebellieren? Der sich Erinnernde läßt es dahingestellt.
Schemenhaft sind die Erlebnisse in der Zelle zurückgeblieben; die Tage im Zuchthaus vergehen einer wie der andere und markieren sich wenig im Gedächtnis. Aber da ist jener Besuch Ernst Jüngers in der Strafanstalt, der den eigenen Sohn und dessen Freund im Raum des Wachhabenden aufsuchte und in der Uniform des Offiziers aus dem Pariser Stabe Stülpnagels kam. Jünger pflegte wenig Aufhebens von seinen Orden aus dem Ersten Weltkrieg zu machen, aber diesmal hatte er den Pour le Mérite angelegt, was an solchem Ort fast eine Provokation war. Den tadelnden Blick des Kommandanten beschied er mit einem einzigen Satz: »Ja, das ist in diesen Zeiten die einzige Gelegenheit, da man seine Orden anlegen darf – wenn man seine Söhne in der Zelle besucht.«
Und eine andere Reminiszenz, unvergeßlich hat sie sich dem Siebzehnjährigen eingeprägt. Im Keller, wohin während der fast ständigen Luftangriffe auch die Todeskandidaten in Fesseln geführt wurden, war er mit einem zum Tode verurteilten jungen Oberleutnant zusammen, der über die Untaten des Regimes sprach – Demütigungen, Folterungen, Hinrichtungen. Nur, daß es Todesfabriken im Osten gebe, das sei natürlich britische Kriegspropaganda wie während des Ersten Weltkriegs die Legende von den abgehackten Kinderhänden in Belgien. So etwas sei undenkbar, wie schreckenerregend die SS in den besetzten Ostgebieten auch wüte. Zehn Tage später wurde der junge Offizier hingerichtet. Noch im Angesicht des Richtblocks hielt man Treblinka nicht für möglich.
Aus den kurzen Tagen des Abschiedsurlaubs zwischen Zuchthaus und Front ist nur weniges deutlich in Erinnerung, Furtwängler in der unzerstörten Philharmonie und Gründgens in dem gerade wieder aufgebauten Schinkelschen Schauspielhaus, vor allem aber die Familie im Garten, der am Nachmittag verlassen werden mußte, der rußigen Asche wegen, die aus der brennenden Innenstadt herüberwehte. Dann der allerletzte Abend vor dem Aufbruch, als die jüdische Nenntante Else Meyer – auch ihr Mann war schon im August 1914 als Bataillonskommandeur im Regiment des Großvaters gefallen – zum Lebewohl kam und zur Erinnerung eine Ziertasse mit dem Brandenburger Tor brachte. Am nächsten Morgen mußte sie sich um drei Uhr früh am Bahnhof Grunewald zum Transport nach Osten einfinden.
Wußte die Achtzigjährige, was sich hinter dem Wort »Umsiedlung« verbarg? Sie sprach jedenfalls vom Wiedersehen – »wenn alles vorüber ist«. Die letzten Tage hatte sie in ihrer Wohnung in Lichterfelde-West in der Nähe der alten Kadettenanstalt mit Aufräumen, Silberputzen und Staubwischen verbracht. Niemand solle sagen können, sie habe eine Judenwirtschaft hinterlassen.
Vor einem lag die Front, mit der aber nach dem Vorausgegangenen nicht Gefühle der Bedrückung, sondern der Befreiung verbunden waren. Glanzvoll war nichts mehr, was man erlebte, Verwundungen und Rückzüge. Erst vier Jahre später, Ende 1947, kehrte man, vom Glück begünstigt, aus der Gefangenschaft zurück – Glück, daß die Familie es überstanden hatte; Glück, daß es noch das Haus der Kindheit gab, wenn auch erst von den Russen, dann von den Amerikanern beschlagnahmt; Glück, daß Berlin noch da war und das eigene Viertel im richtigen Sektor lag. Da waren die vertrauten Straßen des erst ein paar Jahre, aber Geschichtsepochen zurückliegenden Schulwegs, da war, als das Haus sehr bald freigegeben wurde, das Zimmer mit den vertrauten Möbeln, der Garten mit den Bäumen, in deren Ästen man eben erst geklettert war. Nur die Stämme waren immer unmerklich gewachsen, an ihrem Umfang hatte man das Verstreichen der Zeit abgelesen, nach der Schulzeit, nach der Haftzeit, nach den Kriegsjahren – Verheißungen der Dauer.
Wie wäre an Weggehen zu denken gewesen? Die Familie war hier seit je zu Hause gewesen, über die Generationen hinweg. Da war die Kadettenanstalt, wo der ungekannte Großvater als junger Hauptmann Taktik gelehrt hatte; dort war das Brandenburger Tor, auf das der Vorfahr die Quadriga gestellt hatte; wo war das Haus, von wo der andere Ahn, Zelter, seinem Freund Goethe immer die erbetenen Teltower Rübchen schicken mußte?
Und dann die Ungenannten und Unbekannten, von denen man ebensoviel und vielleicht mehr in sich trug, Handwerksmeister in der Mark, die Kaufleute Gerson am Werderschen Markt, Prediger in den alten Kirchen, der Kupferstecher Schmidt, Feldwebel, Justizräte. Ganz zum Schluß noch der Bruder des Vaters, Eduard Jobst, der das Buch über die märkische Stadt im Mittelalter schrieb und dann für die Weimarer Republik die Reichskanzlei baute, die Hitler so haßte, daß Speer sie umbauen mußte.
Um 1870 starben achtzig Prozent der Deutschen in dem Ort ihrer Geburt; um 1880 waren es nur noch zwanzig Prozent gewesen. Sollte man den Zufall der Beständigkeit, unerworbenes Privileg, in den Wind schlagen? Man blieb sein weiteres Leben in Berlin, das die Stadt des Lebens ist.
Kindheit und Jugend unter Hitler – auch so also wurden sie erlebt. Mehr das Herkommen als die eigene Gesinnung mag das Tun und Lassen geprägt haben; letzten Endes entscheidet immer das Allgemeine das Persönliche. Das gilt in beiden Richtungen, für den Widerstand wie für das Mitmachen. Wäre es sonst begreiflich, daß im Dritten Reich wie im Sozialismus so vieles widerspruchslos hingenommen wurde, was den Söhnen und Enkeln unbegreiflich ist?
Nach den Ereignissen versuchte man beide Male die Schuldigen herauszufinden und auszusondern. Man weigerte sich, mit dem Mantel des Verstehens und Schweigens zuzudecken, was in der Zeit der Verwirrung geschah. Aber das Vergessen ist eine Tugend, die das Weiterleben ermöglicht.
Hermann Lübbe hat die Nachsicht Adenauers gerechtfertigt, der die einstigen Parteigenossen, so sie nicht von eigener Schuld beladen waren, in den Staat von Bonn aufnahm, statt sie durch Zurückweisung in die Isolierung zu drängen. Wie sonst, fragte Lübbe, hätte aus dem Staatsvolk des Dritten Reiches die Bürgerschaft der Republik werden sollen?
Wahrscheinlich ist das die Lehre, die das Dritte Reich für die aus der zweiten Diktatur Auftauchenden bereithält – und auch die Lektüre dieses Buches.
Gezwungen, früh erwachsen zu sein
LOKI SCHMIDT
Kindheit und Volksschulzeit bis etwa 1931
Ein Bericht über meine Jugend und die Zeit von 1933 bis 1945 wäre unvollständig, wenn ich nicht auch die Erlebnisse der Jahre davor beschriebe, so gut ich sie noch im Gedächtnis habe. Immerhin wurde ich 1933 bereits vierzehn Jahre alt.
Geboren wurde ich am 3. März 1919 im Arbeiterviertel Hammerbrook in der Schleusenstraße in Hamburg. Das Haus, in dem ich zur Welt kam, war in der Gründerzeit gebaut worden, aber sicherlich nicht für eine Arbeiterfamilie; denn die Wohnung hatte fünfeinhalb Zimmer, in denen damals acht Menschen wohnten: meine Großeltern Agnes und August Martens, drei ihrer vier erwachsenen Töchter (meine Mutter war die Älteste), ihr Schwiegersohn – mein Vater – und eine Pflegetochter, Thora, ein Nachbarskind, deren Mutter gestorben war.
Meine Großeltern hatten alle vier Töchter einen Beruf erlernen lassen, gewiß ungewöhnlich für die Zeit der Jahrhundertwende und für die Kinder einer Köchin und eines Polsterers, der später Krankenbesucher der Ortskrankenkasse wurde. Meine Mutter wurde Schneiderin, ihre drei jüngeren Schwestern Kontoristinnen. Ende Februar 1919 hatte der Umzug aus einer kleinen Wohnung in die Schleusenstraße stattgefunden, wo meine Eltern, Gertrud und Hermann Glaser, zwei ineinander übergehende Räume bekommen hatten. Am 2. März gab es die große Einweihungsfeier – und am nächsten Morgen kam ich zur Welt.
Ich erinnere mich an wenig aus diesen ersten Jahren, außer daß immer viele Menschen im Haus waren. Abgesehen von meinen Großeltern und den Tanten kamen viele Freunde; jede Gelegenheit wurde genutzt, um zu feiern, mit selbstgedichteten Theaterstücken und Liedern und viel Krepp- und Seidenpapierdekoration. Wurden mir die Vorbereitungen zuviel, verkroch ich mich mit meiner schwarzweißkarierten, von meiner Mutter genähten Puppe Laura unter einen Klapptisch, der noch nach dem Krieg im Haus meiner Großeltern in der Heide stand.
Ein Eindruck aus diesen Jahren ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. Meine Großmutter war krank. Als ich sie besuchte, stand an ihrem Bett eine wunderbare dunkelrote, halbgeöffnete Rosenknospe, die auf einem Blütenblatt in Goldbuchstaben die Aufschrift »Gute Besserung« trug. Wohl kaum hat eine Blüte später je wieder so einen Eindruck auf mich gemacht wie diese Rose, die Tante Anni geschickt hatte, Tante Anni, die – ebenso wie ihre wenig ältere Schwester, Tante Toni – damals für uns einfach eine Freundin der Großeltern war wie viele andere auch. Im Rahmen dieses Berichtes muß aber etwas ausführlicher von ihr und ihrer jüdischen Familie, den Mendels, erzählt werden.
Toni und Anni Mendel waren von meiner Großmutter, nachdem diese mit fünfzehn Jahren aus der Schule gekommen war, als Kindermädchen betreut worden. Als die beiden Mädchen eingeschult wurden, lernte Großmutter bei Frau Mendel kochen, später führte sie ihr den Haushalt, und als sie mit fünfundzwanzig Jahren heiraten wollte, mieteten die Mendels, die wohlhabend gewesen sein müssen, für das junge Paar eine kleine Wohnung in ihrer unmittelbaren Nähe, so daß meine Großmutter den Mendelschen Haushalt weiterführen konnte.
Auch als die alten Mendels starben, blieb die freundschaftliche Verbindung. Annis Tochter Renee war einige Jahre älter als Helmut und ich und ging auch auf die Lichtwarkschule, bis Mutter und Tochter 1933 noch rechtzeitig nach Frankreich ausreisten. Toni heiratete Hans Riekmann, Geiger im Hamburger Symphonieorchester und, wie es damals hieß, »arisch«. So hofften wir alle, daß ihm und Tante Toni nichts passieren würde, denn obwohl wir nicht wußten, was passieren konnte, gab es doch gegen Kriegsbeginn vage Gerüchte von Deportationen. Gerüchte über Konzentrationslager erzählte mir nur mein Vater, der von Arbeitslagern für Kriminelle, aber auch für politisch Oppositionelle und Juden gehört hatte. Wir erregten uns über die Ungerechtigkeit; von den schrecklichen Konsequenzen und von den Vernichtungslagern jedoch erfuhren wir erst viel später, kurz nach dem Krieg.
Nach 1938 wurde Hans Riekmann bedrängt, sich scheiden zu lassen. Nachdem er es immer wieder abgelehnt hatte, schien es Toni und ihm eines Tages nicht mehr sicher genug in ihrer Wohnung, und von da an übernachteten sie bei ihren vielen Freunden, mal hier, mal da, auch bei uns – auf dem Boden. Kurz vor Kriegsende wurden sie dann doch noch in das KZ Neuengamme gebracht, glücklicherweise aber nach wenigen Wochen von den Engländern befreit.
Doch zurück ins Jahr 1922. Meine Eltern haben damals eine eigene Wohnung gefunden. Ich erinnere mich an den Umzug: Auf einem Handwagen zogen mein Vater und einige seiner Freunde nach Arbeitsschluß unsere Habseligkeiten quer durch die halbe Stadt, vom Hafen nach Borgfelde. Da es schon dunkel war, hing eine Papierlaterne am Wagen. Meine Mutter schob den Kinderwagen mit dem Baby, mein Bruder saß am Fußende, und ich marschierte nebenher.
Die neue Wohnung war Ende des vorigen Jahrhunderts gebaut worden, ein sogenanntes Terrassenhaus, im Hinterhaus gelegen, dunkel und primitiv und nicht größer als achtundzwanzig Quadratmeter, aber billig: siebenundzwanzig Mark im Monat, etwa ein Wochenlohn meines Vaters. In die beiden Vorderzimmer schien nur selten die Sonne. Die Küche und das vier Quadratmeter große Schlafzimmer meiner Eltern, zur Hälfte mit einem selbstgezimmerten Bettrahmen ausgefüllt, waren noch düsterer, denn die nächste Häuserreihe – die nächste »Terrasse« – war nur vier Meter entfernt. Es gab dort einen Wasserhahn mit Ausguß gleich neben der Haustür in der Küche, doch keinen Flur, auch kein Badezimmer und kein WC. Letzteres befand sich draußen im Treppenhaus, fensterlos. Das Wohnzimmer besaß einen kleinen Ofen und war mit einem ovalen Tisch, einem Sofa und drei Stühlen möbliert, während der vierte Stuhl vor der Nähmaschine am Fenster stand; außerdem gab es dort zwei schmale Bücherschränke, die mein Vater gebaut hatte. In dem zweiten Vorderzimmer waren unsere drei Gitterbetten und der Familienkleiderschrank untergebracht. Der große Kohlenherd in der Küche wurde nur im Winter benutzt; meine Mutter kochte auf einem kleinen Gasherd, der auf dem großen Ofen stand. Mit Gas wurden auch Küche und Wohnzimmer beleuchtet. Leider gingen die Topfpflanzen, die mein Vater häufiger vom Blumenmarkt mitbrachte, bei der Gasbeleuchtung schnell ein; daß allerdings die Gasdämpfe möglicherweise auch für uns schädlich sein könnten, bedachte damals niemand. Ich fand die Wohnung herrlich, weil sie uns allein gehörte.
Unser Leben war äußerst bescheiden. Fleisch gab es höchstens einmal in der Woche, dafür aber viel gedünstetes Gemüse. Meine Mutter hatte in der Volkshochschule früh von Bircher-Benner und seiner Ernährungslehre gehört, und so bekamen wir häufig Bananen-und Gurkenscheiben, getrocknete Feigen und Weißkäse als Brotbelag.
Überhaupt spielte die Volkshochschule in unserem Elternhaus eine große Rolle. Mein Vater wie meine Mutter hatten acht Jahre lang die Volksschule besucht und danach die einjährige Selekta, die einzige Möglichkeit, die begabte Kinder aus finanzschwachen Familien hatten, noch ein bißchen mehr zu lernen; denn alle Gymnasien oder »höheren Schulen«, wie es damals hieß, kosteten ein beträchtliches Schulgeld. So besuchten meine Eltern zwei- bis dreimal in der Woche einen Kursus der Volkshochschule,hörten Vor-und Frühgeschichte, lernten viel über das Bauhaus und über die modernen Hamburger Backsteinbauten von Schumacher und Höger, wurden angeregt, Vögel und Tiere zu beobachten, und erfuhren einiges vom französischen Impressionismus und deutschen Expressionismus.
Ein neuer Lebensabschnitt begann, als wir in die Schule kamen. Thora, die Pflegeschwester meiner Mutter, die arbeitslos war und kaum Unterstützung bekam, versorgte unseren Haushalt. Sie schlief im Wohnzimmer auf dem Sofa. So konnte meine Mutter tagsüber zum Nähen gehen. Sie bekam dafür meistens fünf Mark pro Tag und gutes Essen, vor allem aber brachte sie abgetragene Kleider mit, aus denen sie uns Kindern etwas zum Anziehen nähen konnte, denn fertige, gekaufte Kleidung gab es bei uns nicht. Pro Jahr bekam jedes Kind ein paar Schuhe, die mein Vater, wenn sie entzwei waren, besohlte.
Als Betriebselektriker beim Arbeitsamt verdiente mein Vater wenig. Aber mit dem Geld, das meine Mutter dazuverdiente, wurden die Eltern, die Pflegetante und wir drei Kinder satt, und es reichte auch noch für einige Volkshochschulkurse und – ab und zu – zum Kauf eines Buches. Außerdem wurde in unserer kleinen Wohnung mit Freunden der Eltern viel gesungen. Und so bekam ich trotz des knappen Geldes seit 1925 Geigenunterricht.
Unsere Eltern schickten uns in eine der fünf »Versuchsschulen«, die es in dem pädagogisch besonders lebendigen Hamburg gab: in die Burgstraße 35. Dort versuchten pädagogisch engagierte Lehrer, im Unterricht und in der Erziehung neue Wege zu gehen. Alle Klassenräume hatten – ungewöhnlich für die damalige Zeit – Tische und Stühle, bei deren Herstellung die Eltern mitgeholfen hatten, wie überhaupt die enge Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Eltern eine große Rolle spielte. Es gab Nachmittage, wo alte Kleidung für bedürftige Schüler geflickt und geändert wurde, außerdem gab es neben dem Unterricht Gymnastik- oder Werkkurse, einen Theaterkreis und ein Orchester, in dem Eltern, Lehrer und ehemalige Schüler zusammenspielten, und auch ich gehörte dem Orchester lange Jahre an. Vor allem aber gab es das Schulheim an der Kieler Förde, das für die meisten Kinder die einzige Möglichkeit bot, einmal zu verreisen.
Fast alle Kinder in der Burgstraße kamen aus Arbeiterfamilien, von denen es den meisten finanziell ähnlich schlechtging wie uns. Ihre Eltern hatten diese pädagogisch fortschrittliche Schule in der Hoffnung gewählt, daß ihre Kinder dort besonders befördert wurden. »Wissen ist Macht« – die Baconsche Formel war ein Schlagwort der damaligen Arbeiterschaft.
Jahre später – vielleicht um 1933 herum – fragte ich meine Eltern einmal, ob sie nie in einer politischen Partei gewesen seien. Beide hatten der USPD angehört, waren aber von dem kleinlichen Parteigezänk so abgeschreckt worden, daß sie bald austraten und niemals wieder einer Partei angehörten. Ich vermute, daß sie vor 1933 SPD, möglicherweise auch KPD wählten. 1933 – ich war damals vierzehn Jahre alt – sagte mein Vater zu mir: »Diese Wahl bedeutet Krieg.« Auf meine Nachfrage meinte er nur: »Ich kann es dir nicht erklären, ich will dich nicht beeinflussen.« Seine ernsten Worte habe ich nie vergessen.
1929 war meine jüngste Schwester Rose geboren worden, wodurch unsere Wohnung endgültig zu klein für uns wurde, so zogen wir um in einen Neubau für kinderreiche Familien in Hamburg-Horn. Die Wohnküche von zwanzig Quadratmetern umfaßte eine Kochnische, eine kleine Loggia, eine Speisekammer und einen Müllschlucker. Mein Bruder bekam ein sechs Quadratmeter großes Zimmer für sich allein, allerdings mußte er es mit dem Familienkleiderschrank teilen; wir beiden größeren Mädchen erhielten ein neun Quadratmeter großes Zimmer. Meine Eltern schliefen mit dem Baby in einem großen Zimmer von sechzehn Quadratmetern; später zogen wir drei Mädchen in dieses Zimmer, und meine Eltern behalfen sich mit dem kleinen. Es gab ein richtiges Badezimmer mit Wanne und Boiler und ein WC, außerdem hatten alle Räume Zentralheizung.
Arbeitslosigkeit
Als mein Vater 1931 arbeitslos wurde, fingen bei uns viele Schwierigkeiten an. Unsere neue Wohnung von etwa sechzig Quadratmetern gefiel uns zwar, kostete aber monatlich 77 Mark Miete. Ich weiß nicht, wie hoch die Arbeitslosenunterstützung meines Vaters war; ich weiß nur, daß das Geld niemals reichte, und wenn wir auch schon immer viele Dinge selbst gemacht hatten, mußte jetzt doch noch mehr gespart werden. Mein Vater besorgte, wenn er im Hause war, alle Reparaturen; häufig wurden die Arbeitslosen allerdings auch zu Arbeitseinsätzen eingeteilt: Dann ging es montags mit dem Bus zu Obstbauern ins Alte Land oder zu Erntearbeiten in Hamburgs Umgebung, wo man in Scheunen im Stroh übernachtete, bis man am Wochenende zurückkehrte. Wenn mein Vater nicht zum Arbeitseinsatz mußte, war er den ganzen Tag in der Schule Burgstraße, wo er mit anderen arbeitslosen Vätern nach eigenen Plänen eine zusammenschiebbare Bühne für die Turnhalle baute, und im Spätsommer 1932 fuhr die ganze Gruppe mit dem Fahrrad zweimal in der Woche zum Schulheim bei Kiel, um die Waschräume zu kacheln.
Taschengeld hatten wir vier Kinder schon vorher niemals bekommen. Wenn aber eins von uns Kindern von Nachbarn für eine Hilfeleistung fünf oder sogar zehn Pfennig bekam, wanderte alles in den Familientopf. Am schlimmsten war es, wenn unsere Mutter weinte, weil wirklich kein Pfennig mehr im Haus war. Auch das Einholen auf
Der Wortlaut dieses Buches folgt unverändert der Ausgabe aus dem Jahr 1992; auch das Vorwort von Wolf Jobst Siedler wurde von damals übernommen. Die Beiträge des Bandes sind in den Jahren 1990/1991 entstanden.
Der Pantheon Verlag ist ein Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH.
Erste Auflage
Pantheon-Ausgabe Oktober 2012
Copyright © 1992 by Wolf Jobst Siedler Verlag GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Satz: Ditta Ahmadi, Berlin
eISBN 978-3-641-09088-3
www.pantheon-verlag.de
www.randomhouse.de
Leseprobe