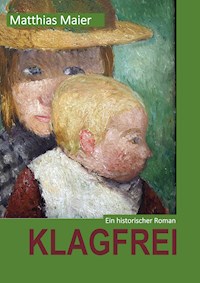
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Roman "Klagfrei" greift einen nie aufgeklärten Kriminalfall auf, der sich zur Zeit der 1848er Revolution im Großherzogtum Baden zutrug. Ein katholischer Dorfpfarrer wird dringend verdächtigt, mit seiner noch minderjährigen Haushälterin ein Kind gezeugt und dieses nach der Geburt getötet zu haben. Mit Hilfe authentischer, aber auch fiktiver und halbfiktiver Quellen wird der Fall neu aufgerollt und in den Kontext des politisch-gesellschaftlichen Um- und Aufbruchs Mitte des 19. Jahrhunderts eingebettet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Matthias Maier
Klagfrei
Ein historischer Roman
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Inhalt
Vorbemerkung
Personentableau
Winter 1918 / 1919
Prolog: Über das Geschichte(n)erzählen
November 1848
Flucht
Asyl
März 1848 – April 1849
Das Ultimatum
Vorläufige Rettung
Der Erzbischof und die Revolution
Ein widersetzlicher Priester
Das Gerücht
Päpstliche Geheimnisse
Ein vertrauliches Gespräch
Ein fragwürdiges Geständnis
Zwiespältige Gefühle
Ritt nach Schwarzach
Streit
Flucht nach vorne
Der Bauern-Patriarch
Die Hand
Gegenwind
Zehn Meter Welt
Ein schmaler Grat
Von Opfern und Tätern
Eine Entdeckung
Wut
Der Prozess
Die Zeugin
Das tote Kind
Der Schlaf des Gerechten
Das Urteil
November 1849 und danach
„Aufreizung in Kanzelreden“
Das achte Gebot
Leben und Sterben
Frühjahr 1919
Epilog: Keine Messe für den Großherzog
Allgemeines Glossar
Glossar der Alemannismen
Zeittafel zur badischen Revolution 1848/49
Rechtsgeschichtliche Anmerkungen
Literatur
Dank
Impressum neobooks
Inhalt
Matthias Maier
Klagfrei
Matthias Maier
Klagfrei
Ein historischer Roman
Impressum
Texte: © 2022 Copyright by Matthias Maier Umschlag: © 2022 Copyright by Ilse Hotz und
Martin Wolff, Berlin; das verwendete Bild ist ein Gemälde von Paula Modersohn-Becker („Brustbild eines Mädchens mit Strohhut und Kind im Profil“, um 1903), Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Paula-Modersohn-Becker-Stiftung, Bremen
Verantwortlich
für den Inhalt: Matthias Maier
Belchenstr. 10
79194 Gundelfingen i. Br.
Druck: neobooks – ein Service der Neopubli GmbH, Berlin
Vorbemerkung
Dieser Roman beruht auf einem authentischen Kriminalfall aus dem Jahr 1848. Fast alle Figuren des Romans sind realen Personen nachempfunden, auch wenn ihnen andere Namen gegeben wurden. Fast alle Ereignisse und Handlungen sind so oder so ähnlich geschehen, wie im Roman beschrieben. Der Leser kann also davon ausgehen, dass auch das, was ihm am unwahrscheinlichsten erscheint, weitestgehend der historischen Wirklichkeit entspricht. Ähnlichkeiten mit der Realität von heute sind weder zufällig noch beabsichtigt, sondern unvermeidbar.
Personentableau
(Die Altersangaben beziehen sich auf das Jahr 1848)
Franz Anton Bellmann, 48 Jahre, Pfarrer von Lichtenau.
Gitte Hoch, 18 Jahre, Hauswirtschafterin bei Pfarrer Bellmann.
Alois Schweighöfer, 50 Jahre, Pfarrer von Kaltenberg.
Anna Hug, 43 Jahre, Hauswirtschafterin bei Pfarrer Schweighöfer.
Emilia Hug, 53 Jahre, Annas Halbschwester.
Wilhelm Hertle, 28 Jahre, Gerichtsassessor am Hofgericht Freiburg.
Johannes Liesegang, 29 Jahre, Rechtsanwalt, befreundet mit Wilhelm Hertle, Verteidiger von Gitte Hoch.
Leonhard Brugger, 55 Jahre, Staatsanwalt am Hofgericht Freiburg.
Katharina Schuler, 40 Jahre, frühere Hauswirtschafterin bei Pfarrer Bellmann.
Josef Halder, 49 Jahre, Bauer und Bürgermeister in Lichtenau.
Karl-Georg Hug, 46 Jahre, Bauer und Bürgermeister in Kaltenberg, Vater von Lorenz und Georg Hug, Bruder von Anna Hug und Halbbruder von Emilia Hug.
Georg Hug, 20 Jahre.
Lorenz Hug, 18 Jahre.
Dekan Schneider, 61 Jahre, Oberkirchen.
Heinrich Baumann, 53 Jahre, Stadtpfarrer in Schwarzach, Initiator des Liberalen Zirkels.
Dr. Dieterle, 38 Jahre, Arzt in Schwarzach, Initiator des Liberalen Zirkels.
Hermann von Vicari, 75 Jahre, Erzbischof von Freiburg von 1842 bis 1868.
Maximilian Brandner, 35 Jahre, persönlicher Sekretär und Berater des Erzbischofs.
Winter 1918 / 1919
„Kunst ist eine Lüge,
die uns die Wahrheit erkennen lässt.“
Pablo Picasso: Picasso speaks. Interview mit der Zeitschrift “The Arts”, 23.5.1923.
Prolog: Über das Geschichte(n)erzählen
Kaltenberg, im Januar 1919
Seit Stunden schneit es. Wie Watte legt sich der Schnee auf die Landschaft, weiß und weich und jedes Geräusch verschluckend. In der leblosen, aber friedlichen Abgeschiedenheit von Kaltenberg, weit weg von der Welt, fühle ich mich sicher. Es ist Ende Januar 1919. Der Krieg, der vier Jahre lang in der Welt da draußen getobt hat, ist zwar seit zweieinhalb Monaten vorbei. Hunger und Kälte jedoch, die vor allem den Menschen in den Städten zu schaffen machen, dauern an. Zudem scheint die fürchterliche Grippeepidemie, die seit letztem Frühjahr in Wellen über Nordamerika und Europa schwappt, noch längst nicht ausgestanden zu sein. Warum man diese Seuche die Spanische Grippe nennt, weiß niemand so genau. Ich habe jedoch irgendwo gehört oder gelesen, dass in der spanischen Stadt Zamora im letzten Jahr besonders viele Menschen von der Grippe dahingerafft worden seien. Der dortige Bischof hielt die Seuche für eine Strafe Gottes, der die moderne Wissenschaft nichts entgegenzusetzen habe. Er glaubte, dass durch gemeinsames Gebet und massenhaftes Küssen von Reliquienschreinen in berstend vollen Kirchen Gott gnädig zu stimmen sei. Doch das erhoffte Wunder von Zamora blieb aus. Die Einwohner der Stadt starben wie die Fliegen.
Ich bin ein so genannter Kriegsheimkehrer. Ich habe das Gemetzel vom ersten bis zum letzten Tag an der Westfront mitgemacht, auf den Vogesenkämmen und in den Schützengräben von Verdun. Ich habe dem Tod in seinen furchtbarsten Erscheinungsformen ins Auge geblickt. Und ich habe überlebt.
Vor dem Krieg war ich Lehrer an der Gewerbeschule in Oberkirchen. Seit Oktober 1918 sind die Schulen geschlossen, weil sie als Quartier oder Lazarett für zurückkehrende Truppen benötigt werden. Die Demobilisierung brachte noch einmal ein Aufbäumen der schrecklichen Grippe mit sich. Sie ist gerade dabei, von den Massenquartieren und Lazaretten mit Tausenden von erkrankten Soldaten auf die Zivilbevölkerung überzugreifen. Ich habe mir deshalb geschworen, diesen relativ sicheren Ort, den kleinen Bauernhof meiner Eltern, der zur Gemeinde Kaltenberg gehört, nicht zu verlassen. Es wäre eine bittere Ironie des Schicksals, wenn ich, nachdem ich den Krieg unversehrt überstanden habe, jetzt der Epidemie zum Opfer fiele.
Der verlorene Krieg hat den Kaiser und die Fürsten hinweggefegt und den Deutschen am 9. November die Revolution gebracht. An diesem Tag wurde innerhalb von wenigen Stunden in Berlin zweimal die Republik ausgerufen. Ein Zeichen für die frühe Spaltung der Revolutionäre: auf der einen Seite die Radikalen um Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, auf der anderen die Gemäßigten, Sozialdemokraten im Gefolge Friedrich Eberts und Liberale. Die Gemäßigten scheinen geradezu panische Angst davor zu haben, dass die Revolution zu weit gehen und ihnen die gerade gewonnene Freiheit wieder entreißen könnte. Sie beantworten die Gewalt der Radikalen mit gnadenloser Gegengewalt. Wenn die neusten Nachrichten aus Berlin stimmen, dann mussten Luxemburg und Liebknecht teuer dafür bezahlen, dass sie mit einem Aufstand die Revolution forcieren wollten. Man berichtet, sie seien brutal ermordet und ihre Leichen wie Abfall ins Wasser des Berliner Landwehr-Kanals geworfen worden.
Es heißt, Geschichte wiederhole sich nicht. In manchen Dingen anscheinend doch. 1848/49, vor siebzig Jahren also, gab es in Deutschland schon einmal eine Revolution. Und ähnlich wie heute, spalteten sich die radikalen Revolutionäre schon frühzeitig von den gemäßigten ab, um ihre politischen Ziele, die sie von den Liberalen verraten sahen, mit Gewalt durchzusetzen. In Baden waren dies vor allem die Rechtsanwälte Friedrich Hecker und Gustav Struve. Sie wollten keine Monarchie mit pseudodemokratischem Anstrich, sondern eine konsequent demokratische Republik ohne ständisches Denken und soziale Ungleichheit. Aber der Erfolg blieb den Radikalen damals wie heute versagt.
Warum muss ich an die Revolution von 1848 denken? Ich bin auf einen interessanten Quellenfund aus dieser Zeit gestoßen. Genau genommen, war es unser Pfarrer, der den Fund gemacht hat. Kurz nach meiner Heimkehr Anfang November kam er an einem Sonntagnachmittag auf unseren Hof und erzählte mir, er habe in einer Holzkiste auf dem Dachboden des Pfarrhauses Unterlagen eines seiner Vorgänger entdeckt. Alois Schweighöfer, von 1843 bis zu seinem Tod im Jahr 1850 Pfarrer in Kaltenberg, habe unter anderem eine Art Tagebuch hinterlassen, in das er unregelmäßig Eintragungen gemacht habe. Der Pfarrer bat mich, die Unterlagen zu sichten und herauszufinden, ob etwas lokalhistorisch Verwertbares darunter sei. Denn er wusste von meinem Interesse an geschichtlichen Themen.
In der Holzkiste befanden sich das erwähnte Tagebuch, Briefe und eine Unmenge von losen Blättern, viele mit Predigtentwürfen, dazwischen auch einzelne Zeitungsartikel, an denen der Zahn der Zeit besonders stark genagt hatte. Auch etliche Ausgaben des Volksführer, einer radikaldemokratischen und kirchenfeindlichen Zeitung, lagen gestapelt in der Holzkiste. Die Papiere waren ungeordnet, da Pfarrer Schweighöfer in einem Alter gestorben war, in dem man gewöhnlich seine Unterlagen noch nicht für die Nachwelt aufbereitet hat. Ich machte mich also daran, die Papiere, das Tagebuch, die Briefe und die Zeitungen zu durchforsten, sie inhaltlich und chronologisch zu ordnen. Die Form der Tagebucheinträge reichten von Stichwortnotizen bis zu ausformulierten Texten, die zumeist auf den jeweils vorangegangenen Notizen beruhten. Bald stieß ich auf einen spektakulären Kriminalfall, der sich in unserer Nachbargemeinde Lichtenau im Revolutionsjahr 1848 ereignet hatte. Pfarrer Schweighöfer hatte Zeitungsartikel zu dem Fall gesammelt. Sie enthielten Schlagzeilen oder Überschriften wie zum Beispiel: Dorfpfarrer soll Neugeborenes getötet haben!
Im April 1849 hatte vor dem für Kapitalverbrechen zuständigen Hofgericht in Freiburg ein Prozess gegen Franz Anton Bellmann, Gemeindepfarrer in Lichtenau, und seine Haushälterin Brigitte Hoch stattgefunden. Der Volksführer titelte nach Abschluss des Prozesses in seiner Beilage am 25. April 1849: Der Kindsmord im Pfarrhaus zu Lichtenau. Der Autor dieses ausführlichen, jedoch äußerst tendenziösen Berichts behauptete vollmundig, nur die reine Wahrheit zu schreiben. Allein der polemische Stil des Berichts gibt Anlass, dies zu bezweifeln.Und die Überschrift suggeriert etwas, was sich im Fazit nicht widerspiegelt.
Es war ein Glück für mich, dass unser Pfarrer weder die Zeit noch das nötige Interesse hatte, den Inhalt der Holzkiste intensiv zu sichten. Sonst wäre er bald selbst auf die Zeitungsartikel gestoßen, die den Fall des angeblichen Kindsmordes in Lichtenau zum Gegenstand hatten. Er hätte mich wohl nicht ins Vertrauen gezogen, sondern die komplette Kiste mitsamt den brisanten Dokumenten sofort an das Erzbischöfliche Archiv in Freiburg geschickt.
Ich wusste sofort, dass ich über diesen Fall schreiben muss. Nicht aus Sensationslüsternheit, denn – der Leser wird mir das sicherlich glauben –Verbrechen und Tod sind nach vier Jahren Krieg für mich kein Faszinosum mehr. Nein, mich reizt viel mehr die Erkenntnis, dass sich in diesem Kriminalfall, der sich in einem kleinen Schwarzwaldtal zutrug, die großen politischen, gesellschaftlichen und kirchlichen Zeitfragen wie in einem Brennglas bündelten. Staat, Kirche und ständische Gesellschaft, die allesamt vor siebzig Jahren immer noch mit einem Fuß im Mittelalter steckten, wurden 1848 in Baden und in ganz Deutschland zum ersten Mal radikal in Frage gestellt.
Darüber schreiben? Wie konnte ich ohne hinreichendes Quellenstudium überhaupt daran denken? Hätte ich nicht wenigstens die Gerichtsakten, sofern diese überhaupt überliefert sind, einsehen müssen, um nicht allzu sehr im Trüben zu fischen? Ein Quellenstudium in Archiven jedoch wird mir aufgrund der noch andauernden gefährlichen Grippeepidemie über Monate hinaus nicht möglich sein, wenn ich meine selbstgewählte Isolation aufrechterhalten will.
Rasch kamen viele Fragen auf: Kann man auf Basis nur spärlichen Wissens, das fast ausschließlich aus einer tendenziösen Quelle stammt, seriös über einen Kriminalfall schreiben? Muss ich mich aufs ungewohnte Terrain der Fiktion begeben, wo ganz andere Regeln gelten als in der Geschichtsschreibung: hier die Regeln des schöpferischen, spannenden Erzählens, dort die Gesetze des gesicherten, quellenbasierten Wissens?
Sind Geschichtsschreibung und Geschichten Schreiben überhaupt so strikt zu trennen? Ich bezweifle nämlich, dass Quellen aus sich selbst heraus eine Geschichte erzählen können. Häufig genug widersprechen sie sich gegenseitig oder sie hinterlassen so viele Leerstellen, dass sie fast sprachlos bleiben. Ich glaube, dass die Historiker irren, wenn sie behaupten, dass die Geschichtsschreibung sagen könne, wie es gewesen ist. Letztlich kann sie nur sagen, wie es gewesen sein könnte. Das ist ihre Wahrheit. Die Geschichte, die hier geschrieben werden muss, wird notgedrungen eine fiktive sein. Und doch wird sie bestrebt sein, der historischen Wahrheit gerecht zu werden.
November 1848
Flucht
21. November 1848
Am Ende des Tals, wo die Straße steil anzusteigen begann und eher einem unwegsamen Viehpfade glich, wäre Bellmann gerne umgekehrt. Aber er war auf der Flucht. Es gab kein Zurück mehr. Je höher er kam, umso stürmischer peitschte ihm der Regen ins Gesicht. Mehr und mehr mischten sich Schneeflocken darunter. Auf der Passhöhe schließlich herrschte dichtes Schneetreiben. Bellmann war am Ende seiner Kräfte. Mantel und Schuhe waren völlig durchnässt, der Hut ließ seine breite, sonst seitlich nach oben gebogene Krempe schlaff nach unten hängen.
Niemand wäre auf die Idee gekommen, an diesem tristen Novembertag zu Fuß von dem am Talausgang gelegenen Dorf Lichtenau zu dem von der Welt vergessenen, hinter der Passhöhe liegenden Weiler Kaltenberg zu gelangen. Ausgenommen Pfarrer Bellmann. Um einer drohenden Verhaftung durch die Gendarmerie zu entgehen, war ihm keine andere Wahl geblieben. Außer der Landstraße, die talauswärts in das Amtsstädtchen Oberkirchen führte, von woher die Gendarmen kommen mussten, gab es keinen anderen Weg aus dem Tal als den über die Passhöhe. Zudem rechnete Pfarrer Bellmann damit, bei seinem Amtsbruder in Kaltenberg, Pfarrer Schweighöfer, vorläufig Unterschlupf und Asyl zu finden. Da er mit Schweighöfer, wie im Tal allgemein bekannt war, im Streit lag, würde man ihn dort zuletzt vermuten. Bei diesem Wetter und der zu dieser Jahreszeit früh einsetzenden Dunkelheit wird ihn auch kaum jemand gesehen, geschweige denn erkannt haben.
Angekommen am Pfarrhaus von Kaltenberg, zögerte Bellmann einen Moment lang, bevor er den schweren eisernen Türklopfer betätigte. Er wusste, dass sein Besuch eine Art Bußgang sein würde, auf dem er Abbitte wegen früherer Verfehlungen gegen Pfarrer Schweighöfer zu leisten hatte. Dieser würde vermutlich sehr erstaunt sein über den späten und ungewohnten Gast, aber abweisen würde er ihn nicht. Auch das wusste Bellmann.
Schweighöfer selbst öffnete die knarrende Tür. Da stand Bellmann, triefend vor Nässe, und rang sich ein gezwungenes Lächeln ab.
„Um Gottes Willen! Sie holen sich ja den Tod da draußen!“ Schweighöfer gab ihm ein Zeichen hereinzukommen.
Er führte Bellmann in die Stube, den wärmsten Raum des Hauses, der von einem großen Kachelofen beheizt wurde, hieß ihn seine nassen Sachen ausziehen und hängte diese eigenhändig an die Ofenstange zum Trocknen. Er rief Anna, seine Haushälterin, und wies sie an, trockene Wäsche und Kleidung für den Gast zu holen sowie den Rest der Kartoffelsuppe, die es zum Mittagessen gegeben hatte, aufzuwärmen. Etwas missmutig dreinschauend fügte sie sich. Sie hatte die Küche bereits aufgeräumt und wollte gerade nach Hause gehen; denn sie wohnte nicht, wie es üblich war, im Pfarrhaus, sondern lebte mit einer älteren Halbschwester zusammen in einem Häuschen, das nur ein paar Schritte vom Pfarrhaus entfernt war. Nichts und niemand würde sie dazu bringen, in diese Bruchbude zu ziehen, hatte sie gesagt, als Schweighöfer im Jahr 1843 die Pfarrstelle in Kaltenberg angetreten hatte.
Das Pfarrhaus war ein marodes, zugiges Gebäude mit feuchten und schimmligen Wänden. An etlichen Stellen im Dach regnete es herein. Das stete Tropfen eingedrungenen Wassers von der Stubendecke in einen Blecheimer, der mitten in der Stube stand, erinnerte mahnend daran, dass es mit kleineren Reparaturen hier nicht mehr getan wäre. Das Haus hatte eine grundlegende Sanierung nötig. Mit dem Kirchengebäude verhielt es sich nicht anders; auch dieses war in einem so erbärmlichen Zustand, dass jeder Gottesdienst eine Gefahr für Leib und Leben der Gemeindemitglieder bedeutete. Schweighöfer hatte sich mit einem Beschwerdebrief an das Erzbischöfliche Ordinariat gewandt:
Mit der schlechtesten Kirche, die im badischen Staat aufzutreiben ist, ist es immer noch auszuhalten, denn ich selbst stehe doch im Trockenen und kann wieder heraus, wenn ich mit den Geschäften fertig bin. Im Pfarrhaus aber muss ich schließlich wohnen, doch dieses geht seinem Untergang entgegen. Man sagt, gut gewohnt sei halb gelebt. Mein Leben aber hängt an einem seidenen Faden, solange ich in dieser alten Hütte wohnen muss.
Das Ordinariat hatte zwar nichts gegen eine Renovierung, sah sich jedoch nicht in der Pflicht, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Stattdessen verwies es den Pfarrer auf sein Zehntrecht. Der Kirchenzehnte, das waren jährliche Zwangsabgaben der Bauern an die Kirche, die meistens in Naturalien geleistet wurden. Er war ein letztes Überbleibsel aus dem jahrhundertelang praktizierten System der feudalen Grundherrschaft und sollte nach einem badischen Gesetz von 1833 gegen den achtzehn- bis zwanzigfachen Wert der jährlichen Leistungen abgelöst werden. Daneben gab es noch den Kornzehnten, der als Bau- und Transportleistungen die Erhaltung von Kirche und Pfarrhaus gewährleisten sollte. Die Bewertung der jährlichen Naturalabgaben und Arbeitsleistungen sorgte vielerorts für Streit zwischen Gemeindepriestern und Bauern. Aus dem Erlös der Zehntablösung hätte Schweighöfer nach Ansicht des Ordinariats die Sanierung von Kirche und Pfarrhaus finanzieren können. Schweighöfers Vorgänger im Amt des Gemeindepfarrers hatte die Zehntablösungsverhandlungen durch unakzeptable Forderungen scheitern lassen. Schweighöfer verzichtete darauf, sie wieder aufzunehmen, weil er wusste, dass viele Bauern sich wegen der Ablösung heillos verschuldeten. Um an Geld für die Renovierung der Kirche und des Pfarrhauses zu kommen, hatte er stattdessen eine Stiftung gegründet, in die er Erlöse aus dem Verkauf verzichtbarer Vermögenswerte der Pfarrei einbrachte. Mit Verkaufsaktionen wie der Versteigerung zweier alter Lindenbäume versuchte er das Stiftungskapital auf eine bessere Basis zu stellen.
Bevor Schweighöfers Hauswirtschafterin Anna Hug an diesem Abend das Pfarrhaus verließ, nahm Schweighöfer sie zur Seite und vergatterte sie zu absolutem Stillschweigen über den Besuch.
„Keine Angst. Sie wird ihren Mund halten. Ich kenne sie“, sagte er danach zu Bellmann, „sie ist eine ehrliche Haut und würde sich verpflichtet fühlen, es mir zu beichten. Und das wird sie nicht wollen.“
In Bellmanns Gesicht zeigte sich plötzlich der Anflug eines verschwörerischen Grinsens. Schweighöfer bereute, was er soeben gesagt hatte.
Asyl
21. November 1848, spätabends
Es gab nur einen Grund, der Bellmann bewogen haben konnte, das Pfarrhaus in Kaltenberg aufzusuchen: er war untergetaucht, ein Priester auf der Flucht vor der Justiz. Einer Justiz, die ihn allzu lange mit Samthandschuhen angefasst hatte, wie Schweighöfer fand. Jetzt schien er sich ausgerechnet in seinem Pfarrhaus verstecken zu wollen.
Bellmann beobachtete Schweighöfer aus den Augenwinkeln, während er seine Suppe löffelte. Schweighöfer hatte sich nicht zu ihm an den Tisch gesetzt, sondern stand seitlich hinter einem Stuhl und fixierte Bellmann mit ernstem Blick, als wartete er auf eine Erklärung. Schließlich fragte Schweighöfer geradeheraus:
„Warum sind Sie zu mir gekommen?“
„Weil Sie ein guter Mensch sind.“
„Ich an Ihrer Stelle wäre mir da nicht so sicher!“ Schweighöfer ärgerte sich im Stillen über den ironischen Unterton von Bellmanns Antwort: Was glaubt dieser Kerl eigentlich, wer er ist? Hält sich wohl für besonders schlau!
„Oh doch, ich bin mir ganz sicher. Sie können gar nicht anders, selbst wenn ich Sie gerade ein wenig foppe damit. Aber im Ernst, ich bin Ihnen natürlich zu großem Dank verpflichtet, dass Sie mich nicht abgewiesen haben, obgleich ich Ihnen nicht immer sehr freundlich begegnet bin. Und ich wäre Ihnen noch dankbarer, wenn ich ein paar Tage bleiben könnte, im Idealfalle inkognito.“
„Wie sagten Sie: Nicht immer sehr freundlich begegnet? Das ist hübsch schöngeredet“, spöttelte Schweighöfer. „Sie haben mich beim Erzbischöflichen Ordinariat in Freiburg mehrfach angeschwärzt.“
„Na ja, wenn der Pfarrer am Sonntag nach der Messe vor der Kirche Holz versteigert, dann ist das nichts anderes als eine Sonntagsentheiligung und damit ein offensichtlicher Verstoß gegen das dritte Gebot: Du sollst den Feiertag heiligen! Meinen Sie nicht auch? Da kommen die braven Katholiken aus dem Gottesdienst und sollen die erhaltenen Eindrücke einer höheren Bestimmung noch in der Tiefe der Seele bewahren, stattdessen werden sie unmittelbar vor der Kirche in die Niederungen des Geschäftemachens hinabgezogen und dazu verführt, einer schnöden Versteigerung beiwohnen. Und das Ganze war Ihre Idee! Denken Sie an Jesus, wie er in heiligem Zorn die Händler und Geldwechsler aus dem Jerusalemer Tempel vertrieben hat. Zur Ehre Gottes musste Jesus in diesem Falle ausnahmsweise Gewalt anwenden.“
„Von dieser Ausnahme hat die Kirche – zur Ehre Gottes – jahrhundertelang ausgiebig Gebrauch gemacht. Bei mir gibt es nicht jeden Sonntag eine Holzversteigerung. Aber wenn es eine gibt, dann nur am Sonntag. Sie wissen genau, dass ich die Bauern aus Kaltenberg und den umliegenden verstreuten Weilern nur an diesem Tag alle auf einem Haufen zusammengetrommelt bekomme. Im Übrigen entbehrt Ihre romantische Vorstellung von den Gläubigen, die in frommer Verzückung den Gottesdienst verlassen und dann durch eine Holzversteigerung jäh in die sündige Realität des Geschäftemachens hinabgerissen werden, jeder Lebenswirklichkeit. Ich kann Ihnen sagen, dass ich gezwungen bin, das Holz der gefällten Bäume zu versteigern, um die Renovierung von Kirche und Pfarrhaus zu finanzieren. Und kommen Sie mir jetzt ja nicht mit dem Zehnten und irgendwelchen längst abgeschafften Baufronen. Das ist vorbei, wir leben in einem Jahrhundert, das dabei ist, sich endgültig vom Mittelalter zu verabschieden! So, das zum Allgemeinen. Und nun zum Konkreten: Die ganze Diözese ist überzogen mit einem Netz von bezahlten Spitzeln und willfährigen Denunzianten. Und Sie sind einer von ihnen. Wahrscheinlich sind Sie auch der Informant, der sowohl der Gendarmerie in Oberkirchen als auch dem Ordinariat in Freiburg gesteckt hat, dass ich den Volksführer abonniert habe.“
„Mit Verlaub, der Volksführer ist ein zu Gewalt aufrufendes, ultraradikales und extrem antiklerikales Schmierblatt. Sie als Priester lesen das Geschreibsel Ihrer eigenen Henker! Wie können Sie so etwas gutheißen?“
Bellmann ärgerte sich über sich selbst. Er hatte sich hinreißen lassen, seine Spitzelaktivitäten zu rechtfertigen und dadurch Schweighöfer ins Unrecht zu setzen. An dessen Stelle hätte er sich längst rausgeschmissen. Jetzt fiel es ihm umso schwerer, eine ehrlich klingende Entschuldigung zustande zu bringen. Das sollte eigentlich der wichtigste Akt seines Bußganges sein. Reue heuchelnd sagte er: „Ich weiß, dass das im Grunde nicht entschuldbar ist, und doch möchte ich mich bei Ihnen dafür entschuldigen.“
Bellmann hätte sich beinahe auf die Zunge gebissen bei diesen Worten. Aber es war ihm in seiner Situation nichts anderes übriggeblieben. Schweighöfer ließ offen, ob er die Entschuldigung annimmt.
„Warum also sind Sie zu mir gekommen? Was ist passiert?“
„Es ist ein Haftbefehl gegen mich erlassen worden. Die Gendarmerie in Oberkirchen hat die Anweisung bekommen, mich festzunehmen und nach Freiburg zu bringen. Meine Haushälterin Fräulein Hoch, die bereits in Haft ist, war offensichtlich genötigt worden, schwere Anschuldigungen gegen mich zu erheben. Ich habe, Gott sei’s gedankt, rechtzeitig Wind davon bekommen und mich auf den Weg hierher gemacht.“
„Ob das so klug war?“
„Besser als in so einem Rattenloch von Gefängnis zu vermodern für etwas, das ich nicht getan habe.“ Der Nachsatz „für etwas, das ich nicht getan habe“ kam so selbstverständlich über Bellmanns Lippen, dass man sich nur schwer vorstellen konnte, dass er log.
„Sie kämen wahrscheinlich als Priester nicht einmal in Haft, solange sie nicht verurteilt sind. Und wenn doch, dann wird es so schlimm nicht sein“, beschwichtigte ihn Schweighöfer. „Der Priesterrock wird sie auch im Gefängnis schützen.“
Beide ahnten jedoch, dass eher das Gegenteil der Fall wäre. Der Priesterrock würde Bellmann nicht schützen, sondern ihn zum idealen Opfer der Boshaftigkeiten der anderen Gefangenen machen. Schweighöfer versuchte daher, etwas Ermutigendes zu sagen, und fing an, über Reformen im Strafrecht zu dozieren: In den letzten Jahren sei in der Juristerei viel in Bewegung gekommen. So gebe es im Strafrecht mittlerweile die segensreiche Einrichtung der Staatsanwaltschaft. Sie bewirke eine größere Unabhängigkeit der Richter, die früher Ermittler, Ankläger, Verteidiger und, zumindest bei weniger schweren Verbrechen, urteilender Richter in Personalunion gewesen seien. Indirekt werde dadurch auch die Verteidigung gestärkt.
„Sie scheinen sich ja sehr gut auszukennen.“
Tatsächlich kannte sich Schweighöfer nicht nur im kirchlichen Disziplinarrecht sehr gut aus, sondern auch im badischen Strafrecht.
„Zwangsweise bin ich in diesen Dingen mittlerweile ganz gut informiert“, antwortete er. „Nicht nur das Ordinariat und die kirchliche Gerichtsbarkeit haben ein großes Interesse, ihren Hunger nach Informationen zu stillen. Auch die weltliche Justiz lässt sich gern von Spitzeln und Denunzianten bei der Verfolgung vermeintlicher Straftaten helfen. Da gilt es schon, ein waches Auge nach allen Richtungen zu haben. Aber wem sage ich das?“
Bellmann unterdrückte den Impuls, gegen die erneute Anspielung auf seine Spitzeltätigkeit zu protestieren, und sagte:
„Die Unabhängigkeit des Richters mag ein Fortschritt in unserem Rechtssystem sein, aber darauf verlassen kann ich mich nicht. Ich bin doch längst vorverurteilt von diesen Hetzblättern wie … Sie wissen schon. Das nennt man Pressefreiheit, mir seit Wochen aufgrund haltloser Gerüchte einen Kindsmord zu unterstellen. Das nenne ich nicht Pressefreiheit, ich nenne es Rufmord.“
Was die Vorverurteilung betrifft, musste Schweighöfer seinem Amtsbruder recht geben. Er hatte die Zeitungsartikel und die entsprechenden Schlagzeilen gelesen, die Pfarrer Bellmann des Mordes an einem Neugeborenen verdächtigten. Wie ein Erdbeben hatte der Fall das Tal und schließlich das ganze Großherzogtum Baden innerhalb der letzten vier Wochen erschüttert. Jeder kannte die ungeheuerlichen Vorwürfe, die gegen den Pfarrer erhoben wurden: Er habe mit seiner noch minderjährigen Haushälterin geschlafen, ihr ein Kind gemacht, es nach der Geburt getötet und die Leiche irgendwo verschwinden lassen.
„Einverstanden, Sie können vorerst bleiben“, sagte Schweighöfer.
Anna Hug wusste genau, wer der Asylant im Kaltenberger Pfarrhaus war, hütete sich aber, wie Schweighöfer es von ihr verlangt hatte, außerhalb des Pfarrhauses auch nur ein Sterbenswörtchen über ihn zu verlieren. Im Pfarrhaus verhielt sie sich, als ob Bellmann gar nicht da wäre. Sie ignorierte ihn, so gut es ging. Bellmann selbst tat alles, um unsichtbar zu sein. Er fürchtete sich davor, entdeckt und erkannt zu werden.
März 1848 – April 1849
Das Ultimatum
30. März 1848
Josef Halder war einer der größeren Bauern und seit zehn Jahren Bürgermeister in Lichtenau. Wie Bellmann herausgefunden hatte, war er neben Schweighöfer und einem weiteren Pfarrer der einzige Abonnent des Volksführer im Amtsbezirk Oberkirchen. An einem Frühlingsabend des Jahres 1848 saßen Halder und elf weitere Lichtenauer Bauern in der geräumigen Stube des Halderschen Hofes, tranken Apfelmost und redeten sich die Köpfe heiß. Sie waren zusammengekommen in dem mehr oder weniger bewussten Drang, die seit einigen Monaten gärende revolutionäre Stimmung in Europa in eine revolutionäre Aktion umzusetzen, nachdem sie sich in den Metropolen wie Paris, Wien und Berlin bereits entladen hatte. Um erst einmal im Kleinen anzufangen, zielte ihr revolutionärer Tatendrang auf ihren Ortsgeistlichen Franz Anton Bellmann.
Halder galt als einer der schärfsten Widersacher des Pfarrers. Beide waren um die Jahrhundertwende geboren. Beide waren sie stolz, machtbewusst und unnachgiebig. Politisch vertraten sie gegensätzliche Positionen. Halder sympathisierte mit den radikaldemokratischen Ideen Friedrich Heckers. Im September 1847 war er in Offenburg mit dabei gewesen, als die Offenburger Forderungen verkündet wurden. Sie waren gewissermaßen das radikaldemokratische Programm der badischen Revolution von 1848.
Pfarrer Bellmann dagegen stand den Konservativen nahe. Er pflegte seine Predigten mit erhobenem Zeigefinger und ermahnenden Appellen an das Dorf- und Bauernvolk abzuschließen, die sich so oder so ähnlich anhörten:
Im Übrigen bleibt bei Eurer Arbeit, bestellt Eure Felder und meidet die Wirtshäuser! Sorgt für Weib und Kind, seid fleißig, mäßig, sparsam und ehrfürchtig vor Gott! Achtet und ehrt die Obrigkeit, denn sie ist von Gott! So wird es Euch wohlergehen auf Erden und im Himmel werdet Ihr selig werden. Amen.
Die so genannte Bauernbefreiung widerstrebte Bellmanns gesellschaftspolitischem Ordnungsgefühl, die Revolution war für ihn schlicht Teufelswerk. Die Offenburger Forderungen bestätigten ihn in seiner Haltung. Dort wurde unter anderem das Recht auf Glaubens- und Gewissensfreiheit gefordert – für ihn ein Affront gegen die Kirche. Die Revolutionäre besaßen aus seiner Sicht die Unverfrorenheit, in Offenburg die Beziehung zu Gott als etwas Intimes zu deklarieren, das niemanden etwas angehe, auch die Kirchen nicht.
Bellmann war 1834 nach Lichtenau gekommen, um dort die Pfarrei zu übernehmen. Er hatte bis dahin immer in der Stadt gelebt, war in städtischen Pfarreien als Kaplan eingesetzt. Lichtenau war seine erste Pfarrstelle. Das Landleben war ihm fremd und es blieb ihm während der ganzen Jahre fremd. Vor den Bauern hatte er keine Achtung und geriet schon bald in heftigen Streit mit ihnen. Er hielt sie für ungeschliffenes Volk, dem erst einmal Manieren beizubringen seien. Seltsamerweise pflegte er seine eigenen Verfehlungen und Marotten auf seine Gemeindemitglieder zu übertragen. So bezichtigte er die Lichtenauer einer ausgeprägten Prozesssucht, während er selbst seine Nachbarn und andere Lichtenauer Bürger im Lauf der Jahre mit zahlreichen Anzeigen und Prozessen beim Bezirksamt überzog. Einen Gastwirt aus dem Dorf verklagte er erfolglos bis zum Freiburger Hofgericht wegen übler Nachrede. Bellmann schien des Landlebens so überdrüssig geworden zu sein, dass er von Zeit zu Zeit ohne Vorankündigung seine Gemeinde für mehrere Tage sich selbst überließ. Die Gläubigen mussten während dieser geheimnisvollen Vakanzen auf seine geistlichen Dienstleistungen, insbesondere auf die Erteilung der Sakramente, verzichten. So mancher Sterbende in Bellmanns Pfarrei musste diese Welt ohne die seelenbefriedende Krankensalbung verlassen. Denn nicht immer fand sich rechtzeitig ein Priester aus einer der Nachbargemeinden, der für ihn einsprang.
Das Ziel, das Halder verfolgte, entsprach der revolutionären Stimmung: Er wollte den Pfaffen aus dem Dorf jagen.
„So einen brauchen wir hier nicht. Der Saukaib muss weg“, rief einer in die Runde der zwölf versammelten Bauern und haute dabei so kräftig mit der Faust auf den Tisch, dass die vollen Mostgläser überschwappten. „Im gesamten Amtsbezirk lacht man schon über uns. Der muss verschwinden. Der tanzt uns doch auf der Nase rum und macht, wie‘s ihm grad passt. In Forchheim draußen haben sie es vorgemacht. Die sind ihren Pfarrer los.“
Ein älterer Bauer sagte: „Wir haben viel zu lange gewartet: Der hat uns doch gleich, als er in unsere Gemeinde gekommen ist, gezeigt, wo der Barthel den Most holt. Das war anno 34. Bei den Verhandlungen über die Zehntablösung hat er dermaßen hart und unverschämt verhandelt, wie man es von einem Priester nicht erwartete hätte. Er konnte den Kragen nicht vollkriegen, der Halsabschneider.“
Sein Nebensitzer ergriff das Wort: „Viele haben sich wegen der Zehntablösung verschuldet. Manche zahlen heute noch. Manche mussten verkaufen, sind darüber schwermütig oder zum Säufer geworden – oder beides.“
Der Ältere ergänzte: „Wenn man mit ihm, also mit Bellmann, reden wollte wegen der Schulden und der Verzugszinsen, dann hat der hoffärtige Kaib einen zuerst ausgelacht und dann mit einer Anzeige beim Bezirksamt gedroht. Das war sein Einstand bei uns.“
Der jüngste der anwesenden Bauern, der mit 22 Jahren nach dem frühen Tod seines Vaters einen der größten Höfe im Lichtenauer Tal bewirtschaftete, rief, vom Most mutig geworden, in die Runde: „So ein Lumbeseggel! Warum habt ihr euch das überhaupt bieten lassen? Den hättet ihr damals in einen Sack stecken sollen und …“. Der junge Bauer sprach nicht weiter, sondern stand von seinem Stuhl auf und vollendete seinen Satz mit Händen und Füßen. Er schlug mit geballten Fäusten Löcher in die Luft und trat seinem Nebenmann gegen das Schienbein, das unfreiwillig den Pfarrer im Sack ersetzen musste.
„Herrgottssakrament, pass doch auf, du Depp, setz dich hin und benutz dein Hirn, wenn du was zu sagen hast. Und wenn dir nichts Gescheites einfällt, dann halt deine Gosche.“
„Das wäre wirklich nicht sehr schlau gewesen“, sagte ein anderer. Bellmann hätte uns allesamt sofort beim Bezirksamt angezeigt. Aber im Ernst: Wir konnten ihm damals doch nur schwer an den Karren fahren, denn die Regeln der Zehntablösung hat nicht er gemacht, sondern die feinen Herren Abgeordneten im Badischen Landtag.“
Halder hatte die Diskussion erst einmal laufen lassen, mischte sich jetzt aber ein, weil er glaubte, dass sie in die falsche Richtung abzugleiten drohte. Er stand auf, stützte sich mit den Händen auf den Tisch, schob seinen Unterkiefer vor und sagte:
„Zehntablösung





























