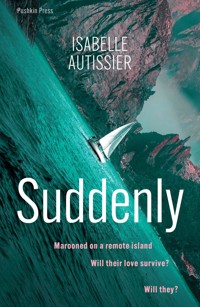Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mareverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Murmansk, nördlich des Polarkreises. Zum ersten Mal kehrt Juri, der längst als Ornithologe in Nordamerika lebt, in seine Heimat zurück. Sein Vater Rubin liegt im Sterben, lediglich das Rätsel um Juris Großmutter Klara – eine Wissenschaftlerin zur Zeit Stalins, die vor den Augen des damals vierjährigen Rubin verhaftet wurde – hält ihn am Leben. Klaras Verschwinden und eine Jugend voller Entbehrungen haben aus Rubin einen unerbittlichen Fischer und hartherzigen Vater gemacht, der seinen ungeliebten Sohn nun in einem letzten Aufeinandertreffen um Hilfe bittet: Er soll herausfinden, was mit Klara passiert ist. Und schließlich stößt Juri auf eine Wahrheit, die ihm vor Augen führt, wie eng alle drei Schicksale – sein eigenes, Klaras und Rubins – miteinander verknüpft sind … Ein großes menschliches Abenteuer und eine familiäre Spurensuche, voll von spektakulären Beschreibungen einer wilden Natur, packend erzählt von Bestsellerautorin Isabelle Autissier.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Isabelle Autissier
Klara vergessen
RomanAus dem Französischen von Kirsten Gleinig
Die Arbeit der Übersetzerin wurde durch den Deutschen Übersetzerfonds gefördert.
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel Oublier Klara bei Éditions Stock, Paris.
Copyright © Éditions Stock, 2019
© 2020 by mareverlag, Hamburg
Covergestaltung Nadja Zobel, Petra Koßmann, mareverlag
Abbildung Gerhard Rießbeck
Typografie (Hardcover) mareverlag, Hamburg
Datenkonvertierung E-Book Bookwire
ISBN E-Book: 978-3-86648-378-1
ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-627-0
www.mare.de
Inhalt
Juri – Rückkehr nach Murmansk
Juri – Die Entdeckung der Vögel
Juri – Der Verrat
Rubin – Auf der Barentssee
Juri – Das unverhoffte Paket
Klara – Die Verhaftung
Juri – Das Geografiebuch
Klara – Die Rentierinsel
Juri – Der Familienroman
Juri
Rückkehr nach Murmansk
Es war dieser erhabene Moment.
Juri hatte keinen Fensterplatz gebucht, aber das Flugzeug war längst nicht voll besetzt, und so war er einfach weitergerutscht. Er wusste, dass er nicht lesen oder sich auf irgendetwas anderes würde konzentrieren können. Lieber betrachtete er die Landschaft, die wie eine beruhigende Hypnose auf ihn wirkte. Achttausend Meter unter ihm erstreckte sich endloses Weiß, nur hier und dort von einer dunklen Straße durchzogen, von der man nicht wusste, wohin sie führte. Die zugefrorenen Seen glitzerten bläulich, der Wald reihte seine braunen Stämme aneinander, an denen der Schnee nicht haften geblieben war. Ansonsten überall Weiß, Weiß, Weiß.
Als die Sonne den Horizont streifte, brachen Purpurrot und Rosa sich Bahn. Der Schnee schien zu brennen. Der Himmel färbte sich von Gelborange im Westen bis zu Schwarz im Osten. Er wäre gerne im Cockpit gewesen, um dieses Tuschebild als Ganzes zu erfassen und den Moment zu genießen. Ein solches Panorama hatte er zuletzt vor beinahe dreißig Jahren gesehen, auf einem Fischtrawler irgendwo hoch im Norden. Seither hatte ihm das Licht der Stadt den Anbruch der Nacht immer verschleiert. Er spürte, dass das Schauspiel nur für ihn war, damit er die Verbindung zur Vergangenheit wiederaufnehmen konnte, auf die er sich gerade innerlich vorbereitete.
Das herrliche Farbenspiel dauerte nur wenige Minuten, dann versank alles in Sepiabraun, und schließlich wurde es ringsum schwarz. Lediglich ein schwacher Schimmer links vom Flugzeug wies die Richtung.
»Meine Damen und Herren, wir haben mit dem Landeanflug auf Murmansk begonnen, bitte setzen Sie sich wieder auf Ihre Plätze …«
Als er die übliche Durchsage der Stewardess hörte, nahm Juri das alte Ziehen in der Magengegend wahr, das er lange nicht verspürt hatte. Da war es also wieder. Kein Entkommen mehr. Seit er sich vor ein paar Tagen entschieden hatte, zurückzukehren, hatte er die Gedanken an die Konsequenzen beiseitegeschoben. Auf der Reise hatte er versucht, sich von der Unwirklichkeit solcher Langstreckenflüge einlullen zu lassen: Menschenmengen an den Flughäfen, Warteschlangen, fader Kaffee, Filme am laufenden Band, die einen in eine Art Koma versetzten, sodass man Tag und Nacht nicht mehr voneinander unterscheiden konnte. Er hatte sich immer vorgestellt, die Reisenden auf Interkontinentalflügen kehrten in einen fötalen Zustand zurück. Was heute haargenau auf ihn selbst zutraf.
Als er aus dem Flughafen trat, wiesen ihm die eingemummelten Männer, die die Reisenden diskret heranwinkten, den Weg zu den »Schubkarren«, den illegalen Taxis. Er hätte sich durchaus auch ein normales Taxi leisten können, aber er hatte Mitleid mit den Typen, die nachts dastanden und warteten und auf ein paar Rubel hofften.
»Business, Sir?«, erkundigte sich der Fahrer.
Er musste seinen teuren Koffer gesehen haben. Eine Unterhaltung gehörte zur Fahrt in einer Schubkarre dazu, und ein paar nette Worte brachten vielleicht ein Trinkgeld ein. Juri antwortete auf Russisch.
»Ja, Sicherheitskontrolle der Straße Richtung Norden.«
Warum log er? Weil es zu kompliziert oder zu schmerzlich gewesen wäre, zu erklären, dass er aus Ithaca im Bundesstaat New York gekommen war, um dabei zu sein, wenn sein Vater starb, wahrscheinlich zumindest. Er hätte erzählen müssen, dass er seit 1994, seit dreiundzwanzig Jahren, keinen Fuß mehr auf russischen Boden gesetzt und sich, als er damals von hier geflohen war, geschworen hatte, nie wieder zurückzukehren.
Während der alte Mercedes über die Straße glitt, erkannte man im Scheinwerferlicht nur einen Hauch glitzernder Eiskristalle. Sie ließen den Wald hinter sich, der Schnee wurde schwarz. Kohlestaub! Juri hatte ganz vergessen, dass Murmansk in eine Schadstoffwolke gehüllt und dies hier nur der sichtbarste Teil davon war.
Die Stadt tauchte auf, ausgestorben um diese Zeit. Er bemerkte die neue Brücke über die Kola-Bucht und das neue Viertel, das auf dem anderen Ufer funkelte. Der Fahrer setzte ihn am Hotel Gubernskiy ab, nicht ohne ihm seine Handynummer für ein anderes Mal zu geben oder falls er einen Ort suchte, um sich ein wenig zu amüsieren.
Ein amerikanischer Pass tat noch immer seine Wirkung in Murmansk, selbst wenn der Familienname die russische Herkunft verriet. Dienstbeflissen wurde ihm ein Zimmer aufgeschlossen, das nach Desinfektionsmittel roch, aber komfortabel war: XXL-Bett, Großbildfernseher. Mit der geblümten Tagesdecke und dem Bild von einer Hirschjagd hätte er sich ebenso gut irgendwo in Wisconsin oder Alabama wähnen können.
In einem unfassbar kitschigen Speiseraum, in dem nur drei schweigsame Geschäftsleute herumsaßen, aß er rasch zu Abend und ließ sich dann in den großen Kunstledersessel in seinem Zimmer fallen. Es war an der Zeit, die Lethargie abzuschütteln, die ihn auf der Reise befallen hatte.
Unter den Hunderten von Mails, die täglich seinen Uni-Account verstopften, hatte die russische seine Aufmerksamkeit erregt, denn der Austausch unter Wissenschaftlern lief normalerweise auf Englisch:
»Guten Tag, ich hoffe, dass ich an die richtige Mail-Adresse schreibe. Sie kennen mich nicht, ich heiße Anatoli Grigorjewitsch Soutine, ich wohne in Murmansk im selben Haus wie Ihr Vater. Seine Nachbarin von gegenüber, Irina Iwanowna, die Sie gut kennen, hat mich gebeten, nach Ihnen zu suchen. Da ich lediglich wusste, dass Sie in den USA leben und wahrscheinlich Ornithologe sind, war das zugegebenermaßen nicht ganz leicht. Ihre wissenschaftlichen Veröffentlichungen haben mir die entscheidenden Hinweise gegeben. Irina lässt Ihnen ausrichten, dass Ihr Vater mit einem Leberkarzinom, offenbar im Endstadium, im Krankenhaus liegt. Sie sagt, er erwähnt oft Ihren Namen und scheint den dringenden Wunsch zu haben, Sie wiederzusehen. Wenn Sie möchten, kann ich ihr gerne eine Antwort übermitteln. Sie ist inzwischen fast taub und kaum mehr in der Lage zu telefonieren.
Freundliche Grüße.«
Juri hatte lange reglos vor dem Bildschirm gesessen. Es war spät, und im Labor herrschte Stille. Er schloss die Augen und sah wieder die breiten Boxerschultern vor sich, als wäre es gestern gewesen, die blaugrauen Augen und den großen Mund mit dem spöttischen Lächeln und den nikotinverfärbten Lippen: seinen Vater. Warum wollte er ihn unbedingt wiedersehen, nach allem, was passiert war? Das Wort Reue gehörte nicht zu seinem Wortschatz. Veränderte der nahe Tod einen Menschen derart?
Er bemerkte das nervöse Wippen seines Beines, ein Tick, den er nicht mehr an sich kannte, seit er in Amerika lebte. Er erinnerte ihn an seine Ohnmacht, wenn er die Wut seines Vaters über sich ergehen lassen musste. Sich ihm zu widersetzen zog die Moralpredigten nur in die Länge und ließ den Vater in seiner Rage noch ganz andere Töne anschlagen.
Er schaltete den Computer aus. Seine Gedanken schweiften bereits Tausende Kilometer weit. Als er hinaustrat, roch der dunkle Campus nach Herbst. Ein kräftiger Wind pfiff durch die Bäume und blies ihm entgegen, sodass er gute zwanzig Minuten mit dem Rad nach Hause brauchte. Um seine aufwallenden Gefühle im Griff zu behalten, versuchte er sich auf die schlecht beleuchtete Straße zu konzentrieren, wo er auf dem abgefallenen Laub ins Rutschen geriet. Er versuchte, nicht an die Nachricht zu denken, wusste aber bereits, dass er sich zu Hause sofort an den Rechner setzen und ein Flugticket buchen würde.
Was hatte er von einem kranken Mann heute schon noch zu fürchten?
Mit seinen sechsundvierzig Jahren hatte er genauso viel Zeit in der UdSSR wie in den Vereinigten Staaten verbracht, aber seine wahre Heimat war hier, in Amerika. Nicht nur wegen des neuen Passes, sondern vor allem wegen der Universität, wegen seiner Forschung, die ihn begeisterte, wegen Stephan, den er lieben konnte, ohne sich zu schämen, während er schreckliche Geschichten über die Verfolgung homosexueller Paare in Russland hörte – kurzum wegen seines ganzen Lebens, das er sich hier nach seinen Vorstellungen aufgebaut hatte. Nichts würde ihn dazu bringen, dieses Land zu verlassen, das ihn als mittellosen Doktoranden aufgenommen und ihm den Weg zu seinem Ziel bereitet hatte.
Jedes Mal, wenn er sich getraut hatte, seinem Vater von dem Leben zu erzählen, das er sich erträumte, hatte er sich anhören müssen, er sei nur ein Dummkopf, der es zu nichts bringen würde. Inzwischen hatte er es zu etwas gebracht: zum Professor an der besten Universität seines Faches mit gutem Gehalt, einem schönen Haus, einer Hütte in den Bergen und allem, was zum amerikanischen Way of Life gehörte. Er war es, der recht behalten hatte. Alles, was ihm von Leuten, die kürzlich ausgewandert waren, über das Leben in Russland zugetragen wurde, bewies, dass er es richtig gemacht hatte.
Juri blieb mehrere Stunden lang sitzen, ganz im Dunkeln. So verfuhr er auch, wenn er auf ein berufliches Problem stieß oder mit einer schwierigen Publikation nicht weiterkam. Sein Geist schweifte mit dem Licht der Straßenlaternen umher, das sich einen Weg durch die Zweige der Hecke bahnte. Die Reglosigkeit schärfte seine Konzentration. An windigen Abenden wie diesem tanzte es durch das dunkle Zimmer. Das wirkte hypnotisch und weckte die Erinnerungen. Er merkte, wie entschieden er die ersten dreiundzwanzig Jahre seines Lebens verleugnet hatte. Er hatte jeglichen Kontakt abgelehnt, in die eine wie in die andere Richtung. Am Anfang, weil er befürchtete, seine Mutter könne ihn emotional unter Druck setzen oder sein Vater ihn verspotten, später aus Bequemlichkeit. Das frühere Leben durfte das heutige nicht infizieren, sonst drohten Angst und Schuldgefühle. Mit der Mail von diesem Anatoli hatte sich diese Strategie erledigt. Sie war bestimmt das Zeichen, dass es an der Zeit war. Konnte man den Ruf des kranken Vaters ignorieren? Sollten sie nicht Frieden schließen? Würde er sich am Ende seines Lebens nicht vorwerfen, die ausgestreckte Hand nicht ergriffen zu haben?
Wie bei sich zu Hause knipste Juri auch im Hotelzimmer keine Lampe an. Die Straße verströmte ein grünliches, vom Nebel gedämpftes Licht, das sich gelb färbte, wenn ein Auto vorbeifuhr. Abgesehen von gelegentlichen Geräuschen der Toilettenspülungen und Türen schien alles ruhig. Seine Erinnerung an die Stadt war eine andere, und auf einmal drängte es ihn, sich durch ihre Straßen zu bewegen. So viel war geschehen in dreiundzwanzig Jahren und seit der UdSSR seiner Kindheit. Er dachte an die alte Wohnung, an die Rutschpartien auf dem schwarzen Schnee, an die Schiffe seines Vaters … Er sah sie alle vor sich bis auf eines: die 305, das Schiff, das ihn noch immer ängstigte. Er dachte an seine Mutter, die so sehr am Materiellen hing, dass er sich an jeden einzelnen Kuss von ihr erinnern konnte, derart selten waren sie gewesen. Sie musste gestorben sein, ansonsten hätte die alte Irina sie erwähnt. Wann wohl? Niemand hatte versucht, ihn zu erreichen. Sie war ebenso unbeachtet gestorben, wie sie gelebt hatte.
Schließlich schlief er auf dem Sessel ein. Scheinwerferlichter, die immer seltener ins Zimmer drangen, strichen wie Messerklingen über sein Gesicht, die hervorstehende Nase, für die er sich als Kind so geschämt hatte, den Kopf mit den braunen Haarsträhnen, die er nach vorne strich, um seine Glatze zu verdecken, und die noch immer bläuliche Narbe an der linken Schläfe. Als er wieder aufwachte, schienen seine tiefen Tränensäcke in den Augenhöhlen zu verschwinden. Er wirkte erschöpft, und das lag nicht an den Nachtschichten am Computer oder unterwegs mit dem Ornithologenfernglas. Es war eine sehr alte Erschöpfung, die auf einen langen Kampf zurückging, den ums Weiterleben trotz der Angst. Seit seiner Flucht war es ihm gelungen, sich dieses Gift vom Leib zu halten. Doch an diesem Abend erinnerte sein Körper sich wieder an die alte Schwäche.
Er verschlief das Hotelfrühstück, war aber froh darüber. Er wollte unbedingt durch die Stadt schlendern, zunächst wieder Verbindung zu den Orten aufnehmen, bevor er den Menschen gegenübertrat. Draußen war der Nebel spurlos verschwunden, stattdessen zeigten sich ein blassblauer Himmel und das opalisierende Licht der noch zaghaften Frühlingssonne.
Der erste Eindruck war verwirrend. Alles war anders, und doch hatte sich nichts verändert. In der Innenstadt fand er die breiten Straßen mit den kaputten Gehwegen wieder, von einer harten schwärzlichen Schneeschicht überzogen. Aber darauf stapften keine schweren Stiefel mehr. Man sah vor allem Nikes, Schuhe aus Leder oder etwas, das so aussehen sollte, und sogar aberwitzige Stilettos mit Riesenabsätzen. Die Mädchen, die sie trugen, wedelten beim Trippeln mit den Armen, um das Gleichgewicht zu halten, wie Pinguine. Die Mode war dieselbe wie in jeder x-beliebigen Stadt in Amerika: Jogginghosen, rosa Steppjacken, Kunstfellmützen, aus denen extrem gebleichte Haarsträhnen hervorlugten. In den USA hätte er dem keinerlei Beachtung geschenkt, in Murmansk erschien es ihm absurd.
Genauso überraschte Juri die Werbung, deren Einzug er kaum noch mitbekommen hatte und die nun an allen Straßenecken das neueste iPhone anpries. Auch die Geschäfte hatten sich erheblich verändert. Die Schaufenster waren größer und gefüllt. Führende Hersteller aus Europa und den USA boten zehn verschiedene Staubsaugermodelle oder Kleidung in allen nur erdenklichen Farben an. Er hatte eine schwarz-weiße UdSSR verlassen, das heutige Russland war bunt.
Er streifte durch die Innenstadt, bis er Hunger bekam und der Lust nachgab, in einer Filiale von McDonald’s zu frühstücken, die sich damit rühmte, die nördlichste der Welt zu sein. Abgesehen von der kyrillischen Beschilderung hätte sich der Laden ebenso gut zu Hause in Ithaca befinden können: dieselben Resopaltische, dieselben eng anliegenden T-Shirts mit dem gelben M, dieselben Verpackungen, in denen sich die Fettspuren des Gebäcks abzeichneten. Am meisten erstaunte ihn, dass die Musik genauso belanglos war. Juri hätte nicht sagen können, ob ihn die Angleichung an einen Standard, der als »hoch entwickelt« galt, glücklich machte oder nicht.
Unterm Strich sorgten die Farben für einen fröhlichen Eindruck, und die Passanten schienen schneller zu gehen, größere Leichtigkeit auszustrahlen als in seiner Erinnerung. Er ertappte sich bei dem Gedanken, dass mit dieser Angleichung dennoch etwas vom russischen Geist auf der Strecke geblieben war. Und nahm sich diese Nostalgie gleich darauf selbst übel. Russland war einfach nur ein Land wie jedes andere geworden.
Doch sobald er sich vom Zentrum entfernte, fand er die Stadt seiner Kindheit wieder, wo sich die verfallenden Fassaden aneinanderreihten. Vor dem Zusammenbruch des Landes waren sie in Pastelltönen gestrichen worden, und die dunklen Schimmelspuren oberhalb der Fenster traten darauf umso deutlicher hervor. Der abbröckelnde Putz hinterließ ein riesiges Puzzle auf den Wänden. Er entdeckte Plastiktüten, die von den Fensterriegeln hingen, vermutlich mit Kräutern oder ein wenig Butter gefüllt. Offensichtlich hatten noch nicht alle einen Kühlschrank.
Er ging weiter, stieg wieder die Straßen hinauf, die zu den gewaltigen Wohnblocks auf den Hügeln führten. Solche Häuser waren ein Markenzeichen sowjetischer Städte gewesen, vor allem von Murmansk. Nach dem Krieg waren nur noch zehn Prozent der geschundenen Stadt erhalten gewesen. Wegen ihrer günstigen Lage am Ende eines Fjords, der unter dem Einfluss des Golfstroms nie zufror, diente sie ab 1941 als strategischer Hafen für die Waffenversorgung der UdSSR durch die Alliierten. Die deutsche Armee hatte es nicht geschafft, die Stadt zu erobern, wofür sie sie allerdings teuer bezahlen ließ. Der Wiederaufbau, der mit Nachdruck betrieben wurde, um die Seeleute der Marine, der Handelsschifffahrt und der Fischerei unterzubringen, hatte diese endlosen zehnstöckigen Kästen hervorgebracht, die wie eine schweigende Armee über die Bucht wachten. Die Stellung als Kapitän hatte seinem Vater das Privileg verschafft, dort einziehen zu dürfen: eine abgeschlossene Wohnung mit eigener Küche und Toilette!
So oft war Juri die Hügel hinaufgestiegen, wenn er vom Hafen nach Hause kam. Er erinnerte sich an die Spiele und die Raufereien und ebenso an die Angst im Bauch, die ihn ergriff, wenn er um die Ecke des letzten Häuserblocks kam und sich fragte, in welcher Verfassung er seinen Vater antreffen mochte.
Das Viertel war inzwischen heruntergekommen. Oder täuschte ihn seine Erinnerung? Nein. Die Fassaden waren verwahrloster als je zuvor. Große Brocken Putz, sogar Beton waren heruntergefallen. Die Spuren der Fußgänger im Schnee zeigten, dass sie genau wussten, wohin sie nicht treten durften, um nicht zu stürzen. Die Graffiti hingegen waren neu. In der UdSSR seiner Kindheit hätte niemals jemand auch nur daran gedacht, die Wände zu besprühen. Schwer entzifferbare Tags standen neben Sprüchen wie »Tod dem schwarzen Pack«, »Es lebe Putin«, »Schwule in die Gaskammer«. Auch hier stand Murmansk amerikanischen Vorstädten in nichts nach. Er erinnerte sich an die unendlichen Gespräche, die er in den USA mit anderen Einwanderern über das ewige »Früher war alles besser« oder »Die Leute kennen keinen Respekt mehr« geführt hatte. Am Ende hatte er den Kontakt zu den russischen Kreisen abgebrochen, weil er müde war von den immer gleichen Diskussionen. Aber tief in ihm schmerzte diese Zurschaustellung des Hasses. Die euphorische Stimmung Anfang der Neunzigerjahre kam ihm in den Sinn: Perestroika, das Ende des Kommunismus, der Traum von Freiheit, der sie ergriffen hatte. War das nur ein Strohfeuer gewesen?
Auch der Eingang des Hauses war mit Graffiti übersät, und die Türscheiben waren eingeschlagen. Im Treppenhaus hing der altbekannte Geruch: eine Mischung aus Kohl, Reinigungsmittel und Feuchtigkeit. Seine Schritte hallten auf den gekachelten Stufen und fügten den vorhandenen Spuren von geschmolzenem Schnee und Matsch weitere hinzu.
Die alte Irina wohnte gegenüber seiner ehemaligen Wohnung, im vierten Stock. Er klopfte mehrfach, von Mal zu Mal lauter, bis er schlurfende Pantoffeln und das Geräusch eines Stockes hörte. Eine alte Frau öffnete vorsichtig die Tür einen Spaltbreit und wollte sie gerade wieder schließen, als er seinen Fuß dazwischenschob. Dreiundzwanzig Jahre später, wie sollte sie den schlaksigen jungen Mann mit den kurz geschorenen Haaren, der damals weggegangen war, auch wiedererkennen?
»Irina Iwanowna, meine liebe Rinotschka, ich bin’s, Juri, der Sohn von Rubin«, sagte er sanft, um sie nicht zu ängstigen.
Sie musterte ihn misstrauisch durch den Türspalt. Ihre Augen, an deren intensives Blau er sich erinnerte, waren mit dem Alter blass geworden. Weil sie so schlecht hörte, wiederholte er den Satz noch einmal lauter. Sie zögerte einen Augenblick, dann sah er, wie ihr Gesicht sich entspannte und darauf das Lächeln erschien, das ihn so oft getröstet hatte.
»Mein Gott! Mein kleiner Juri …«, stammelte sie und starrte ihn an, ohne sich vom Fleck zu rühren.
Sie blieben eine Weile so stehen, er den Fuß auf der Schwelle, sie die Hand am Rahmen, als wolle sie die Tür wieder schließen. Dann trat sie mit einem Mal zurück.
»Bist du es wirklich? Juri Rubinowitsch? Mein Jurka? Nach all der Zeit. Komm herein, schnell!«
Plötzlich schien sie ängstlich, als könne er sich vor ihren Augen in Luft auflösen. Tränen rollten aus ihren Augen. Sie wandte sich ab, um ihre Aufregung nicht zu zeigen, und hinkte in die Küche.
»Ein Tee, ich mache dir einen Tee.«
Ebenso wie sie gezögert hatte, als sie ihn sah, hätte auch er ihr begegnen und sie nicht wiedererkennen können. Irina war sehr alt geworden. Sie war nicht nur äußerlich in sich zusammengesunken wie alle alten Menschen, sondern schien auch innerlich leer. Hätte Juri das Fenster geöffnet, hätte der erste Windstoß sie ergriffen und mit sich fortgetragen. Die schlaffe Haut hing an dem gebeugten Körper, hüllte ihn ein wie ein unförmiges Kleidungsstück. In dem von Falten zerfurchten Gesicht traten nur die Wangenknochen glatt hervor wie reife Früchte auf ausgetrockneter Erde.
In der Küche hingegen hatte sich nichts verändert. Die Eckbank, jenes Möbelstück, das in keiner russischen Wohnung fehlen durfte, hatte lediglich ihren Glanz verloren, und auf dem grün-weiß karierten Bezug prangten mehr Fettflecken. Die Schranktüren standen noch immer offen, die Regale aus Restholz befanden sich nach wie vor ebenso am selben Platz wie die von Generationen von Ellenbogen und Gesäßen blank gescheuerten Stühle und der Plastiktisch. Juri sah die triste Szenerie gar nicht. Er war zutiefst ergriffen. Er war nicht mehr der würdevolle Universitätsprofessor, sondern ein Kind, das weinte, weil es geschlagen worden war, und um Zärtlichkeit bettelte, und später ein jähzorniger Jugendlicher. Das Wiedersehen mit der alten Frau, die ihn immer aufgenommen hatte, hatte soeben die zweite Hälfte seines Lebens verblassen lassen. Er wandte den Kopf ab, damit sie die Tränen nicht sah, die ihm in die Augen traten. Einige Minuten taten sie, als seien sie vertieft – die eine in das siedende Wasser, der andere in die Kratzer auf dem Tisch.
Der Tee verhalf ihnen zu ihrer Fassung zurück. Vorsichtig wechselten sie ein paar Worte: Gefiel ihm seine Arbeit in Amerika? Machte ihr das Bein noch mehr zu schaffen als früher?
Schließlich nahm sie ihren Mut zusammen:
»Dein Vater wird bald gehen, er ist seit einem Monat im Krankenhaus. Wenn ich ihn besuche, ist er von Mal zu Mal schwächer. Es wurde Zeit, dass du kommst.«
Man sagt nicht »sterben« in dieser Generation, in der so viele viel zu früh verschwunden sind. »Gehen« ist diskreter.
In den USA wären zweiundsiebzig Jahre kein hohes Alter. Doch für einen Mann, der Kälte und Stürme im hohen Norden erlebt, die Entbehrungen der Sowjetära erlitten, Hektoliter von Wodka gesoffen und schlechte Zigaretten geraucht hatte, war es gar nicht mal so schlecht.
»Er war so ein schöner Mann, so stark, man dachte, nichts kriegt ihn unter … So ein schöner Mann …«
Juri hatte Irina immer als alleinstehende Frau gekannt. Ihre eigene, nach dem Zweiten Weltkrieg verwitwete Mutter hatte Juris Vater Rubin unter ihre Fittiche genommen, als er noch ein mutterloses Kind war. Der erwachsene Rubin hatte seinerseits den beiden Frauen geholfen, hier mit ein wenig Fisch, da mit ein bisschen Geld. Dann war es ihm gelungen, ihnen die Wohnung gegenüber seiner eigenen zu verschaffen. Als Jugendlicher hatte Juri sich gefragt, woher diese Verbundenheit rührte, doch nichts hatte je auf eine mögliche Beziehung schließen lassen. Irina hatte ihn immer wie den Sohn behandelt, den sie selbst nie gehabt hatte.
Irinas Blick schweifte gedankenverloren zum Fenster, dann fing sie sich wieder.
»Gut, dass du da bist. Ich habe dafür gebetet. Du musst ihn sehen. Er muss unbedingt mit dir sprechen. Er hat dir etwas zu sagen. Geh zu ihm, schnell, bevor …«
Sie beendete den Satz nicht. Juri spürte einen Anflug von Unmut. Hatte sein Vater ihn herkommen lassen, nur um ihm eine Beziehung zu gestehen, die ihm vollkommen egal war? Damit er sich um Irina kümmerte? Dass sein Vater zu einem solchen Akt der Selbstlosigkeit fähig war, glaubte er allerdings nicht. Niemals würde er ein Verhältnis eingestehen, schon gar nicht gegenüber seinem Sohn. Sicher wollte er ein letztes Mal seine Macht beweisen, ihn dazu zwingen, Tausende von Kilometern zurückzulegen, ihn daran erinnern, dass sein Weggehen keine Rebellion, sondern eine ganz banale Flucht gewesen war.
»Behaupte dich, schlag zu, geh drauflos!« Das waren seine immer gleichen Worte, als er jung war. Juri konnte sich nicht vorstellen, dass sein Vater ihn um Frieden bat, einen letzten Segen.
Eine Tür schlug zu. Schritte hallten im Flur. Von einem Balkon schrie eine Stimme einem Kind zu, es solle reinkommen. Das hellhörige Haus verbarg nichts vom Leben seiner Bewohner, stellte Elend und Glück schamlos zur Schau. Das Leben war hier mal voller Hoffnung, mal voller Verzweiflung.
»Geh schnell«, sagte sie noch einmal. »Es geht um Klara.«
»Klara? Meine Großmutter?«
Auf Juris Gesicht zeigte sich Erstaunen. Die Mutter seines Vaters, Klara, war Anfang der Fünfzigerjahre an einer Lungenentzündung gestorben oder an einer ähnlichen Krankheit, das wusste er nicht mehr genau. Er hatte sie nicht kennengelernt, und in der Familie wurde wenig über sie gesprochen, außer um daran zu erinnern, dass sie eine herausragende Geologin gewesen war. Sie hatte ihren Sohn unbedingt Rubin nennen wollen, als Ehrerbietung an ihr Fachgebiet. Der Stalinismus nach dem Krieg missbilligte religiöse Vornamen. Stattdessen wurden »Freiheit«, »Tribun«, »Sowjet« populär, aber auch Namen in Anlehnung an die chemischen Elemente, für die der Wissenschaftler Mendelejew eine Systematik entwickelt hatte. Sie galten als Glorifizierung der russischen Wissenschaft und sollten den Siegeszug der sozialistischen Industrialisierung heraufbeschwören. Auf den Pausenhöfen wurde also ständig nach Titan, Diamant oder Zirkon gerufen. Rubin war da gar nicht mal so schlimm, man dachte dabei an die Härte und das Leuchten dieses Steins, das die Mutter sich vielleicht für ihren Sohn gewünscht hatte. Sein Großvater väterlicherseits, der alte Anton, der nie wieder heiratete, hatte sich mehr schlecht als recht um seinen Sohn gekümmert und bis zu seinem Tod bei ihnen gelebt. Er war ein unscheinbarer, ängstlicher Mann gewesen. Auch er war Geologe und hatte seine Frau an der Fakultät in Sankt Petersburg (damals Leningrad) kennengelernt. Am Ende des Krieges waren sie beide an das nagelneue Labor in Murmansk versetzt worden, als man anfing, die sagenhaften Erzvorkommen auf der Halbinsel Kola nutzbar zu machen.
Juri erinnerte sich nur an eines: Wenn zufällig der Name Klara gefallen war, hatte sich Antons Gesicht verzerrt und eine unendliche Trauer offenbart. Diese Liebe, die den Großvater noch immer umtrieb, Jahrzehnte nach dem Tod seiner Frau, hatte Juri berührt.
»Ja, darum will er dich unbedingt sehen«, fuhr Irina fort. »Er weiß, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Er will dir etwas sagen, was mit seiner Mutter zusammenhängt. Du bist sein einziges Kind.«
»Aber er hat sie doch kaum gekannt, oder? Warum will er über sie reden, warum jetzt?«
»Er war fünf Jahre alt, als sie gestorben ist. Mehr kann ich dir nicht sagen, ich habe sie nicht gekannt. Anton hat nur selten von ihr gesprochen.«
Erst jetzt fiel Juri auf, dass er nie ein Foto von seiner Großmutter gesehen hatte, noch nicht einmal das obligatorische Hochzeitsbild.
Er kam zu spät.
Das Wetter war schlechter geworden, und der Schneeregen ließ das gelbliche Tageslicht nur gedämpft durch die schlecht geputzten Fensterscheiben ins Krankenhauszimmer sickern. In diesem unbewegten Halbdunkel lag Rubin. Auf den über der Decke gefalteten Händen zeichnete sich noch das Netz der dicken, wie Raupen hervorstehenden Venen ab, die von seiner einstigen Kraft zeugten. Auf dem wächsernen Gesicht traten unter der straffen Haut rund um die Augenhöhlen die Knochen hervor.
Einige Sekunden lang glaubte Juri, sein Vater sei bereits gegangen. Er hatte nicht damit gerechnet, dass ihn eine solche Niedergeschlagenheit, eine solche Ohnmacht ergreifen würde, und war verblüfft. Es war nicht bloß der Gedanke, dass er den ganzen Weg umsonst gemacht hatte, und auch nicht die Aussicht, niemals zu erfahren, was sein Vater ihm über seine Großmutter hatte sagen wollen. Es war grausamer und simpler zugleich: der Tod des Vaters, das Gefühl einer unwiederbringlich verpassten Begegnung. Er hätte unbedingt noch einmal mit ihm sprechen wollen. Nur sprechen, auch ohne etwas Wichtiges zu sagen. Es war zu spät.
Einen Moment lang war er wie versteinert, dann besann er sich. Sein Vater lag in einem Pflegezimmer. Keine Krankenschwester hatte ihm irgendetwas gesagt. Der gelbliche Schlauch, der von einem Infusionsständer herunterhing und in die Nase führte, ließ zweifellos darauf schließen, dass er noch über eine Sonde ernährt wurde. Als er genauer hinschaute, sah er, wie die Decke sich über der Brust ganz leicht hob. Rubin atmete.
Juri ließ sich auf einen Plastikstuhl fallen und betrachtete seinen Vater. Obwohl er abgemagert war, erkannte Juri die stämmige Gestalt wieder. Rubin war weder groß, nur knapp einen Meter siebzig, noch dick, aber äußerst muskulös mit knorrigen Gliedmaßen, die davon zeugten, dass sie sich verausgabt, aufgerieben, abgekämpft hatten. Seine blonden, immer extrem kurz geschnittenen Haare waren inzwischen weiß und dünn geworden, fast unsichtbar, und ließen die von tiefen Falten durchfurchte Stirn frei. Die hervorspringende Nase, die er seinem Sohn vererbt hatte, war mit dem bei Alkoholikern üblichen Netz aus Adern überzogen und nach mehreren nie ärztlich versorgten Brüchen schief. Was sich am wenigsten verändert hatte, war der Mund. Die vorragende Unterlippe und die nach unten gezogenen Mundwinkel verliehen ihm einen herablassenden, stets misstrauischen Ausdruck, als sei er in einem fort wütend. Anscheinend gab das Krankenhaus sich nicht die Mühe, die Patienten zu rasieren. Sein Kinn war übersät mit weißen Haaren, was er sicher verabscheut hätte. Doch sein Wille zählte kaum noch.
Sein Vater, der immer nur vom Siegen gesprochen hatte, war nun selbst besiegt. Der reglose Körper war Ausdruck der unausweichlichen Niederlage angesichts von Krankheit und Tod. Juri dachte daran, dass auch er eines Tages so daliegen würde, und er hatte Angst. Naturgemäß war er als Nächstes an der Reihe.
Rubin bewegte den Kopf, als wolle er sich die Sonde herausreißen, und öffnete unvermittelt die Augen. Eine Minute nahm er seinen Sohn am Rande seines Blickfelds gar nicht wahr. Er starrte an die Decke mit einer Ergebenheit, die Juri nie an ihm erlebt hatte. Dann drehte er den Kopf ein wenig und sah ihn. Er kniff die Augen leicht zusammen, um zu begreifen, zeigte aber keinerlei Überraschung. Sein Blick war nach wie vor von diesem scharfen Blau, das das Gegenüber durchbohrte. Unmöglich, diese Augen anzulügen.
»Da bist du.«
Die Stimme war heiserer und leiser als in seiner Erinnerung.
»Guten Tag, Papa, wie geht es dir?«
»Hör auf mit dem Theater. Es ist dir doch egal, wie es mir geht. Ich werde bald sterben. Das weißt du, darum bist du gekommen. Tut mir leid, dass ich dir nichts vererbe.«
Rubins Räuspern klang wie ein höhnisches Lachen.
»Aber darauf bist du ja auch gar nicht angewiesen. Du bist doch stinkreich bei den Amis, oder?«
Beinahe wäre Juri eingeknickt. Schweigen oder das Thema wechseln. Aber nein. Er war nicht hier, um diese Aggressivität hinzunehmen.
»Danke, stimmt, ich habe ein gutes Leben in Amerika. Aber könnten wir nicht …«
Sein Vater hob abwehrend den Arm und schrie beinahe.
»Keine Moralpredigt.«
Sein Arm fiel wieder hinunter, ob aus Kraftlosigkeit oder um ihn zu verspotten, blieb offen. Mit dumpfer Stimme fuhr er fort: »Dazu ist zwischen uns alles gesagt, Juri. Du hättest dich nicht zwölf Stunden ins Flugzeug setzen müssen, um wieder damit anzufangen. Mein Leben ist zu Ende. Ich hab nicht mehr groß was zu erwarten als zu sterben. Ich tue dir einen Gefallen, du hast gewonnen. Ich bin ein alter Alkoholiker, der sein Leben verpfuscht hat. Russland ist ein Saustall geworden, ein Land voller Gangster. Wer weiß, ob Putin da je wieder Ordnung reinbringt. Aber das ist mir egal.«
Noch nie hatte Rubin einen solchen Defätismus an den Tag gelegt. Sein wildes, raubtierhaftes Wesen, das ihn die Widrigkeiten der UdSSR hatte überleben lassen, schien erloschen. Der nahende Tod raubte ihm die Gewissheiten, sodass er nun, da es auf das Ende zuging, gänzlich schutzlos war. Aber war es nur die verfahrene Situation im heutigen Russland, die ihm so naheging?
Beide schwiegen. Es war eine bedrückende Stille, die zu füllen keiner von ihnen den Mut aufbrachte. Wenn keine Zeit mehr war, etwas zu klären, worüber sollten sie dann noch reden?
Draußen hatte sich der Himmel weiter verdunkelt. Wind war aufgekommen, Böen fauchten die Fassade entlang. Irgendwo schlug ein Blech. Früher hätte solch ein Wetterumschwung Rubins Wachsamkeit angefacht, seine Kampfeslust, diesen unberechenbaren Drang, in See zu stechen, während Juri ganz im Gegenteil die aufsteigende Angst in sich gespürt hätte.
»Nicht mehr groß was zu erwarten …«, hatte sein Vater gesagt. Doch was war es, das seinen Körper noch am Leben hängen ließ?
Juri wagte einen Einstieg. »Irina hat mir von Klara erzählt.«
Rubins Atem schien schwerer zu werden und sich tiefer ins Zimmer auszubreiten. Juri merkte, wie im Innern dieses Mannes, der es stets verstanden hatte, seine Gefühle von sich fernzuhalten, etwas ins Wanken geriet.
»Deine Großmutter.«
Rubin hatte nicht »Mama« und noch nicht einmal »meine Mutter« gesagt, als seien diese Worte immer noch unaussprechlich. Der erstickte Ton verriet Juri, dass er auf der richtigen Fährte war. Mit der Umsicht eines Dompteurs fuhr er fort.
»Du hast nie viel von ihr erzählt. Vielleicht ist es an der Zeit.«
»Nein, es ist zu spät. Das Unglück ist passiert. Aber man sollte es zumindest kennen und vielleicht verstehen.«
Rubin verzog das Gesicht zu einem schiefen Grinsen, um die Fassung zu wahren.
»Halt mich nicht für sentimental, aber ich glaube in der Tat, dass die Geschichte mit deiner Großmutter mein Leben verpfuscht hat.«
Er richtete sich in den Kissen auf und schloss die Augen. Juri begriff, dass er reden wollte und er, Juri, der unwürdige Sohn, sein letzter Vertrauter sein würde.
Mit geschlossenen Augen erzählte Rubin eine Geschichte, die siebzig Jahre zurücklag und von der er kein einziges Detail vergessen hatte.
Klara und Anton waren kurz nach Kriegsende mit ihrem Baby Rubin nach Murmansk gekommen, wo gerade ein Labor wiedereröffnet wurde. Beide waren Geologen. Klara als die Brillantere hatte eine Stelle als Abteilungsleiterin, Anton als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Rubin schilderte ein privilegiertes Leben. Die Fakultät brachte ihre Professoren in einem großen, inzwischen abgerissenen Gemeinschaftsgebäude unter, wo sie als Führungskräfte das Glück hatten, zwei Zimmer zu bewohnen: ein Schlafzimmer und eine Küche.
Außerdem kamen sie in den Genuss von Lebensmittelkarten und vor allem von Kohle. Und abends gab es viel Besuch, zum einen wegen der Wärme, zum anderen wegen der besonderen Atmosphäre. Denn Rubin beschrieb seine Mutter als eine unverbesserliche Optimistin, eine energiegeladene Frau, die gern Freunde um sich scharte. Trotz der langen Arbeitstage war die Küche abends voller Leute, die sich alte russische Witze erzählten, gegenseitig Tipps für gute Geschäfte gaben oder Rezepte austauschten, um mit der schlechten Versorgungslage klarzukommen. In dieser wohligen Atmosphäre wanderte Rubin von einem Schoß zum nächsten. Am Ende dieser Abende wurde gesungen. Seine Eltern hatten schöne Stimmen, und das Kind schlief auf den Knien seiner Mutter ein, zu den Klängen einer provokanten Mischung aus revolutionären Texten und alten Abzählversen.
Aber dieses kindliche Paradies sollte nicht von Dauer sein. Rubin schätzte, dass er etwa viereinhalb Jahre gewesen war, als Klara anfing, sich Sorgen zu machen. Schon seit ein paar Monaten gab es immer weniger Besuche von Freunden, und die Lieder wurden seltener. Eine angespannte Atmosphäre machte sich breit, die Kinder instinktiv wahrnehmen, ohne den Grund dafür zu kennen. Rubin wachte immer wieder mitten in der Nacht von den erregten Stimmen seiner Eltern in der Küche auf. Bis dahin war der Ton nie laut geworden, sodass es außerhalb von Rubins Vorstellungskraft lag, dass Eltern sich stritten. Die Familie war ein Refugium, ein Ort des unerschütterlichen Friedens. Doch plötzlich schlich sich irgendetwas, irgendwer an, eine Bedrohung, die kein Gesicht hatte.
Eines Nachts hörte er Anton deutlich durch die Trennwand stammeln: »Du bist verrückt, hör auf, du bringst uns alle in Gefahr!«
Rubin machte eine Pause, ohne die Augen zu öffnen. Der leichte Schweiß, der auf seiner Stirn glänzte, zeigte, wie sehr er sich anstrengte. Das Schwerste hatte er noch nicht gesagt.
Die Angst drang in ihr Leben ein, das nicht mehr wie vorher war. Sie machten keine Spaziergänge mehr, als müssten sie sich verstecken, obwohl das späte Frühjahr außergewöhnlich mild war. Nachts hörte Rubin von seinem Alkoven im Schlafzimmer aus seinen Vater oder seine Mutter durch die Küche gehen. Stundenlang fiel der Lichtschein unter der Tür hindurch, er hörte sie schniefen. Die Angst seiner Eltern kroch auch in ihn hinein, die nervösen Gesten, mit denen sie die Gardinen beiseiteschoben, um nach wem auch immer Ausschau zu halten. Sie redeten nur noch im Flüsterton miteinander und beschränkten sich auf die nötigsten Dinge rund um den Haushalt, die quirligen Gespräche von früher blieben aus. Sobald eine Tür im Haus zufiel, schreckten sie hoch.
Die giftige Atmosphäre breitete sich in ihrem Leben aus bis zu einer Nacht im Juni 1950. Klara war, wie immer öfter, lange im Labor geblieben. Anton hatte Rubin Essen gemacht, das er selbst nicht anrührte, und ihn ins Bett gebracht.
Mitten in der Nacht wurde heftig an der Tür geklopft. Anton schrie: »Das sind sie!«
Quasi im selben Moment drangen drei Männer ins Schlafzimmer ein, die lange schwarze Regenmäntel trugen und Hüte, die sie nicht einmal abnahmen.
»Klara Sergejewna Bondarew? Komm mit, es gibt ein paar Fragen zu klären.«
Rubin erzählte, dass er zunächst erleichtert war. Jetzt würde die Anspannung sich auflösen. Zumal die Männer zwar nicht freundlich, aber auch nicht richtig böse wirkten. Sie sahen aus, als wären sie müde von der nächtlichen Arbeit und dem langweiligen Auftrag, den sie zu erledigen hatten. Sie kamen ihm vor wie seine Kindergärtnerinnen, wenn sie sich über ein bockiges Kind ärgerten.
»Anton Wassiljewitsch Bondarew, du bist der Ehemann. Du musst hier unterschreiben, um die Festnahme zu bezeugen. Das ist Vorschrift.«
Im Gegensatz zu den gelassenen Männern schwitzten seine Eltern vor Angst. Rubin begriff schnell, dass es hier nicht um eine kleine Dummheit wie im Kindergarten ging.
Die Genauigkeit von Rubins Beschreibung zeugte davon, wie tief sich die Szene in sein junges Gedächtnis eingeschrieben hatte.
Klara blieb im Bett, die Decke wie einen lächerlichen Schutz an die Brust gepresst. Anton stand im Schlafanzug daneben und blickte verzweifelt zwischen seiner Frau und den Männern hin und her. Er war den Tränen nahe.
»Klara Sergejewna, zieh dich an, hier, vor unseren Augen. Keine Sperenzchen.«
Sie stand auf und wand sich verschämt, um unter dem Nachthemd die Unterwäsche anzuziehen. Die Eheleute schauten zu Boden und sprachen kein Wort miteinander. Ihre Bewegungen waren mechanisch. Man hätte meinen können, sie spulten eine vor langer Zeit einstudierte Rolle ab. Klara holte einen fertig gepackten Koffer unter dem Bett hervor, doch einer der Männer winkte ab.
»Nicht nötig, es dauert nicht lange.«
Sie beharrte darauf, er zuckte mit den Schultern und ließ sie machen. Dann schien sie sich an ihren Sohn zu erinnern, der den Kopf durch den Vorhang vor seinem Bett streckte und die Szene beobachtete. Sie stürzte sich auf ihn und brach in Tränen aus, als sie ihn an sich drückte. Das erste und letzte Mal, dass er sie weinen sah. Diese unvermittelte Bewegung löste eine ebensolche Reaktion aus. Zwei der Männer zogen sie zurück, und Rubin fiel auf den Boden. Der eine hielt sie fest und drückte ihr die Hand auf den Mund, damit sie nicht schrie.
»Kein Theater, hörst du. An dein Balg hättest du vorher denken sollen.«
Einen Moment kämpfte sie wie ein panisches Tier, dann fügte sie sich plötzlich in den tödlichen Griff.
Anton nutzte die Gelegenheit, um seinen Sohn hochzunehmen und so sehr an sich zu pressen, dass der gebrüllt hätte, wäre er nicht so verblüfft gewesen.
»Nicht ihn, ich flehe euch an, tut ihm nichts!«
Rubin erinnerte sich, dass er seinen Vater gehasst hatte, der nicht in der Lage gewesen war, seine Mutter vor diesen schwarzen Männern zu beschützen. Er konnte nichts als jammern und weinen. Antons schweißnasser Schlafanzug klebte an seinem Gesicht und versperrte ihm die Sicht.
An dieser Stelle seines Berichts öffnete Rubin ein einziges Mal kurz die Augen.
»Feigling«, stieß er aus.
Die Männer nahmen Klara mit. Ihr Koffer blieb mitten im Zimmer stehen.
Dann kamen sie zurück, um die Wohnung systematisch zu durchsuchen, indem sie alles auf den Kopf stellten, sogar die Bilderrahmen, sie leerten den Schrank, inspizierten jedes Buch, als könne sich darin irgendetwas verstecken, hoben selbst die Bretter des Holzfußbodens hoch. Es nahm kein Ende. Jeder Gegenstand, der auf den Boden fiel, zerriss die Stille. Das ganze Haus hielt den Atem an und lauschte, wie man hier Leben auslöschte. Anton trug seinen Sohn die ganze Zeit stumm auf dem Arm und ging zur Seite, je nachdem, was gerade durchsucht wurde. Man hätte meinen können, er wollte die Leute nicht bei ihrer Arbeit stören. Am Ende sammelten sie ein paar Fotoalben und Papiere zusammen und gingen, ohne die Tür zu schließen. Es wurde hell.
Rubin erinnerte sich nicht, wie lange sie niedergeschlagen dagesessen hatten, Anton vor der Zwischenwand in der Küche kauernd, sein Sohn auf dem Schoß, wo er schließlich einschlief.
Die nächsten drei Tage irrte Anton im Schlafanzug herum, ohne die Wohnung zu verlassen. Er schwieg die ganze Zeit, räumte auf, wärmte zweimal am Tag die Kohlsuppe auf, solange noch etwas da war. Er wirkte erstarrt, blätterte geistesabwesend in einem Buch, strich liebevoll über den Schnitt, bevor er es wieder an seinen angestammten Platz im Regal stellte. Dann stand er minutenlang am Fenster, als warte er auf die Rückkehr seiner Frau.
»Ich wusste sofort, dass man über das, was passiert war, nicht sprechen durfte, nie wieder sprechen durfte«, murmelte Rubin und öffnete endlich die Augen. »Deine Großmutter hatte irgendwas getan. Mein Vater hatte recht, sie hat uns in Gefahr gebracht. Ich habe sie gehasst. Sie hat uns verraten. Ich war viel zu klein, um zu verstehen, was sich in den Monaten zuvor zusammengebraut hatte. Aber ich habe sofort gespürt, dass ich es nicht herausfinden durfte.«
Ein winziger Tropfen rann über sein Lid.
»Ihretwegen mussten wir in der nächsten Woche umziehen, ins Rotlichtviertel, gleich neben dem Hafen. Wegen der Wohnungsnot nach dem Krieg wurden alte Eisenbahnwaggons mit ein bisschen Farbe getüncht und in Wohnungen für die Arbeiter aus den Fischfabriken umfunktioniert. Es gab kein Badezimmer. Das Wasser musste man draußen aus dem Hahn holen. Im Winter war es schweinekalt. Es hat gestunken. Dein Großvater wurde vom Dozenten zum einfachen Laboranten zurückgestuft. Immerhin hatte er Glück, dass Wissenschaftler Mangelware waren und er nicht vor die Tür gesetzt wurde. Wir bekamen keine Essenspakete mehr, und weil er so wenig verdiente, lernte ich, was Hunger ist. Wer uns damals gerettet hat, das war Efira, die Mutter von Irina, mit ihrer kleinen Rente, die sie als Kriegswitwe bekam. Als wir im Rotlichtviertel ankamen, haben wir allen erzählt, deine Großmutter wäre an Tuberkulose gestorben. Tja.«
Damit verstummte Rubin. Er hatte seine ganze Geschichte in einem Zug erzählt und damit etwas preisgegeben, das ihn lange beschäftigt hatte.
Die Wolken hatten das Tageslicht verschluckt. Die Dunkelheit im Krankenzimmer passte zu der tragischen Geschichte. Nur die Straßenbeleuchtung ließ die metallenen Bettpfosten leuchten. Auf dem Flur hörte man den Essenswagen klappern. Zum Glück wurde Rubin über eine Sonde ernährt. Keiner von beiden hätte das Hereinplatzen der Pflegerin mit der Suppe ertragen.
Juri versuchte eine Bestandsaufnahme: Er war nicht überrascht. In der Nachkriegszeit war die Repression am schlimmsten gewesen und besonders vehement betrieben worden. Um die ausgeblutete UdSSR wiederaufzubauen oder eher den amerikanischen Imperialismus zu übertreffen, brauchte man alles, und zwar schnell: Millionen Hektar Land mussten erschlossen werden, der Wald und die Bodenschätze Sibiriens. Städte, Fabriken, Straßen, Brücken, Eisenbahnlinien und Kanäle mussten wiederaufgebaut werden, man musste sich an die Spitze des Wettrüstens setzen, die Atomenergie beherrschen, als Erstes im Weltall sein … Für all das wurde vor allem menschliche Arbeitskraft benötigt. Das sowjetische System, das zur Unterdrückung der Opposition vor dem Krieg den Gulag erfunden hatte, sah nun in der Zwangsarbeit die Möglichkeit, diese gewaltige Herausforderung zu meistern. Die Verhaftungen erreichten ein bislang nicht gekanntes Ausmaß. Einerseits setzte das paranoide Regime gnadenlos auf Misstrauen und Repression, andererseits wuchs mit jeder Internierung das Heer der Arbeitskräfte, die man anderswo Sklaven genannt hätte. Von 1938 bis zu Stalins Tod 1953 entwickelte sich der Gulag unter der Regie von Beria zum größten Unternehmen des Landes. Im Jahr von Klaras Verhaftung gab es bis zu zweieinhalb Millionen Gefangene, die auf Hunderte Lager verteilt waren. Dieser Moloch konnte nicht genug bekommen. Um den Betrieb am Laufen zu halten, waren weitere Verhaftungen erforderlich, die die Organisation – von den Gefangenen »Fleischwolf« genannt – nährten. Massenhaft Menschen wurden verhaftet, weil sie an der falschen Stelle Ja oder Nein oder weder das eine noch das andere gesagt hatten. Es reichte, zwanzig Minuten zu spät in der Fabrik zu erscheinen, um wegen Sabotage angeklagt und für mindestens zwei Jahre interniert zu werden. Ein unpassender Witz, eine schlechte Ernte, die Tatsache, dass man eine Fremdsprache sprach, im Westen gewesen oder ein ehemaliger Kriegsgefangener war, durch die Felder streifte, wenn das Essen nicht reichte, sich mit der Familie eines Gefangenen traf oder ein einziges Mal über einen Befehl murrte … Egal was, egal wer, egal wie. Anfang der Fünfzigerjahre lief die Maschinerie auf Hochtouren. Nicht ein einziges der großen Häuser an den Hängen von Murmansk blieb verschont – vor den schwarzen Autos, die davor hielten, vor den Männern, die mitten in der Nacht ausstiegen, und vor den zuschlagenden Türen, die in der angsterfüllten Stille der Nachbarn widerhallten.
All das wusste Juri. Seit der Veröffentlichung von Chruschtschows Rede 1956 und vor allem seit den Achtziger- und Neunzigerjahren hatte sich die Wahrheit über die Massendeportationen zunächst angedeutet und war dann ans Tageslicht gekommen. Er wusste es. Doch hier, in diesem armseligen Krankenhauszimmer, am Bett des alten Mannes, begriff er, dass er auch nicht eine Sekunde lang in Erwägung gezogen hatte, dass seine eigene Familie betroffen sein könnte. Eine seltsame Scham überkam ihn, die Scham befreiter Sklaven und ihrer Nachfahren, die unerklärliche Scham von Opfern, als könne man dadurch Schuld auf sich laden, dass man seinen Peinigern nicht entkommen ist.
Was hatte sie getan? Was war aus ihr geworden? Er kannte diese unnützen Fragen, konnte aber nicht umhin, sie sich trotzdem zu stellen. War er der Enkel einer visionären Widerstandskämpferin, eines schlichten Opfers beruflicher Missgunst oder einer Idiotin, die einen unpassenden Witz gemacht hatte? Gab es Anlass, stolz darauf zu sein, eine Frau als Großmutter zu haben, durch die die Familiengeschichte aus den Fugen geraten war? Woher rührte diese unauslöschliche Narbe, die das Leben seines Vaters und sein eigenes auf den Kopf gestellt hatte?
Rubin blieb lange still. Dann schien er seine letzten Kräfte zu mobilisieren.
»Ich hab es nie erfahren. Nie erfahren können. Und …«
Seine Stimme glitt in eine merkwürdige, fast kindliche Tonlage.
»Hab mich nie getraut, es herauszufinden. Es zumindest zu probieren.«
Für jemanden, dessen Lebensgrundsatz Mut gewesen war und der versucht hatte, ihn seinem Sohn mit dem Ledergürtel einzuprügeln, war dieses Eingeständnis ebenso unerwartet wie unpassend.