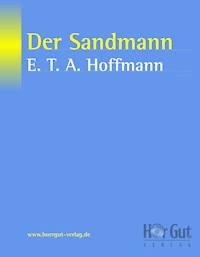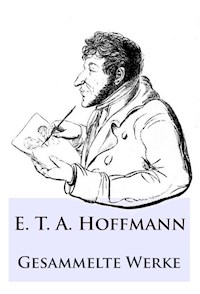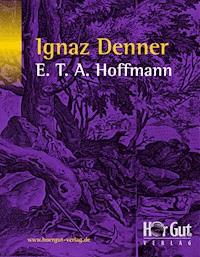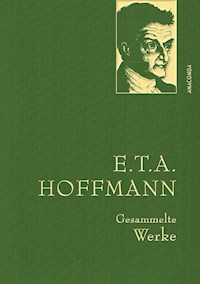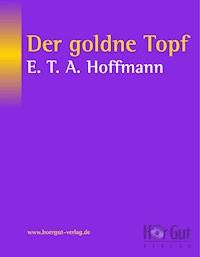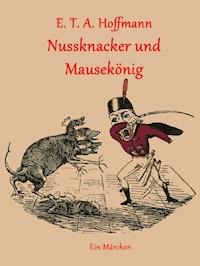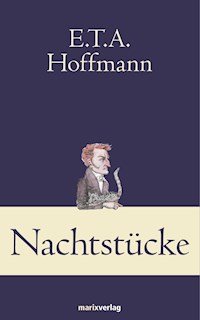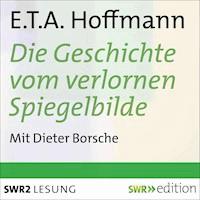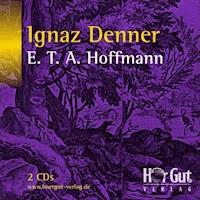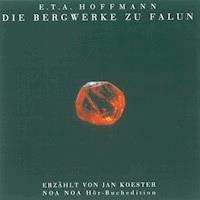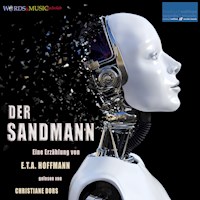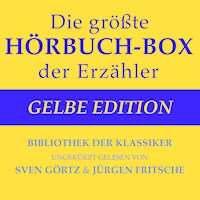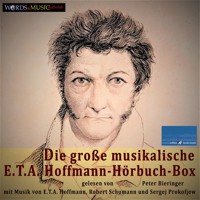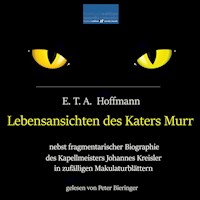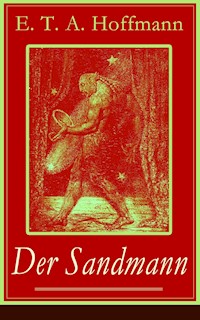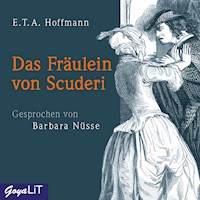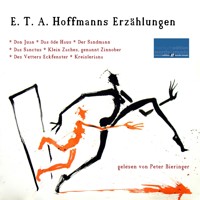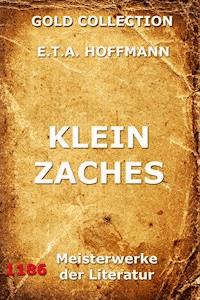
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Klein Zaches genannt Zinnober stellt ein sog. Kunstmärchen dar, das im Gegensatz zum Volksmärchen nicht auf von altersher mündlich überlieferte Motive zurückgreift, sondern die Schöpfung der Phantasie eines einzelnen Autors ist. (aus wikipedia.de)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 181
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klein Zaches
E. T. A. Hoffmann
Inhalt:
Ernst Theodor Amadeus (E.T.A.) Hoffmann – Biografie und Bibliografie
Klein Zaches
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Letztes Kapitel
Klein Zaches, E.T.A. Hoffmann
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849616205
www.jazzybee-verlag.de
Frontcover: © Vladislav Gansovsky - Fotolia.com
Ernst Theodor Amadeus (E.T.A.) Hoffmann – Biografie und Bibliografie
Einer der originellsten und phantasiereichsten deutschen Erzähler, zugleich auch Musiker und Maler, geb. 24. Jan. 1776 zu Königsberg i. Pr., gest. 24. Juli 1822 in Berlin. Er studierte in seiner Vaterstadt die Rechte, arbeitete seit 1796 bei der Oberamtsregierung in Großglogau und seit 1798 bei dem Kammergericht in Berlin, wurde 1800 Assessor bei der Regierung in Posen, aber wegen einiger anzüglichen Karikaturen, die er gefertigt, 1802 als Rat nach Plozk und 1803 in gleicher Eigenschaft nach Warschau versetzt, wo damals auch J. E. Hitzig und Zacharias Werner als preußische Beamte tätig waren. Der Einmarsch der Franzosen 1806 machte hier seiner amtlichen Laufbahn ein Ende. Ohne Vermögen und ohne Aussichten im Vaterland, benutzte er seine musikalischen Talente zum Broterwerb und ging 1808 auf Einladung des Grafen Julius v. Soden als Musikdirektor bei dem neuerrichteten Theater nach Bamberg. Als dieses bald nachher geschlossen wurde, geriet er in die größte Not. Nachdem er sich einige Zeit durch Musikunterricht und Arbeiten für die Leipziger »Allgemeine musikalische Zeitung« die nötigsten Unterhaltsmittel erworben, erhielt er 1813 die Stellung als Musikdirektor bei der Secondaschen Schauspielergesellschaft und leitete bis 1815 das Orchester dieser abwechselnd in Dresden und in Leipzig spielenden Truppe. 1816 wurde er wieder als Rat bei dem königlichen Kammergericht in Berlin angestellt; er starb daselbst an der Rückenmarksschwindsucht nach qualvollen Leiden. H. hatte sich von Jugend auf mit Vorliebe dem Studium der Musik gewidmet. In Posen brachte er das Goethesche Singspiel »Scherz, List und Rache« aufs Thea ter, in Warschau »Die lustigen Musikanten« von Brentano, dazu die Opern: »Der Kanonikus von Mailand« und »Liebe und Eifersucht«, deren Text er nach ausländischen Mustern selbst bearbeitete. Auch setzte er die Musik zu Werners »Kreuz an der Ostsee« und komponierte für das Berliner Theater Fouqués zur Oper umgestaltete »Undine«, deren Partitur samt den prächtigen, nach Hoffmanns Entwürfen gefertigten Dekorationen bei dem Brande des Opernhauses zugrunde ging. Die Aufforderung, seine in der »Musikalischen Zeitung« zerstreuten Aufsätze zu sammeln, veranlaßte ihn zur Herausgabe der »Phantasiestücke in Callots Manier« (Bamberg 1814, 4 Bde.; 4. Aufl., Leipz. 1864, 2 Bde.), die großes Aufsehen machten und ihm die unterscheidende Bezeichnung »H.-Callot« verschafften. Weiter folgten: »Vision auf dem Schlachtfeld von Dresden« (Leipz. 1814); »Elixiere des Teufels« (Berl. 1816); »Nachtstücke« (das. 1817, 2 Bde.); »Seltsame Leiden eines Theaterdirektors« (das. 1818); »Die Serapionsbrüder« (das. 1819–21, 4 Bde.; nebst einem Supplementband, der Hoffmanns letzte Erzählungen enthält, das. 1825); »Klein Zaches, genannt Zinnober« (das. 1819, 2. Aufl. 1824); »Prinzessin Brambilla, ein Capriccio nach Jakob Callot« (das. 1821); »Meister Floh, ein Märchen in sieben Abenteuern zweier Freunde« (Frankf. 1822); »Lebensansichten des Katers Murr, nebst fragmentarischer Biographie des Kapellmeisters Johannes Kreisler, in zufälligen Makulaturblättern« (Berl. 1821–22, 2 Bde.); »Der Doppelgänger« (Brünn 1822) und einige kleinere Erzählungen, von denen »Meister Martin und seine Gesellen«, »Das Majorat«, »Das Fräulein von Scudéry«, »Der Artushof«, »Doge und Dogaresse« etc. wahre Meisterstücke der Novellistik genannt zu werden verdienen. H. war ein durchaus origineller Mensch, mit den seltensten Talenten ausgerüstet, wild, ungebunden, nächtlichem Schwelgen leidenschaftlich ergeben (wobei er in Berlin besonders an Ludwig Devrient einen geistesverwandten Genossen hatte) und doch ein trefflicher Geschäftsmann und Jurist. Voll scharfen und gesunden Menschenverstandes, der den Erscheinungen und Dingen sehr bald die schwachen und lächerlichen Seiten ablauschte, gab er sich doch allerlei phantastischen Anschauungen und abenteuerlichem Dämonenglauben hin. Exzentrisch in seiner Begeisterung, Epikureer pis zur Weichlichkeit und Stoiker bis zur Starrheit, Phantast bis zum fratzenhaftesten Wahnsinn und witziger Spötter bis zur phantasielosen Nüchternheit, vereinigte er die seltsamsten Gegensätze in sich, Gegensätze, in denen sich auch seine meisten Novellen bewegen. In allen seinen Dichtungen fällt der Mangel an Ruhe zuerst auf, seine Phantasie und sein Humor reißen ihn unaufhaltsam mit sich fort. Finstere Gestalten umkreisen und durchkreuzen stets die Handlung, und das Wilddämonische spielt selbst in die Welt der philisterhaften und modernen Alltäglichkeit hinein. In der Virtuosität, gespenstiges Grauen zu erwecken, werden wenige Erzähler H. erreicht haben; es ist glaubhaft, daß er sich, wie man erzählt, vor seinen eignen gespenstigen Gestalten gefürchtet habe. Die Sprache handhabte er mit großer Gewandtheit, wenn auch nicht ohne Manier. Als Musikkritiker hielt er zu Spontini und den Italienern gegen K. M. v. Weber und die aufblühende deutsche Oper, wirkte aber für das Verständnis Mozarts und Beethovens. Eine Sammlung seiner »Ausgewählten Schriften« erschien Berlin 1827–28, 10 Bde., denen seine Witwe Micheline, geborne Rorer, 5 Bände Supplemente (Stuttg. 1839) beifügte, welche die Erzählungen aus seinen letzten Lebensjahren und die 3. Auflage von Hitzigs Biographie (»Hoffmanns Leben und Nachlaß«, zuerst Berl. 1823) enthalten. Eine neue Ausgabe erschien u. d. T. »Gesammelte Schriften« (Berl. 1871–73. 12 Bde.), in der Hempelschen Sammlung (das. 1879–83, 15 Tle.) und, besorgt von E. Griesebach, in M. Hesses Klassikerausgaben (»Sämtliche Werke«, Leipz. 1899, 15 Bde.); eine gut kommentierte Auswahl der »Werke« bot Schweizer (das. 1896, 3 Bde.), eine andre mit Einleitung von Lautenbacher erschien im Cottaschen Verlag (Stuttg. 1894, 4 Bde.). Vgl. auch »Das Kreislerbuch, Texte, Kompositionen und Bilder.« Zusammengestellt von Hans v. Müller (Leipz. 1903). H. war auch ein geschickter Karikaturenzeichner, von dem mehrere Karikaturen auf Napoleon I. herrühren. Interessante Erinnerungen an H. gab Funck (K. F. Kunz) in seiner Schrift »Aus dem Leben zweier Dichter, Ernst Theod. Wilh. H. und Fr. G. Wetzel« (Leipz. 1836). Im Ausland, besonders in Frankreich, ist H. vielfach übersetzt und nachgeahmt worden. Vgl. Ellinger, E. T. A. Hoffmann, sein Leben und seine Werke (Hamb. 1894); O. Klinke, E. T. A. Hoffmanns Leben und Werke. Vom Standpunkte des Irrenarztes (Braunschw. 1903).
Klein Zaches
Ein Märchen
Erstes Kapitel
Der kleine Wechselbalg. – Dringende Gefahr einer Pfarrersnase. – Wie Fürst Paphnutius in seinem Lande die Aufklärung einführte und die Fee Rosabelverde in ein Fräuleinstift kam.
Unfern eines anmutigen Dorfes, hart am Wege, lag auf dem von der Sonnenglut erhitzten Boden hingestreckt ein armes zerlumptes Bauerweib. Vom Hunger gequält, vor Durst lechzend, ganz verschmachtet, war die Unglückliche unter der Last des im Korbe hoch aufgetürmten dürren Holzes, das sie im Walde unter den Bäumen und Sträuchern mühsam aufgelesen, niedergesunken, und da sie kaum zu atmen vermochte, glaubte sie nicht anders, als daß sie nun wohl sterben, so sich aber ihr trostloses Elend auf einmal enden werde. Doch gewann sie bald so viel Kraft, die Stricke, womit sie den Holzkorb auf ihrem Rücken befestigt, loszunesteln und sich langsam heraufzuschieben auf einen Grasfleck, der gerade in der Nähe stand. Da brach sie nun aus in laute Klagen: »Muß,« jammerte sie, »muß mich und meinen armen Mann allein denn alle Not und alles Elend treffen? Sind wir denn nicht im ganzen Dorfe die einzigen, die aller Arbeit, alles sauer vergossenen Schweißes ungeachtet in steter Armut bleiben und kaum so viel erwerben, um unsern Hunger zu stillen? – Vor drei Jahren, als mein Mann beim Umgraben unseres Gartens die Goldstücke in der Erde fand, ja, da glaubten wir, das Glück sei endlich eingekehrt bei uns und nun kämen die guten Tage; aber was geschah! – Diebe stahlen das Geld, Haus und Scheune brannten uns über dem Kopfe weg, das Getreide auf dem Acker zerschlug der Hagel, und um das Maß unseres Herzeleids vollzumachen bis über den Rand, strafte uns der Himmel noch mit diesem kleinen Wechselbalg, den ich zu Schand' und Spott des ganzen Dorfs gebar. – Zu St. Laurenztag ist nun der Junge drittehalb Jahre gewesen und kann auf seinen Spinnenbeinchen nicht stehen, nicht gehen und knurrt und miaut, statt zu reden, wie eine Katze. Und dabei frißt die unselige Mißgeburt wie der stärkste Knabe von wenigstens acht Jahren, ohne daß es ihm im mindesten was anschlägt. Gott erbarme sich über ihn und über uns, daß wir den Jungen groß füttern müssen uns selbst zur Qual und größerer Not; denn essen und trinken immer mehr und mehr wird der kleine Däumling wohl, aber arbeiten sein Lebetage nicht! Nein, nein, das ist mehr als ein Mensch aushalten kann auf dieser Erde! – Ach könnt' ich nur sterben – nur sterben!« – Und damit fing die Arme an zu weinen und zu schluchzen, bis sie endlich, vom Schmerz übermannt, ganz entkräftet einschlief. –
Mit Recht konnte das Weib über den abscheulichen Wechselbalg klagen, den sie vor drittehalb Jahren geboren. Das, was man auf den ersten Blick sehr gut für ein seltsam verknorpeltes Stückchen Holz hätte ansehen können, war nämlich ein kaum zwei Spannen hoher, mißgestalteter Junge, der von dem Korbe, wo er querüber gelegen, heruntergekrochen, sich jetzt knurrend im Grase wälzte. Der Kopf stak dem Dinge tief zwischen den Schultern, die Stelle des Rückens vertrat ein kürbisähnlicher Auswuchs, und gleich unter der Brust hingen die haselgertdünnen Beinchen herab, so daß der Junge aussah wie ein gespalteter Rettich. Vom Gesicht konnte ein stumpfes Auge nicht viel entdecken, schärfer hinblickend, wurde man aber wohl die lange spitze Nase, die aus schwarzen struppigen Haaren hervorstarrte, und ein paar kleine, schwarz funkelnde Äuglein gewahr, die, zumal bei den übrigens ganz alten, eingefurchten Zügen des Gesichts, ein klein Alräunchen kundzutun schienen. –
Als nun, wie gesagt, das Weib über ihren Gram in tiefen Schlaf gesunken war und ihr Söhnlein sich dicht an sie herangewälzt hatte, begab es sich, daß das Fräulein von Rosenschön, Dame des nahegelegenen Stifts, von einem Spaziergange heimkehrend, des Weges daherwandelte. Sie blieb stehen und wurde, da sie von Natur fromm und mitleidig, bei dem Anblick des Elends, der sich ihr darbot, sehr gerührt. »O du gerechter Himmel,« fing sie an, »wieviel Jammer und Not gibt es doch auf dieser Erde! – Das arme unglückliche Weib! – Ich weiß, daß sie kaum das liebe Leben hat, da arbeitet sie über ihre Kräfte und ist vor Hunger und Kummer hingesunken! – Wie fühle ich jetzt erst recht empfindlich meine Armut und Ohnmacht! – Ach, könnt' ich doch nur helfen, wie ich wollte! – Doch das, was mir noch übrig blieb, die wenigen Gaben, die das feindselige Verhängnis mir nicht zu rauben, nicht zu zerstören vermochte, die mir noch zu Gebote stehen, die will ich kräftig und getreu nützen, um dem Leidwesen zu steuern. Geld, hätte ich auch darüber zu gebieten, würde dir gar nichts helfen, arme Frau, sondern deinen Zustand vielleicht noch gar verschlimmern. Dir und deinem Mann, euch beiden ist nun einmal Reichtum nicht beschert, und wem Reichtum nicht beschert ist, dem verschwinden die Goldstücke aus der Tasche, er weiß selbst nicht wie, er hat davon nichts als großen Verdruß und wird, je mehr Geld ihm zuströmt, nur desto ärmer. Aber ich weiß es, mehr als alle Armut, als alle Not, nagt an deinem Herzen, daß du jenes kleine Untierchen gebarst, das sich wie eine böse unheimliche Last an dich hängt, die du durch das Leben tragen mußt. – Groß – schön – stark – verständig, ja, das alles kann der Junge nun einmal nicht werden, aber es ist ihm vielleicht noch auf andere Weise zu helfen.« – Damit setzte sich das Fräulein nieder ins Gras und nahm den Kleinen auf den Schoß. Das böse Alräunchen sträubte und spreizte sich, knurrte und wollte das Fräulein in den Finger beißen, die sprach aber: »Ruhig, ruhig, kleiner Maikäfer!« und strich leise und linde mit der flachen Hand ihm über den Kopf von der Stirn herüber bis in den Nacken. Allmählich glättete sich während des Streichelns das struppige Haar des Kleinen aus, bis es gescheitelt, an der Stirne fest anliegend, in hübschen weichen Locken hinabwallte auf die hohen Schultern und den Kürbisrücken. Der Kleine war immer ruhiger geworden und endlich fest eingeschlafen. Da legte ihn das Fräulein Rosenschön behutsam dicht neben der Mutter hin ins Gras, besprengte diese mit einem geistigen Wasser aus dem Riechfläschchen, das sie aus der Tasche gezogen, und entfernte sich dann schnellen Schrittes.
Als die Frau bald darauf erwachte, fühlte sie sich auf wunderbare Weise erquickt und gestärkt. Es war ihr, als habe sie eine tüchtige Mahlzeit gehalten und einen guten Schluck Wein getrunken. »Ei,« rief sie aus, »wie ist mir doch in dem bißchen Schlaf so viel Trost, so viel Munterkeit gekommen! – Aber die Sonne ist schon bald herab hinter den Bergen, nun fort nach Hause!« – Damit wollte sie den Korb aufpacken, vermißte aber, als sie hineinsah, den Kleinen, der in demselben Augenblick sich aus dem Grase aufrichtete und weinerlich quäkte. Als nun die Mutter sich nach ihm umschaute, schlug sie vor Erstaunen die Hände zusammen und rief: »Zaches – Klein Zaches, wer hat dir denn unterdessen die Haare so schön gekämmt! – Zaches – Klein Zaches, wie hübsch würden dir die Locken kleiden, wenn du nicht solch ein abscheulich garstiger Junge wärst! – Nun, komm nur, komm! – hinein in den Korb!« Sie wollte ihn fassen und quer über das Holz legen, da strampelte aber Klein Zaches mit den Beinen, grinste die Mutter an und miaute sehr vernehmlich: »Ich mag nicht!« – »Zaches! – Klein Zaches!« schrie die Frau ganz außer sich, »wer hat dich denn unterdessen reden gelehrt? Nun! wenn du solch schön gekämmte Haare hast, wenn du so artig redest, so wirst du auch wohl laufen können.« Die Frau huckte den Korb auf den Rücken, Klein Zaches hing sich an ihre Schürze, und so ging es fort nach dem Dorfe.
Sie mußten bei dem Pfarrhause vorüber, da begab es sich, daß der Pfarrer mit seinem jüngsten Knaben, einem bildschönen goldlockigen Jungen von drei Jahren, in seiner Haustüre stand. Als der nun die Frau mit dem schweren Holzkorbe und mit Klein Zaches, der an ihrer Schürze baumelte, daherkommen sah, rief er ihr entgegen: »Guten Abend, Frau Liese, wie geht es Euch – Ihr habt ja eine gar zu schwere Bürde geladen, Ihr könnt ja kaum mehr fort, kommt her, ruht Euch ein wenig aus auf dieser Bank vor meiner Türe, meine Magd soll Euch einen frischen Trunk reichen!« – Frau Liese ließ sich das nicht zweimal sagen, sie setzte ihren Korb ab und wollte eben den Mund öffnen, um dem ehrwürdigen Herrn all ihren Jammer, ihre Not zu klagen, als Klein Zaches bei der raschen Wendung der Mutter das Gleichgewicht verlor und dem Pfarrer vor die Füße flog. Der bückte sich rasch nieder und hob den Kleinen auf, indem er sprach: »Ei, Frau Liese, Frau Liese, was habt Ihr da für einen bildschönen allerliebsten Knaben! Das ist ja ein wahrer Segen des Himmels, ein solch wunderbar schönes Kind zu besitzen.« Und damit nahm er den Kleinen in die Arme und liebkoste ihn und schien es gar nicht zu bemerken, daß der unartige Däumling gar häßlich knurrte und mauzte und den ehrwürdigen Herrn sogar in die Nase beißen wollte. Aber Frau Liese stand ganz verblüfft vor dem Geistlichen und schaute ihn an mit aufgerissenen starren Augen und wußte gar nicht, was sie denken sollte. »Ach, lieber Herr Pfarrer,« begann sie endlich mit weinerlicher Stimme, »ein Mann Gottes, wie Sie, treibt doch wohl nicht seinen Spott mit einem armen unglücklichen Weibe, das der Himmel, mag er selbst wissen warum, mit diesem abscheulichen Wechselbalge gestraft hat!« »Was spricht,« erwiderte der Geistliche sehr ernst, »was spricht Sie da für tolles Zeug, liebe Frau! von Spott – Wechselbalg – Strafe des Himmels – ich verstehe Sie gar nicht und weiß nur, daß Sie ganz verblendet sein muß, wenn Sie Ihren hübschen Knaben nicht recht herzlich liebt. – Küsse mich, artiger kleiner Mann!« – Der Pfarrer herzte den Kleinen, aber Zaches knurrte: »Ich mag nicht!« und schnappte aufs neue nach des Geistlichen Nase. – »Seht die arge Bestie!« rief Liese erschrocken; aber in dem Augenblick sprach der Knabe des Pfarrers: »Ach, lieber Vater, du bist so gut, du tust so schön mit den Kindern, die müssen wohl alle dich recht herzlich lieb haben!« »O hört doch nur,« rief der Pfarrer, indem ihm die Augen vor Freude glänzten, »o hört doch nur, Frau Liese, den hübschen verständigen Knaben, Euren lieben Zaches, dem Ihr so übelwollt. Ich merk' es schon, Ihr werdet Euch nimmermehr was aus dem Knaben machen, sei er auch noch so hübsch und verständig. Hört, Frau Liese, überlaßt mir Euer hoffnungsvolles Kind zur Pflege und Erziehung. Bei Eurer drückenden Armut ist Euch der Knabe nur eine Last, und mir macht es Freude, ihn zu erziehen wie meinen eignen Sohn!« –
Liese konnte vor Erstaunen gar nicht zu sich selbst kommen, ein Mal über das andere rief sie: »Aber, lieber Herr Pfarrer – lieber Herr Pfarrer, ist denn das wirklich Ihr Ernst, daß Sie die kleine Ungestalt zu sich nehmen und erziehen und mich von der Not befreien wollen, die ich mit dem Wechselbalg habe?« – Doch, je mehr die Frau die abscheuliche Häßlichkeit ihres Alräunchens dem Pfarrer vorhielt, desto eifriger behauptete dieser, daß sie in ihrer tollen Verblendung gar nicht verdiene, vom Himmel mit dem herrlichen Geschenk eines solchen Wunderknaben gesegnet zu sein, bis er zuletzt ganz zornig mit Klein Zaches auf dem Arm hineinlief in das Haus und die Türe von innen verriegelte.
Da stand nun Frau Liese wie versteinert vor des Pfarrers Haustüre und wußte gar nicht, was sie von dem allem denken sollte. »Was um aller Welt willen«, sprach sie zu sich selbst, »ist denn mit unserm würdigen Herrn Pfarrer geschehen, daß er in meinen Klein Zaches so ganz und gar vernarrt ist und den einfältigen Knirps für einen hübschen verständigen Knaben hält? – Nun! helfe Gott dem lieben Herrn, er hat mir die Last von den Schultern genommen und sie sich selbst aufgeladen, mag er nun zusehen, wie er sie trägt! – Hei! wie leicht geworden ist nun der Holzkorb, da Klein Zaches nicht mehr daraufsitzt und mit ihm die schwerste Sorge!« –
Damit schritt Frau Liese, den Holzkorb auf dem Rücken, lustig und guter Dinge fort ihres Weges! – –
Wollte ich auch zurzeit noch gänzlich darüber schweigen, du würdest, günstiger Leser, dennoch wohl ahnen, daß es mit dem Stiftsfräulein von Rosenschön, oder wie sie sich sonst nannte, Rosengrünschön, eine ganz besondere Bewandtnis haben müsse. Denn nichts anders war es wohl, als die geheimnisvolle Wirkung ihres Kopfstreichelns und Haarausglättens, daß Klein Zaches von dem gutmütigen Pfarrer für ein schönes und kluges Kind angesehen und gleich wie sein eignes aufgenommen wurde. Du könntest, lieber Leser, aber doch, trotz deines vortrefflichen Scharfsinns, in falsche Vermutungen geraten oder gar zum großen Nachteil der Geschichte viele Blätter überschlagen, um nur gleich mehr von dem mystischen Stiftsfräulein zu erfahren; besser ist es daher wohl, ich erzähle dir gleich alles, was ich selbst von der würdigen Dame weiß.