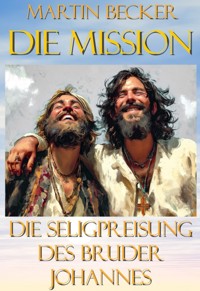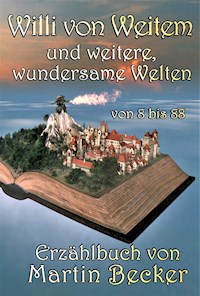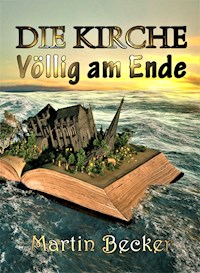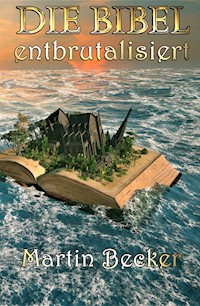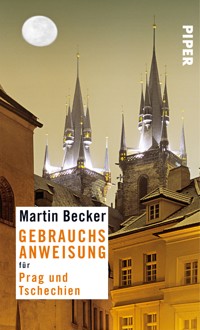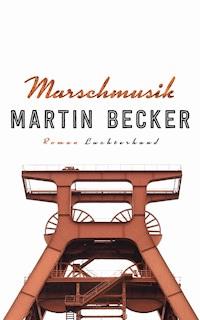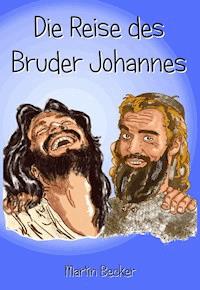11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Er frisst, statt zu essen, er säuft, statt zu trinken, er quarzt, statt zu rauchen, und er ackert, statt zu arbeiten. Pinscher wiegt hundertdreißig Kilo bei einer Körpergröße von einssiebzig, wobei das um fünf Zentimeter geschummelt ist. Sein Aussehen gibt nur zum Teil seine Maßlosigkeit preis. Und doch, seine Kleidung ist ordentlich, ein wenig aus der Mode, er ist nie ganz von hier weggekommen. Hier, das ist Mündendorf, hartes Arbeitermilieu. Jetzt, das ist der Sommer seiner Zwangsversetzung zurück in die Polizeiwache, die er nicht erträgt. Und es ist der Abschied von seiner geliebten Mutter. Er muss nun etwas tun, was er all die Jahre vermieden hat: sich der Erinnerung stellen, vor der polierten Schrankwand im engen Reihenhaus sitzen, den kalten Zigarettenrauch im alten Wohnzimmer riechen und den Menschen auf den alten Fotos wirklich ins Gesicht sehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
Er frisst, statt zu essen, er säuft, statt zu trinken, er quarzt, statt zu rauchen, und er ackert, statt zu arbeiten. Kommissar Pinscher wiegt hundertdreißig Kilo bei einer Körpergröße von eins siebzig, wobei das um fünf Zentimeter geschummelt ist. Sein Aussehen gibt nur zum Teil seine Maßlosigkeit preis. Und doch, seine Kleidung ist ordentlich, ein wenig aus der Mode, er ist nie ganz von hier weggekommen. Hier, das ist Mündendorf, hartes Arbeitermilieu. Jetzt, das ist der Sommer seiner Zwangsversetzung zurück in die Polizeiwache, die er nicht erträgt. Und es ist der Abschied von seiner geliebten Mutter. Er muss hier etwas tun, was er all die Jahre vermieden hat: sich der Erinnerung stellen, vor der polierten Schrankwand im engen Reihenhaus sitzen, den kalten Zigarettenrauch im alten Wohnzimmer riechen und den Menschen auf den alten Fotos wirklich ins Gesicht sehen.
»Kleinstadtfarben« erzählt vom großen Schmerz des Abschieds, vom kleinen Glück der proletarischen Herkunft – und von der Sehnsucht, einfach endlich anzukommen.
Über den Autor
Martin Becker wurde 1982 geboren und ist in der sauerländischen Kleinstadt Plettenberg in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen. Seit vielen Jahren schreibt er Hörspiele und ist für Radiofeatures in vielen Ländern unterwegs, außerdem ist er als Kolumnist, Reporter und Literaturkritiker unter anderem im Deutschlandfunk und im Westdeutschen Rundfunk zu hören und moderiert verschiedene Podcastformate. 2007 erschien sein mehrfach ausgezeichneter Erzählband »Ein schönes Leben«, 2014 sein Roman »Der Rest der Nacht«, 2017 sein Roman »Marschmusik« und 2019 sein Essayband »Warten auf Kafka«, eine Hommage an die tschechische Literatur. Martin Becker lebt mit seiner Familie in Köln und Halle/Saale.
Martin Becker
Kleinstadtfarben
Roman
Luchterhand
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2021 Luchterhand Literaturverlag, München
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: buxdesign, München
Coverillustration: Ruth Botzenhardt
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-25717-0V001
www.luchterhand-literaturverlag.de
www.facebook.com/luchterhandverlag
Für Kathrin und Rudi
I LEUGNEN
1 Mündendorf
Ein Kleinstadtkrankenhaus, ein lichterfüllter Morgen, keine einzige Wolke am Himmel. Trotzdem kalt für einen Jahrhundertsommer, denkwürdig kalt. So kommt es ihm vor. Der Mann, etwa um die vierzig, sieht aus wie ein kleiner, sehr dicker Junge, wiegt hundertdreißig Kilogramm bei einer Körpergröße von eins siebzig, wobei das um fünf Zentimeter geschummelt ist. Er achtet auf sich, seine Kleidung ist ordentlich, ein wenig ungebügelt, ein wenig aus der Mode, Kleinstadtfarben, er ist nie ganz von hier weggekommen. Er hält sich in seiner zerschlissenen Lederjacke an der Brüstung fest und zieht mit zittrigen Fingern an seiner Zigarette, er ist ein massiges, gekrümmtes Häufchen Elend. Zuerst ist er hier hoch, um Zeit zu gewinnen, hat sich einen doppelten Espresso bestellt und ist raus in den Außenbereich der Cafeteria.
Von der funktionalen Dachterrasse aus schaut man in alle Richtungen auf die Mittelgebirgslandschaft. Eine historisch interessierte Gruppe von Bewohnern des angegliederten Seniorenheims hat vor Jahren mit zittriger Hand Schilder gestaltet, auf denen das Panorama erklärt wird. Da oben die Burgruine, von wo aus die Grafen einst den ganzen Landstrich beherrschten. Da unten die kurz nach dem Bauernkrieg durch einen verheerenden Brand vernichtete Stadt. In der Mitte ein verwaister und asbestverseuchter Betonblock, das ehemalige Einkaufszentrum. Dort vorn der Kindergarten, wo sie ihm alte Märchen beigebracht haben. Direkt daneben der Friedhof für die Protestanten. Und darüber, etwas kleiner, der für die Katholiken. Wer nichts ist, kommt auf die grüne Wiese, erzählte man sich früher.
Es hat verdammt noch mal alles nichts gebracht. Denkt er und verbrennt sich die Finger. Er wirft den kokelnden Filter weg und steckt sich aus Reflex den schmerzenden Zeigefinger in den Mund. Eine Brandblase, möglicherweise bleibt eine Narbe, Feuer kann er nicht mit Feuer bekämpfen, wann lernt er das endlich.
Sein Name ist Peter Pinscher, seine Mama (und nur die) darf ihn Peterle nennen, das denkt er so, weil noch kein Platz ist für Vergangenheitsformen. Eine raucht er noch. Er sollte jetzt das Treppenhaus nehmen, nach unten ins Foyer gehen und sich anmelden, er hat seinen Termin, danach ist es zu spät. Das Abschiedszimmer ist die Perle der Geriatrie, ständig überbucht, mit warmen Farben gestrichen und ausgestattet mit Extras wie dem beleuchteten Salzkristall. Nur die eine Zigarettenlänge noch, besser eine halbe, denn er hat es sich neuerdings angewöhnt, jeweils das Ende der Zigarette abzureißen, so raucht er schon mal um die Hälfte weniger, so wird er bald damit aufhören, denkt er.
Pinschers Fingernägel sind abgekaut, nein, in Wahrheit einfach nur so kurz geschnitten wie möglich. Vor dem, was sich unter längeren Nägeln ansammeln könnte, gruselt er sich. Der Arbeit wegen. Er trägt sein volles Haar nach links gescheitelt, er fährt sich den ganzen Tag mit der rechten Hand durch die Frisur, bis sie trotz Duschens schon Stunden später wieder fettig ist. Ein Tick von vielen, die er sich nie mehr abgewöhnen wird. Sein leicht nach vorn gebeugter Gang ist ein Symptom seiner ständigen Lauerstellung. Du bist immer im Krieg, aber hier ist es doch friedlich, wann lernst du das endlich. Sein Aussehen gibt nur zum Teil seine Maßlosigkeit preis. Er frisst, statt zu essen, er säuft, statt zu trinken, er quarzt, statt zu rauchen. Wenn er verliebt ist, dann im Wahn, wenn er sich was wünscht, dann unbedingt. Er arbeitet nicht, er ackert, er ist nicht traurig, er krepiert vor Kummer.
Pinscher steht auf der Dachterrasse des Kleinstadtkrankenhauses und sucht in den Bäumen: Irgendwo müssen sie sein. Als er siebzehn Jahre alt ist, da fliegt an einem Sonntagabend sein allererster Wellensittich zur Haustür hinaus, genau drei Tage vor Weihnachten. Unklar, wie er sich aus dem Käfig befreit oder ob jemand fahrlässig das Törchen offen lässt, unwahrscheinlich, dass das Tier die darauffolgende Frostnacht übersteht. Trotzdem hält Pinscher seit damals Ausschau in den Bäumen. Seit über zwei Jahrzehnten denkt er über die rein theoretische Möglichkeit nach, dass sein Wellensittich namens Bubi Pinscher überlebt haben, dem Tod ein Schnippchen geschlagen und neu angefangen haben könnte in der Wildnis der Kleinstadt. Den Schrecken abschütteln. Ein Nest bauen. Eine Familie gründen. Ganz groß werden. Bubi und seine unüberschaubare Wellensittichsippe. Mit ein paar Gramm verschwundener Federn geht damals alles los. Beginnt die Erosion. Löst sich die Familie auf, schleichend, über die Jahre. Zuerst gerät vor über zwanzig Jahren die Mama wortwörtlich ins Rutschen, plötzlich liegt sie mit Blutungen im Gehirn in der Einfamilienreihenhausküche, genau einen Tag nach dem Verschwinden des Wellensittichs. Zustand nach Aneurysmaruptur, Arteria communicans anterior, erblich und adipositasbedingt, die Operation rettet ihr das Leben und hinterlässt eine wie zu früh an Alzheimer laborierende, ratlose Mama. Danach geschieht alles, wie man es in einer Arbeiterfamilie mit der handelsüblichen Neigung zu Alkoholgenuss und Nikotinabusus erwarten darf: Eines Tages werden zum Trost zwei neue Wellensittiche und ein Terrier angeschafft, die alsbald aus unbekanntem Grund tot im Käfig liegen (die Vögel) oder wegen Unerziehbarkeit ins Tierheim zurückgebracht werden (der Hund), eines Tages hält Pinscher jemand ein Messer an die Kehle und stiehlt ihm zwanzig Euro und ein altes Handy (Beschuldigter unbekannt), eines Tages darf seine Mama sich ein Meerschweinchen aussuchen, das bei der ersten Gelegenheit an einem regnerischen Herbsttag über die Terrasse des Reihenhauses in den Garten flieht, eines Tages kriegt sein Papa beim Rasieren vor dem Badezimmerspiegel einfach keine Luft mehr, sie suchen nach Gründen, sie finden Krebs, sie behandeln, was nicht mehr zu behandeln ist, zwei Wochen später ist er nicht mehr da, was hast du erwartet, ewige Jugend, Starkraucher, Pegeltrinker, hartes Arbeitermilieu, eines Tages verkauft Pinscher das Haus seiner Kindheit samt den ganzen Möbeln und Schränken und Fotoalben und Pflegebetten, damit es endlich raus aus dem Kopf ist, er besorgt ein Zimmer im Altersheim für seine Mama, und eines Tages, das wusste er, wird er hier auf der Dachterrasse des in unheilvollem Mimosengelb gestrichenen Kleinstadtkrankenhausbaus stehen und nichts fühlen außer Hunger, schon wieder.
Du kannst nicht kraft deiner Gedanken deine gesammelte Trauer in den Eisbecher vor dir projizieren. Nein, auch nicht in den Cheeseburger, in die salzigen Pommes oder in die frittierte Ente vom Thai-Imbiss, du kannst sie nicht hinunterschlingen wie ein Sparmenü von McDonald’s, das kannst du nicht lernen. Du hast gelernt, andere zum Trauern zu bringen, du hast gelernt, ihnen das abzunehmen, nur für dich selbst siehst du schwarz. Probier es ruhig mit der Allmacht des Sättigungsgefühls, verbieten können wir es dir nicht.
Pinscher atmet ein letztes Mal durch, jetzt wirft er die Kippe weg, diesmal rechtzeitig, jetzt stemmt er seinen massigen und unsportlichen Körper vom Geländer ab und gerät ins Straucheln, er schiebt sich sein Hemd in die Hose, richtet die Lederjacke, fährt sich durchs Haar, steckt sich den verbrannten Zeigefinger erneut in den Mund, als würde das Kühlung bringen.
Der Sommer wird endgültig geschluckt, als er die Treppe nimmt und das Foyer betritt. Er meldet sich an der Pforte wie vorgeschrieben an und starrt betreten auf den Boden. Die sachliche Innenbeleuchtung der Krankenhäuser. Die Einsamkeit der Stuhlreihen mit den vom Sorgenschweiß angegriffenen Kunstlederarmlehnen. Pinscher wünscht sich die passende Musik aus den Kliniklautsprechern, sagen wir, das Vorspiel zu »Tristan und Isolde«, warum nicht Wagner, warum nicht dieser vernichtende Akkord, und da ist sie auch schon im Ohr: Er schreitet jetzt förmlich mitten hinein in die Katastrophe, geht durch das Foyer des Krankenhauses, der beißende Geruch von Desinfektionsmittel rückt ihm auf die Pelle, er greift schon wieder nach einer Zigarette, zieht sie in der Jacke aus der Schachtel, aber dann zerdrückt, zerreibt er sie mit dem gewaltigen Forte der Musik in seinem Ohr in der Jackentasche. Vor den Aufzügen bleibt er abrupt stehen. Musik aus. Der neue Getränke- und Snackautomat. Sie haben ihn letzte Woche erst aufgestellt. Eine Attraktion, über die sogar die Lokalzeitung groß berichtet hat. Mit warmen und kalten Gerichten 24/7. Mit einer Produktpalette, wie sie nur an großen internationalen Bahnhöfen wie in Antwerpen zu finden ist. Ein traumhaftes Alleinstellungsmerkmal für ein Krankenhaus dieser Größe.
Pinscher fingert nach Kleingeld, das Frühstück ist noch gar nicht lange her, aber der Weg hier hoch war ermüdend und überhaupt, tröste dich, wo du nur kannst, immerhin das hast du gelernt. Er wirft ein Zwei-Euro-Stück in den Schlitz und wählt einen erwärmten Brownie mit flüssigem Schokokern aus. Nichts passiert. Pinscher drückt erneut, keine Reaktion des Geräts. Er presst den Knopf fester, der Kuchen samt flüssigem Schokokern bleibt drin, Pinscher hingegen lässt alles raus, er explodiert ohne Vorankündigung, er flucht und hämmert auf den Automaten ein, der Schweiß steht ihm auf der Stirn, die fußfaule Empfangsdame macht einen langen Hals und aus dem Wartezimmer der Notfallambulanz haben ein verstauchter Knöchel und eine vermeintliche Lungenentzündung nichts Besseres zu tun, als um die Ecke zu glotzen. Zeigt mich doch an, sagt Pinscher ganz ruhig und sieht den alarmierten Patienten ins Gesicht, zeigt mich doch ganz einfach an.
2 Leichenbuden
Einige Wochen früher sind die Mündendorfer Mütter noch weit weg. Alles hat seinen Rhythmus. Einmal im Monat besucht Pinscher seine Mama im Altersheim. Er begrüßt sie mit einem Lächeln, verfrachtet sie mit geschulten Bewegungen in den Rollstuhl und spaziert mit ihr fröhlich in die Stadt. Irgendwas finden sie immer, eine heiße Bockwurst auf dem Wochenmarkt, eine reduzierte Bluse im Modehaus, einen großen Amarenabecher in der Eisdiele. Sie rauchen und lachen zusammen. Das ist das wahre, das richtige, das schöne Leben. Und der Rest ist das Gegenteil. Der Rest davon ist, nun ja, sein Job.
Endlich wirkt die Katadolon. Das macht dich langsam kaputt, nichts bleibt ohne Konsequenzen, aber wir können nicht zu weit in die Zukunft schauen, nicht bei dieser Arbeit: Seit Monaten hat Pinscher wieder Ischias, irgendwas geht seinen Gang, er hat keine Ahnung, was es diesmal ist. Kalter Schweiß auf der Stirn bei jedem Zucken im Rücken. Wie Stromschläge. Noch mehr Katadolon, du musst Feuer mit noch mehr Feuer bekämpfen.
Ohne Schmerzmittel wäre er gerade chancenlos. Einen Körper drehen, ihn betrachten, nachschauen, ob da nichts im Rücken steckt. Pinscher steckt sich eine Zigarette an, er schert sich nicht darum, dass das auch in den Zivilfahrzeugen verboten ist. Dann zeigt mich doch an, denkt er. Er biegt in die Straße des Toten ein. Der Hauseingang ist abgesperrt. Krankenwagen, Notarztwagen, Einsatzdienst mit zwei Fahrzeugen, drumherum die übliche fiebrige Kirmesatmosphäre. Eine Traube aus Kindern, Nachbarn und alten Leuten. Pinscher löscht seine Zigarette zwischen zwei angefeuchteten Fingerspitzen und wirft sie unauffällig aus dem Fenster. Er beißt die Zähne zusammen und schleppt sich aus dem Wagen, hundertdreißig Kilo Ischiasqual. Als er eine junge Frau unter den Schaulustigen entdeckt, öffnet er seine zerschlissene Lederjacke, damit seine Waffe gut zu sehen ist, geht gemessenen Schrittes an den Wartenden vorbei und nickt der Frau beschwichtigend zu. Sie lächelt, und für eine Sekunde ist der ganze Schmerz der Welt vergessen.
Der Notarzt steht in den Büschen vor dem Hauseingang und übergibt sich. Sehr eklig, fragt Pinscher. Geht, sagt der Notarzt. Weit oben? Vierter Stock. Aufzug? Natürlich nicht. Pinscher verdreht die Augen und quält sich die Treppe hoch. Er braucht ewig. Er ist kurzatmig. Diagnostizierte leichte Rechtsherzschwäche, schlechte Ernährung und Zigaretten. Wie gesagt, denken wir nicht darüber nach. Eine Sache hasst er an seinem Beruf von ganzem Herzen: Stufen. Atemlos kommt er oben an. Die Kollegen vom Einsatzdienst sitzen auf der Treppe vor der Wohnung. Ihr ist schlecht, sagt einer der Uniformierten. Pinscher sieht die Kollegin an, sie verträgt das alles nicht gut, fast noch ein Mädchen, gerade von der Polizeischule. Kopf hoch, sagt Pinscher, geht vorbei wie Regen. Als keine Reaktion kommt, zuckt er mit den Schultern und betrachtet das mit zittriger Hand beschriftete Klingelschild.
Todesursachenermittlung. Als Pinscher die verwahrloste Wohnung sieht, kommt es ihm vor wie eine Lebensursachenermittlung. Außerdem hat er Appetit, Ischias und Schmacht nach einer Zigarette. Die nächste Stunde wird sich in die Länge ziehen. Bei den Nachbarn klingeln, wann wurde der Herr zuletzt lebend gesehen, gab es ungewöhnliche Besuche, Fotos machen, Hinweise auf Angehörige finden, die Identität des Leichnams ermitteln. Nach der ganzen Zeit kann niemand mehr wissen, ob der mumifizierte Körper wirklich mal den Namen Hunger getragen hat. Viel kommt nie dabei heraus, keine Einbruchsspuren, Wohnungstür von innen abgeschlossen, kein Fremdverschulden.
Keine Panik, sagt er sich, zieht seine blauen Einweghandschuhe an, von denen er immer ein Paar bei sich trägt, nur keine Panik. Pinscher betritt den Wohnungsflur, kurz kommt ihm alles hoch, er schluckt, dann hat er sich an das Raumklima gewöhnt. Es riecht immer schlimmer als erwartet, aber vermutlich war das zu Lebzeiten des Bewohners kaum besser.
Zuerst wundert sich Pinscher noch über das ungewohnt filigrane Muster auf dem Boden, ein aufwendig gewebter Teppich jenseits billiger Auslegware, doch auf den zweiten Blick erkennt er, auf was er da läuft: Fliegen. Abermillionen tote Schmeißfliegen. Eine ganze verästelte Familie. Er ist schon durch viele leblose Insekten gewatet, aber das hier ist der Höhepunkt. Generation um Generation, von den Ururgroßeltern bis zu den Enkeln, ein ganzes Schmeißfliegenkönigreich ist hier erblüht und untergegangen, als es keine Nahrung mehr gab. Ein einziges Exemplar wird den Weg durch eine Fensterdichtung gefunden, seine Eier abgelegt und fürstlich am Leichnam geschmaust haben. Auch den Kindern und Kindeskindern ging es noch gut, aber irgendwann warf der Tote nichts mehr ab. Kurz wird Pinscher traurig über das allgegenwärtige Elend in dieser Wohnung, das bis zu den Insekten auf dem Boden reicht, aber dann reißt er sich zusammen, das hier ist ein Profigeschäft, und er hat zu tun.
Der Verstorbene, längst mumifiziert, liegt auf dem Rücken quer übers Bett, die Hände seitlich am Körper, was heißt Hände, die Reste davon, Fleisch ist kaum noch vorhanden. Pinscher sieht sich den Leichnam an, der Körper ist in den vergangenen Monaten eins geworden mit dem Bettzeug. Das Kissen mit Blüten bedruckt, stilisierte Schmetterlinge auf dem Bettbezug. Seine Eltern hatten genau diese Garnitur besessen. Späte Achtziger, Versandhauskatalogware. Keine Panik, sagt sich Pinscher wieder, keine Panik.
Die Hausverwaltung hatte lange nicht reagiert, obwohl das Wohnzimmer Tag und Nacht beleuchtet war wie ein Ballsaal, obwohl man schon früher auf die Idee hätte kommen können, die Wohnung aufzumachen, beispielsweise vor Pinschers akutem Ischias.
Seinen Kollegen hat er mit voller Absicht auf dem Revier gelassen, obwohl das Alleinfahren genauso verboten ist wie das Rauchen, er darf sich jetzt nicht beschweren, alles selbst erledigen zu müssen. Pinscher macht Fotos von der Wohnungstür, vom Flur, von der Küche, vom Wohnzimmer, vom Schlafzimmer. Alles Wesentliche befindet sich auf dem kleinen Tisch in der Wohnstube. Tabak samt oranger Stopfmaschine aus Plastik, wie sie auch sein Papa gehabt hatte, etliche schmutzige Kaffeetassen, eine angebrochene Packung Toastbrot, Scheibenkäse, vergammelte Dauerwurst, eine leere Colaflasche, eine Fernbedienung, ein Korkenzieher, ein Wasserkocher, ein geöffnetes Glas Instant-Kaffee nebst Kaffeeweißer, Hustenlöser in Brausetablettenform, einige Pillen gegen Kopfweh, unter dem Wohnzimmertisch dann drei leere Schnapsflaschen. Die Decke auf dem durchgesessenen Sofa liegt so da, als wäre gerade erst jemand aufgestanden, als hätte sich kurz zuvor ein Körper aus der Umwicklung gelöst. Ein Klassiker, denkt Pinscher, dir wird schlecht, Herr Hunger, du merkst das Ziehen, und du nimmst es erst ernst, als es schon ein Reißen ist, aufs Klo oder ins Bett, du entscheidest dich fürs Schlafen, du denkst, leg dich kurz hin, dann ist alles wieder gut, du schaffst es sogar noch zum Bett, aber gut wird es nicht mehr.
Dein Fernseher steht auf einer vergilbten Geräteverpackung, die als Podest dient, davor liegt die Fernsehzeitung, aufgeschlagen ist der 18. Januar. Drei Monate her. Das passt gut zu deinem Zustand. Auf dem Boden neben dem Fernseher findet er einen Umschlag: eine Karte mit Blumenstraußrelief. Frohe Weihnachten, nahezu unleserliche Schrift, deine Elfriede. Abgestempelt Ende Dezember. Die Adresse auf der Rückseite ist ein Volltreffer, stellt sich heraus, das ist deine Schwester. Ich fahr gleich vorbei, sagt Pinscher am Telefon. Bevor Nachfragen kommen nach seinem Kollegen und warum er wieder allein unterwegs ist, legt er auf. Mittlerweile ist der Bestatter da und unterhält sich mit seinem Sargträger über das Mittagessen: Eine neu eröffnete Filiale der Asia-Pfanne ganz in der Nähe, Ente mit Mangosoße, Riesenportionen, unschlagbarer Einführungspreis. Pinscher denkt kurz über einen Abstecher nach, aber er hat jetzt zu tun.
Danke, kann weg, sagt er, immer musst du so abgeklärt tun, das hast du gut gelernt, du Profi, macht eine Kopfbewegung in Richtung des Toten und will endlich hier raus. Bis bald, haut rein. Pinscher zieht sich die Handschuhe aus und wirft sie achtlos in die Ecke. Nichts hier wird, nichts hier darf übrig bleiben.
3 Die Letzten ihrer Art
Manchmal musst du Feuer mit Feuer bekämpfen. Den Schrecken hundertfach durchspielen, bis er dich nicht mehr zu Tode erschreckt. Du musst dich dem stellen, wieder und wieder. Du brauchst dafür die Letzten ihrer Art. Die Übriggebliebenen. In all ihrer tauben Einsamkeit, in all ihrer stummen Verzweiflung. An denen musst du dich abarbeiten. Denn wenn du abends nach Hause kommst, dann fällt eine Last von dir ab, dann wird deine Schwere im Verhältnis zu dem, was du gesehen hast, so leicht wie eine Wellensittichfeder. Jetzt gerade brauchst du dafür Elfriede Hunger. Sie ist unverheiratet, achtundsiebzig Jahre alt. Wohnhaft in einem Hochhausbezirk auf der anderen Seite vom Rhein, ihr einziger Bruder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Januar verstorben, und das wird Pinscher ihr nun sachte beibringen. Er hat eine Vorahnung, was die Etage angeht, aber daran will er jetzt noch nicht denken. Mach wieder Sport, sonst sitzt du bald nur noch zwischen den Akten. Er isst einen Schokoriegel, öffnet das Autofenster, stellt das Funkgerät leiser und das Radio lauter. Die Rückert-Lieder. Ich bin der Welt abhanden gekommen. Unbeholfen klopft er den Rhythmus der Musik aus dem Radio auf dem Lenkrad mit. Mit der ich sonst viele Zeit verdorben. Erst jetzt fällt ihm auf, dass er sich gar nicht die Hände gewaschen hat. Sein Rücken macht ihn kaputt. Diese verdammten Schmerzen hinten und anderswo. Er lenkt sich ab, trinkt einen großen Schluck aus der Colaflasche, wirft sie auf den Beifahrersitz, nimmt die Zigarette in die eine Hand und sein Handy in die andere und ruft seine Mama im Altersheim an. Das macht er immer nach einer Leiche. Er verschweigt ihr stets, dass er wieder von einem Toten kommt. Aber was gäbe es da auch zu erzählen? Die Dinge wiederholen sich. Menschen sterben, Menschen liegen wochenlang herum, Menschen werden gefunden, untersucht und weggeschafft. Kein einziges Mal hat Pinscher bei seiner Arbeit einen Mord aufgeklärt. Seine Todesursachenermittlungen sind das täglich Brot der Kripo. Bei Verbrechenstatbeständen übernimmt gleich das Fachkommissariat, Pinscher ist nur für den auf andere Weise tristen Alltag zuständig. Und jahrelang hat er bei seinen Toten nie an seine Mama denken müssen. Mittlerweile schnürt es ihm die Kehle zu, macht es ihn manchmal so nervös, dass er unter dem Vorwand der Übelkeit Leichenbuden vorzeitig verlassen hat.Jedenfalls beruhigt er sich erst, wenn er sie anruft. Hallo, Mama. Ich wollte nur mal hören. Hast du gut geschlafen? Was gab es zum Mittag? Machst du heute noch was Schönes? Habt ihr nicht die Kegelrunde im Gemeinschaftsraum? Ich rufe dich später in Ruhe an, du weißt schon, die Arbeit.
Seine Schicht hatte heute schon mit einem anderen Toten begonnen. Manchmal gibt es eine Woche lang gar keine Leiche, manchmal zwei am Tag oder sogar drei. Und die sind sein Spezialgebiet. Heute ist, je nach Perspektive, also ein guter oder ein schlechter Tag. Nach dem Aufstehen war der ältere Ehemann nicht mehr aus dem Bad zurückgekommen, nach einer halben Stunde hatte seine Frau nachgesehen und ihn gefunden. Ösophagusvarizenblutung, geplatzte Krampfadern in der Speiseröhre, das Badezimmer sah aus wie ein Schlachtraum. Eindeutige Todesursache.Das hätte der Notarzt auch allein geschafft, sicherheitshalber wurde der Kriminaldauerdienst geholt, sicherheitshalber hatte Pinscher sich länger als nötig um die Frau gekümmert, ihr ohne dienstliche Notwendigkeit Gesellschaft geleistet. Spinat und Spiegelei hatte sie gemacht, das war eigentlich zum Mittagessen vorgesehen gewesen, reine Übersprungshandlung, während sie auf den Krankenwagen wartete. Pinscher nahm das Angebot der Frau an, mit ihr zu essen. Erlaubt ist alles, was den Preis einer Tasse Kaffee nicht übersteigt. Sei nicht so streng zu ihr, sei nicht zu streng zu dir, es tut euch beiden gut.
Nun wird er traurig, als er an seine Mama denkt und wie sie im Altersheim sitzt und ebenso selig wie Pinscher und die Witwe Spinat mit Spiegelei isst. Ich leb’ allein in meinem Himmel, in meinem Lieben, in meinem Lied.
Bevor es schlimmer wird, ist das Lied vorbei, muss er scharf bremsen: Ein Rollstuhlfahrer auf der Straße. Er macht den Hitlergruß vor Pinschers Fahrzeug. Sind Sie wahnsinnig, ruft Pinscher und steigt aus. Hast mich fast totgefahren, Dickerchen, ruft der Mann im Rollstuhl, ockerfarbener und fleckiger Anorak, alt und ungepflegt und ohne Beine. Runter von der Straße, sagt Pinscher, beim nächsten Mal passen Sie auf. Keine Reaktion. Pinscher macht einen Schritt auf den Mann zu. Geht’s bei Ihnen? Geht’s bei dir, Fettsack, keift der Mann zurück. Schon auf die Distanz riecht Pinscher den billigen Fusel, hört nun einen verwaschenen Exkurs zur Waffen-SS, einen Sermon über die gute alte Zeit. Pinscher tut, was er wirklich selten tut. Kriminalpolizei, Ausweis her und runter von der Straße, habe ich gesagt. Letzte Aufforderung, sonst schiebe ich Sie weg. Gar nichts zeig ich dir, ruft der Mann, du bist ja gar kein richtiger Bulle. Leck mich doch, sagt Pinscher, verfrachtet den Mann samt Rollstuhl mit einer ruppigen Bewegung auf den Bürgersteig zurück, der Kerl schlägt um sich und schreit, ein Wunder, dass er nicht aus seinem wackeligen Gefährt stürzt. Früher kannten die Deutschen noch Recht und Ordnung, lallt der Rollstuhlfahrer. Ja, sagt Pinscher, früher hatten die Deutschen auch noch Beine. Mit diesen Worten dreht er dem Rollstuhlfahrer die Ventile aus den Reifen, kümmert sich nicht mehr um sein Gezeter und setzt sich wieder in seinen Wagen.
Über dem Rhein scheint die Sonne und wärmt sein Gesicht. Er hält an, steigt aus, geht ans Ufer und raucht kurz eine Zigarette. Er entdeckt ein langsam vor sich hin schipperndes Containerschiff. Er hört das Rufen der Halsbandsittiche und entdeckt sie in den Bäumen. Die haben es doch auch geschafft. Als Paar aus der Gefangenschaft geflohen, haben sie sich das wilde Leben zu eigen gemacht und beherrschen mit ihrem Geschrei die Stadt. Pinscher liebt sie sehr, wenn sie in großen Schwärmen in den Bäumen landen. Es ist also theoretisch wirklich möglich. Ein Tankschiff fährt vorbei, die Dies Irae, ein Schiffsbesitzer ohne Hoffnung oder mit Humor. Manchmal kommt es ihm so vor, als sei die ganze Welt auf einem Grund aus purer Schäbigkeit errichtet worden, nur behaust von Verrückten und Verlorenen. Wie wilde Tiere in einem viel zu engen Käfig, die ständig aufeinander einhacken. Manchmal kommt es ihm so vor, als sei das früher anders gewesen. Als sei der Mensch nicht von Natur aus mies bis auf die Knochen. Manchmal kommt es ihm so vor, als müsse er kapitulieren, in ein unspektakuläres Sachgebiet wechseln, den Schichtdienst verlassen und nur noch Fahrradklau und Ladendiebstahl machen. Seine Bewerbung beim Polizeiorchester liegt in der Schublade, er müsste sie nur abschicken. Andererseits: Er mag seine Arbeit doch. Und nicht die Stadt an sich besteht aus lauter Irrsinn, das ist nur sein eigener Kosmos, den er nach Schichtende verlassen kann, zumindest für eine gewisse Zeit. Feuer gegen Feuer.
Er fährt vor dem Haus halb auf den Gehsteig und platziert die Polizeikelle sichtbar auf der Ablage. Das ist es, was er an der Arbeit liebt: überall Parkplätze. Schnell findet er den Namen auf dem Klingelbrett, es dauert. Siebter Stock, bitte, hört er die alte Dame durch die Gegensprechanlage sagen, sie fragt gar nicht nach, schon geht der Türsummer. Pinscher nimmt den Fahrstuhl, und als er in dem ruckelnden Aufzug von Etage zu Etage getragen wird, bricht ihm schon wieder der Schweiß aus. Platzangst, heftige Panik, präfrontaler Kortex und Amygdala rennen mal wieder um ihr Leben. Immerhin der Schmerz um sein Steißbein herum lenkt ihn ab, der mittlerweile in immer kürzeren Abständen stoßweise kommt. Alle paar Sekunden in die Steckdose fassen.
Guten Tag, Frau Hunger, Kriminalpolizei, darf ich reinkommen? Das würde ich lieber drinnen mit Ihnen besprechen. Ich habe da eine unerfreuliche Nachricht.
Die Wohnung ist klein und aufgeräumt, sauber und bescheiden. Es riecht nach Putzmittel vom Discounter, Meeresbrise im Frühling, an den Wänden Fotos in Plastikrahmen, alles alte Bilder, vom Karnevalsumzug, von den Eltern in Sonntagskleidung. Die Möblierung macht einen funktionalen und kargen Eindruck. So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Auch hier wohnt die Tristesse, nur auf viel aufgeräumtere Art als im zerwühlten Nest des Bruders von Frau Hunger. Pinscher wirft einen geschulten Blick auf die näheren Lebensumstände der Frau. Auf dem Weg ins Wohnzimmer entdeckt er an der Pinnwand Medikamentenpläne vom Pflegedienst nebst Checklisten, wann wird gebadet, wann gewaschen, wann werden die Nägel geschnitten, außerdem leere Schachteln von Fertigessen. Im Gegensatz zur selbst gewählten Anarchie des Bruders gibt es hier ein streng choreografiertes Ballett aus Pflegedienstleistungen, Essen auf Rädern und Hausarztbesuchen. Wie selbstverständlich bittet die alte Dame Pinscher aufs Sofa und verschwindet gleich wieder in der Küche.
Nicht mal fünf Minuten nach Beginn seines Besuchs hat Pinscher die Todesnachricht überbracht und sitzt vor einem starken Kaffee und einem Stück Schwarzwälder Kirschtorte, halb gefroren. Er hat wieder nicht abgelehnt, nicht hier, nicht jetzt: Zu sehr erinnert ihn die Frau an seine eigene Mama. Tun das neuerdings alle alten Damen? Hättest du dich nicht einfach krank melden sollen? Klein, gebeugt, langsam, mit freundlichen großen Augen und einer resoluten Stimme. Ihre Reaktion auf die Todesnachricht fällt sachlich aus. Was ist jetzt zu tun, das kommt doch recht überraschend, eine kurze Erinnerung an die gemeinsame Kindheit und Jugend mit dem jüngeren Bruder, später Jahre der Funkstille, diese Sauferei, ein Wort gibt das andere, irgendwann doch wieder Karten und Anrufe, nicht oft, einmal im Jahr ein Besuch, nie zu Weihnachten, da ist es zu oft eskaliert, da macht jeder lieber seins. Während sie erzählt, rollen der Frau einzelne Tränen über die Wangen, sonst sitzt sie fast ungerührt da, als würde sie das alles nichts angehen. Haben Sie Freunde, die heute zu Ihnen kommen können? Soll ich Ihnen jemanden schicken? Möchten Sie vielleicht diese Broschüre für den akuten Notfall? Frau Hunger lehnt alles ab. Pinscher kennt das ganze Spektrum an Reaktionen. Zusammenbrüche, unberechenbare Handlungen, Gleichgültigkeit, Sorge um die Bestattungskosten, Bejammern der eigenen Lage. Er weiß nicht mehr, wie häufig er diese Mitteilung schon überbracht hat, spontan kommt er auf eine Zahl im mittleren dreistelligen Bereich. Darin ist er schon Profi.
Er geht zu Fuß nach unten, steckt sich eine Zigarette an, nimmt mehrere tiefe Züge und verpestet die Luft im Treppenhaus. Manchmal geht es nicht anders. Elfriede Hunger, unverheiratet, achtundsiebzig Jahre alt, nun ohne direkte lebende Verwandtschaft, die Letzte ihrer Familie.
4 Die Vereinbarkeit von Beruf und Haustier
Pinscher sitzt in seinem Büro vor dem Computer und erledigt die Bürokratie der beiden heutigen Sachverhalte. An der Wand gegenüber seines Schreibtischs hängt eine Abbildung von Giacomettis Hund, die er mal in einer Zeitschrift entdeckt hat. Daneben an der Pinnwand Bestellkarten für Italienisch, Indisch und Asiatisch. Ein Regal mit Aktenordnern, davor ein nie benutzter grüner Gymnastikball, aus dem die Luft mehr und mehr entweicht, sowie eine Klappmatratze, angeschafft zur physiotherapeutischen Selbstbehandlung, die vorzugsweise während der Nachtschichten dringlich wird. Er mag das Büro nicht, er kann den Stillstand dieses Ortes nicht leiden. Ein Alleinsein ohne Zigaretten. Einmal hat er für zwei Wochen auf den Graupapagei seines Nachbarn aufgepasst, den nahm er im Käfig mit zur Arbeit, aber der Vogel störte die Vernehmungen in den anderen Büros durch ständiges Geschrei, und Pinscher musste das Tier noch während der Schicht wieder nach Hause bringen.
Sein Kollege, dessen Namen er sich aus Gemeinheit nicht merkt, hat im Gemeinschaftsraum nicht gegrüßt. Die Leute gehen ihm aus dem Weg, mal wieder, dabei sollte er derjenige mit den komischen Launen sein. Seine Rückenschmerzen wären für alle anderen Kollegen ein willkommener Grund für mindestens vier Wochen Krankschreibung. Er hat dieses Jahr nicht ein einziges Mal auch nur einen Tag gefehlt, und in den Jahren davor auch nicht. In einer Stunde kann er nach Hause. Er beeilt sich, lädt die Bilder der Leichenbuden hoch und beschriftet sie, das macht er fast mechanisch. Bei manchen Fällen baut er in seine Texte kleine Scherze für die Staatsanwaltschaft ein und stellt sich die Freude vor über den außergewöhnlichen Bericht, keine Zeit dafür heute.
Gerade will er sich einen Kaffee holen für den zweiten Ereignisortbericht, als seine Chefin in der Tür steht. Das erstaunt ihn. Seine Chefin Jana, wenige Jahre vor der Rente, kommt vor allen anderen Kollegen und geht entsprechend früh. Pinscher, kommst du mal bitte? Klar, bin gleich da, ich mache die Leiche eben fertig. Nein, sofort. Volle Pulle Starkstrom in Pinschers Rücken, es reißt ihn fast vom Stuhl, er muss aufpassen, beim Aufstehen nicht vor Schmerzen aufzustöhnen. Er betritt das Zimmer seiner Chefin, das größte Chaos auf dem gesamten Revier, Akten und lose Blätter und stapelweise Sachverhalte, selbst die Weihnachtsdekoration wird aus unerfindlichem Grund einfach seit Jahren nicht mehr weggeräumt. Seine Chefin Jana mag er sehr, sie ist ruhig und respektgebietend, sie ist alleinstehend wie er. Hätten sie nicht beruflich miteinander zu tun, wären sie befreundet und würden schweigend in der Kneipe sitzen. Jana ist größer als er, legt ihm mütterlich die Hand auf die Schulter, atmet schwer ein, atmet schwer aus und schaut aus dem Fenster. Komm, sagt Jana, wir müssen eine rauchen.
Das ist das Alarmsignal, Pinscher kennt das Schema, beim Graupapagei hatte er zur Notfallzigarette ebenso antreten müssen wie damals, als ihm gegenüber einem Beschuldigten die Hand ausgerutscht war. Er nimmt sich eine der dünnen Zigaretten, die seine Chefin ihm anbietet, immer schon raucht sie die blauen Vogue. Jana öffnet das Fenster, stumm nehmen sie die ersten Züge. Geht es besser mit dem Autofahren und deiner Angst, fragt Jana. Schon, sagt Pinscher, mal so, mal so. Du hast dich aus allen Nachtschichten rausgeplant, sagt Jana. Na und, sagt Pinscher. Ich mag dich wirklich gern, sagt Jana, du weißt ganz genau, dass ich dich verdammt gern mag. Ich weiß, sagt Pinscher. Das geht trotzdem alles nicht, sagt seine Chefin. Sie raucht fahrig und schnell, jetzt kommt der unangenehme Teil, denkt Pinscher, und steht noch gebeugter da als ohnehin schon, ein Schuljunge, der vor versammelter Klasse zusammengepfiffen wird. Was macht deine Mama, fragt Jana. Alles gut, sagt Pinscher, alles gut, können wir das jetzt vielleicht abkürzen?
Das hätte er nicht sagen sollen. Jana nimmt Pinscher seine Zigarette aus der Hand, wirft sie raus und ihre hinterher, knallt das Fenster zu, na gut, setz dich jetzt hin.
Was hast du mit Achenbach gemacht, fragt seine Chefin, steht direkt vor ihm und sieht ihn durch ihre zusammengekniffenen Augen hindurch an. So hat Pinscher sie noch nie erlebt. Wer ist das überhaupt? Jetzt wird sie laut: Hör auf mit dem Theater, Pinscher. Du sperrst deinen eigenen Kollegen auf dem Klo ein und fährst zu einem potenziellen Tatort. Du überbringst Todesnachrichten allein. Was ist bei dir und Achenbach los? Was stimmt nicht mehr mit dir? Ich kann den nicht haben, sagt Pinscher. Und was noch? Ich kann den ums Verrecken nicht haben. Seine Chefin setzt sich, trommelt mit den Fingern auf die Tischplatte ein. Du hast gestern auf offener Straße einen Bürger Sarggeburt genannt, nachdem du ihm vorher den Weg abgeschnitten hast. Als Sarggeburt! Leute haben angerufen und sich beschwert. Du hast einem Behinderten die Luft aus dem Rollstuhl gelassen, nachdem du ihn vorher fast überfahren hast. Auch das haben Leute gemeldet. Der war ein Nazi, der ist einfach auf die Straße gerollt. Der Nazi hat dich angezeigt, sagt seine Chefin, ihre Lippen zittern. Pinscher schluckt, zieht seine Zigarettenschachtel aus der Hosentasche, bietet ihr eine an, die letzte Beschwichtigungsgeste, dafür ist es zu spät: Lass das sein, wir sind ein Nichtraucherrevier. Schweigen. Sekundenlang. Jana spricht jetzt ganz ruhig weiter. Ich mag dich gern, Pinscher, wirklich gern. Zu gern. Zu gern für was, fragt Pinscher. Stille. Ich finde, du solltest dich um deine Mutter kümmern, sagt Jana seelenruhig, fast verständnisvoll. Ich kümmere mich um sie, protestiert Pinscher, ich rufe sie jeden Tag an, ich bin einmal im Monat da. Das meine ich nicht, sagt Jana, du solltest dich richtig um sie kümmern. Jeden Tag. Jetzt fällt der Groschen. Pinscher sackt in sich zusammen.
In Mündendorf, sagt Jana, brauchen sie einen Bezirksdienstbeamten. Das ist keine Kurzschlussentscheidung, ich habe mir das schon länger so überlegt. Es ist alles besprochen mit dem Kollegen, er hat sogar explizit nach dir gefragt, nimm es mir bitte nicht übel, aber das ist besser so. Du kennst die Gegend, du kennst die Leute. Du bist aus der Schusslinie. Fürs Erste. Erfahrungen auf dem Land sollten wir sowieso alle mal sammeln. Ab wann, sagt Pinscher. Ab morgen, sagt seine Chefin. Wie lange, sagt Pinscher. Mal sehen, sagt seine Chefin. Und Pinscher sagt nichts mehr. Außerdem kannst du da einen Hund haben, das wolltest du doch immer, da ist die Vereinbarkeit von Beruf und Haustier doch viel eher gegeben als hier. Wer weiß, vielleicht gefällt es dir zu Hause. Pinscher hat die Arme vor der Brust verschränkt. Hier ist zu Hause, sagt er, und seine Stimme bricht. Ich hab dich wirklich gern, sagt Jana. Ich lass mich gern krankschreiben, sagt Pinscher und steht auf. Komm, wir rauchen noch eine, sagt Jana. Ich lass mich krankschreiben, sagt Pinscher, beißt die Zähne zusammen, stemmt sich hoch und geht zur Tür, Maria, Josef, das Jesuskind und sogar die Tiere aus der verstaubten Heiligabend-Krippe lachen ihn aus. Pinscher hinkt auf den Flur und knallt die Tür hinter sich zu, ich lass mich einfach krankschreiben, ruft er über den Gang, aber keiner interessiert sich mehr für ihn. Was soll er zu Hause? Andererseits: Was hat er hier noch verloren?
5 Das Wohnzimmer
Und plötzlich hast du diese Kälte im Nacken. Wie sonst nur, wenn du einen Luftzug aus dem Mittelgebirge abbekommst. Du stehst im Haus. Es ist stockdunkel. Wie bist du hierhergekommen? Bist du wirklich wach? Mach das Licht an, sonst siehst du ja gar nichts! Da ist sie. Groß und klobig und schwer. So massiv. Als hätte man das Haus um sie herum gebaut und nicht andersherum. Die Schrankwand. Relikt deiner erloschenen Familie. Geh hin, trau dich. Was soll schon passieren? Zieh alle Schubladen gleichzeitig auf, guck rein. Sie kommt aus dem Versandhauskatalog der Achtziger, bezahlt in sechsunddreißig Raten, dunkle Eiche furniert, der Beweis für den Wohlstand der kleinen Leute, die holzgelackte Bestätigung des eigenen Angekommenseins, das handfeste Lebensarchiv der proletarischen Kleinstadtfamilie. Ganz rechts hinter den Türen, mittlerweile hier und da unvollständig, aber immer noch beeindruckend: diese schiere Menge an Geschirr. Bestimmt vier Sets, angeschafft oder geschenkt zu verschiedenen Anlässen: die Teller und Unterteller mit den folkloristischen britischen Armeeszenen zur silbernen Hochzeit in den Neunzigern. Das schneeweiße Geschirr fürs Weihnachtsessen. Nur ein einziges Mal im Jahr aus dem Schrank genommen und danach von Hand gespült. Links daneben: das nahezu komplett erhaltene Kaffeeservice mit den kleinen Röschen darauf. Du hast dein Erspartes zusammengekratzt, bist mit dem Bus in die Stadt und hast es ihnen gekauft, einfach so. Jetzt reiß dich mal zusammen, ja, hinter dir wird jetzt gehustet und geraucht, der Fünfzigste deines Vaters. Dreh dich um, da sitzen sie alle. Onkel Hermann, längst beerdigt, hebt seinen beunruhigend grauen Hut, dieser jähzornige Drecksack. Tante Gerda spricht wieder so leise, was ist ihr passiert, du hast es zu ihren Lebzeiten nicht rausgefunden und wirst es auch nicht mehr tun. Ach, die jovialen Schneiders, die ältesten Freunde deiner Eltern mit den lustigen, runden Gesichtern, sie sehen dich und wollen dir gleich wieder zehn Mark zustecken, ein Geldstück für jede Hosentasche. Alle rauchen. Willst du dich dazusetzen? Jetzt nicht, du musst weitermachen. An den Ecken der Schrankwand, an den Türen, an einer Leiste, die dunkler ist als der Rest: Beschädigungen aus einer Zeit, als du ganz klein warst. Du hast mal den Rand angeflämmt mit dem Feuerzeug, als die Eltern nicht im Haus waren. Du hast deine ständige Wut an der rechten Tür ausgelassen. Die beschädigte Schrankwand: vitaler als das beschädigte Leben danach. Guck besser nicht weiter nach links, dann tut es richtig weh. Die Abteilung mit den Fotoalben. Schlägst du sie auf, dann bist du auf der Autobahn in Richtung Nordsee. Dann steigst du aus dem verqualmten Ford Escort aus und riechst das Meer. Siehst die spartanisch und billig eingerichtete Ferienwohnung, drei Wochen lang das Paradies. Schau weiter. Kleinstadtfamilie in zu bunten und zu großen Regenjacken, hart arbeitende Eltern, der verzogene Junge, ein Spaßvogel. Du weißt es genau, irgendwann werden die Seiten leerer, noch eine Konfirmation, noch ein runder Geburtstag, noch ein letztes und ein allerletztes Grillen, mein Gott, das ist wirklich gruselig, du drehst dich zurecht um und bist erschrocken, der krebskranke Vater auf dem Sofa, der nicht mal mehr seinen Brei löffeln kann, du knallst das Fotoalbum zu, reißt die Klappe auf, hinter der sich der Starkalkohol verbirgt. Schnaps in vielen Varianten, halb ausgetrunkene Flaschen, die nur auf dich gewartet haben, du trinkst dir die Gespenster hinter dir weg, bis das Wohnzimmer wieder still und leer, bis die Schrankwand wieder ganz unberührt ist, nein, niemand hat was verändert, dunkle Eiche furniert: unverdächtig.
6 Im Schuhkarton
Der Vorteil seiner Wohnung liegt auf der Hand: Er hat es nicht weit zum Revier und er wohnt direkt am Rhein. Vor ihm hatte hier ein Hirnforscher aus dem Senegal gelebt, der auf Träume spezialisiert war. Das färbt ab, davon ist er überzeugt. Als Pinscher eingezogen war, hatte es gleich angefangen mit den abstrusen und lebhaften und zermürbenden Träumen. Nacht für Nacht der größte Unsinn, der sich auch mit Schnaps kaum eindämmen ließ. Er hatte die Wohnung unbedingt gewollt. Die erste Wohnung, die er sich damals angesehen hatte. Eine winzige Behausung, alles in allem gut dreißig Quadratmeter, ein kleiner Schuhkarton unter dem Dach, im Winter zugig und im Sommer unerträglich heiß. Nicht mal für ein richtiges Bett war Platz, er hatte sich ein Schlafsofa gekauft, das er tagsüber einklappen konnte. Obwohl er längst genug Geld verdient für eine größere Wohnung, obwohl seine Kollegen ihn auslachen für das Jugendzimmer, in dem er seit Jahren haust, kann er sich nicht davon trennen: Hier hörst du den Rhein, hier siehst du die Sittiche, hier ist gerade so viel Platz, dass du dich vor der Welt verstecken kannst. Sein Refugium, quasi schuhkartongroß. Von hier aus kann er leben. Er stellt sich manchmal vor, dass die Halsbandsittiche, die sich mittlerweile über die ganze große Stadt verteilen, es ähnlich gemacht haben: Zuerst ist in den Sechzigern ein einzelnes Paar vermutlich aus einer privaten Voliere ausgebrochen und hat sich im Stadtwald versteckt. Fast so, als hätten sie in aussichtsloser Lage ein Reihenhaus in der Kleinstadt bezogen, haben die Halsbandsittiche von dort aus ihre Familie gegründet. Den Platz von Generation zu Generation vergrößert. Heute gehört ihnen alles hier, sämtliche Versuche, sie zu vertreiben, scheitern immer wieder.
Pinscher hat mal angefangen zu studieren, Medizin, aber nach einem Jahr ist sein Papa an seinem ersten offiziellen Tag als Rentner umgefallen. Pinscher hat getan, was er ausgesprochen gut kann: weglaufen. Aus der Kleinstadt, wo er aufgewachsen ist. Etwas hat ihn zur Polizei gezogen. Die ewige Wiederholung des Schreckens, bis er kleiner und kleiner wird.