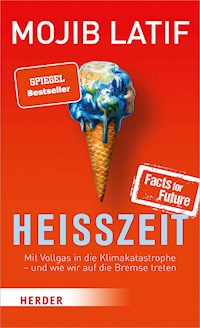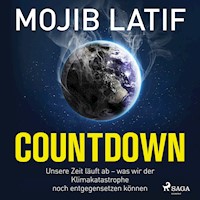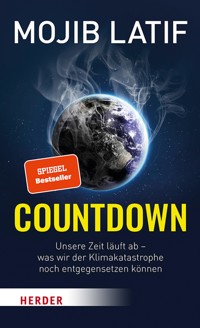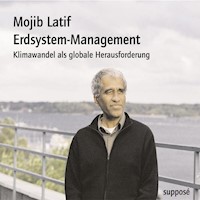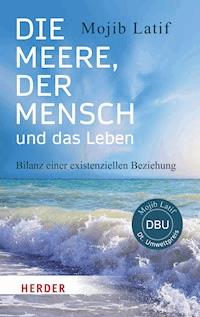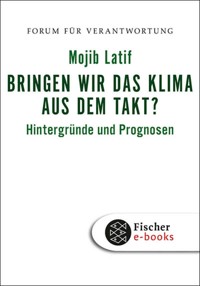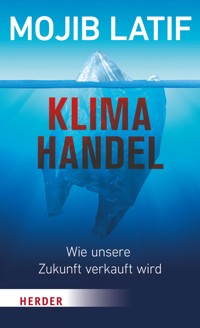
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Seit mehr als einem halben Jahrhundert ist bekannt, dass sich die Menschheit durch Umweltzerstörung und die Aufheizung des Klimas der eigenen Lebensgrundlage beraubt. Zwar häufen sich inzwischen die internationalen Umwelt- und Klimakonferenzen, und auch die Politik und Wirtschaft geben Versprechen ohne Ende ab, geschehen ist aber bislang viel zu wenig. In seinem neuen Buch wendet sich Mojib Latif den Fragen zu, warum die Menschheit weiter wider besseres Wissen an dem Ast sägt, auf dem sie sitzt, warum die Politik versagt und wenige Konzerne profitieren. Und wie wir die Zukunft nachfolgender Generationen verspielen. Seine These: Der Klimawandel ist Objekt eines fatalen Verhandlungskreislaufs geworden, bei dem es nur sehr wenige Gewinner und unzählige Verlierer gibt. Entscheidend ist eine globale Zusammenarbeit, die die Frage beantwortet, wie Wohlstand mit Nachhaltigkeit verbunden werden kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mojib Latif
Klimahandel
Wie unsere Zukunft verkauft wird
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2024
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: geviert.com, Michaela Kneißl
Umschlagmotiv: © Shutter_M / shutterstock
E-Book-Konvertierung: Daniel Förster
ISBN Print 978-3-451-39585-7
ISBN E-Book (EPUB) 978-3-451-83231-4
Inhalt
Die verkaufte Zukunft – Vorwort
Die Fieberkurve der Erde – Fakten zum Klimawandel
Was man über das Klimaproblem wissen sollte
In voller Fahrt
Verhallende Weckrufe
Der verstellte Blick
Hitze, Dürre, Starkregen
Tropische Wirbelstürme
Erdüberhitzung
2-Grad-Ziel und 1,5-Grad-Ziel
Ein verhängnisvolles Spiel auf Zeit – Vom Klimawandel zum Klimahandel
Gesundheitsrisiko Klimawandel
Zerstörte Landschaften
Unser Krieg gegen die Umwelt
Untätigkeit
Sorglosigkeit
Spekulationsobjekt Umwelt
Greenwashing
Endspiel
Im Mahlstrom der Interessen – Zwischen Bangen und Hoffnung
Runter mit den Emissionen!
Keine Experimente!
»Save Our Souls«
Die globale Dimension
Gründe der Skepsis
Nagende Zweifel
Aufholjagd
Die Lage in Deutschland
Im Zeitalter der Polarisierungen
Technologischer Fortschritt
Über den Autor
Anmerkungen
»Aber ist es unrealistisch zu erwarten,dass der Mensch weise genug ist,das zu tun, was er für sein eigenesWohlergehen tun muss?«
Maurice Strong auf der Stockholm-Konferenz 1972
Die verkaufte Zukunft – Vorwort
Das Jahr 2023 hat der Welt gezeigt, dass Klimaschutz keine grüne Spielwiese ist, sondern die Lebensgrundlagen auf der Erde sichert. 2023 wird in diesem Buch eine besondere Rolle einnehmen, hat es doch deutlich gemacht, wie sehr die Welt schon im Klimawandel steckt und wie bedrohlich er inzwischen bereits ist. Das Klima zu schützen und es nicht weiter aufzuheizen wäre so einfach, wenn nur die Länder zusammenarbeiten würden. Der Titel dieses Buches Klimahandel soll darauf aufmerksam machen, dass die Menschen hauptsächlich aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus dabei sind, das lebensfreundliche Klima auf der Erde zu ruinieren. Es handelt sich bei dem Titel um ein Wortspiel, das die menschliche Klimabeeinflussung, den Klimawandel mit dem Welthandel verknüpft. Im Welthandel läuft so einiges schief. Er richtet sich in seiner gegenwärtigen Ausgestaltung gegen die Umwelt, wobei der prominenteste Ausdruck der Fehlentwicklungen die Erderwärmung mit all ihren Auswirkungen wie der Zunahme von Wetterextremen oder dem ansteigenden Meeresspiegel ist.
Die menschliche Zivilisation stößt allmählich an ihre Belastungsgrenzen, was wir auch in Deutschland spüren. Wir nähern uns mit großen Schritten einem Bereich mit Temperaturen an der Erdoberfläche, deren Höhe die Menschheit noch nicht erlebt hat. Wollen wir das wirklich? Wollen wir völliges Neuland betreten, eine Welt, die wir Menschen noch nicht kennengelernt haben? Ich finde, dass wir dieses Wagnis nicht eingehen sollten. Ganz im Gegenteil, die Menschen müssen alles dafür tun, den Anstieg der Temperaturen schnellstmöglich zu stoppen, der inzwischen eine seit Jahrtausenden beispiellose Geschwindigkeit erreicht hat. Die Begrenzung der globalen Erwärmung ist eine Schicksalsfrage für die Menschheit und bedeutet zuallererst eine Neuausrichtung der Funktionsweise des Welthandels. Er muss sich an Nachhaltigkeitskriterien orientieren, sollte allen Menschen auf der Erde nutzen und nicht nur einer Minderheit. Sollte die Neuausrichtung des Welthandels nicht gelingen, droht eine ökologische Katastrophe, womit ich Verhältnisse auf der Erde meine, die wir Menschen nicht mehr zu kontrollieren imstande sein würden.
Das ist schon lange keine neue Erkenntnis mehr. Lassen Sie uns dazu, liebe Leserinnen und Leser, ins Jahr 1972 zurückblicken. 1200 Delegierte aus 113 Ländern hatten sich 1972 in der schwedischen Hauptstadt auf der sogenannten Stockholm-Konferenz getroffen, um über die damals bereits eingetretenen oder in der Zukunft zu erwartenden Umweltprobleme zu sprechen und um Wege zu finden, wie man die Erde besser vor der Ausbeutung durch die Menschen schützen könne. Der Ostblock, mit Ausnahme Rumäniens, war allerdings nicht nach Stockholm angereist. Dort spielten zu der Zeit Umweltprobleme auf der politischen Agenda so gut wie keine Rolle. In Russland hat sich selbst bis zum heutigen Tag immer noch kein nennenswertes Umweltbewusstsein entwickelt. In vielen Ländern des Westens hingegen machten sich die Menschen schon damals verstärkt Sorgen um Atomkraft, Waldsterben, sauren Regen und vergiftete Flüsse und Seen. Der Klimawandel drang erst später in das Bewusstsein der Weltpolitik. Die Empfehlungen der Stockholm-Konferenz sind jedoch universell und können auf alle Umweltprobleme übertragen werden.
»Aber ist es unrealistisch zu erwarten, dass der Mensch weise genug ist, das zu tun, was er für sein eigenes Wohlergehen tun muss?« Diese so fundamental wichtige Frage, mit der dieses Buch beginnt, hatte der kanadische Diplomat Maurice Strong vor mehr als einem halben Jahrhundert auf der Stockholm-Konferenz aufgeworfen, die »Konferenz der Vereinten Nationen über die Umwelt des Menschen«, deren Generalsekretär er war.1 Strong eröffnete die Konferenz mit einer überaus lesenswerten Rede,2 der ich die obige Frage entnommen habe. Die Konferenz war auf schwedische Initiative hin zustande gekommen. Das Land litt unter den Auswirkungen des sauren Regens, der aus den Industriegebieten Großbritanniens und Deutschlands kam, die mit ihrer Kohleverfeuerung die Luft verschmutzten. Die Stockholm-Konferenz gilt als der Beginn der internationalen Umweltpolitik. Einige Monate vor der Konferenz hatte der Club of Rome mit dem Bericht Die Grenzen des Wachstums die Weltöffentlichkeit geradezu erschüttert, eine Studie, die vor nicht weniger als dem Kollaps der menschlichen Zivilisation innerhalb von hundert Jahren gewarnt hatte, sollten die Menschen die Ressourcen der Erde immer weiter ausbeuten und die Umweltzerstörung fortsetzen.3
Maurice Strong beschwor in seiner Eröffnungsrede das, was wir inzwischen unter dem Begriff Nachhaltigkeit verstehen, mit den Worten: »Wir sind heute zusammengekommen, um unsere gemeinsame Verantwortung für die Umweltprobleme einer Erde zu bestätigen, deren Verwundbarkeit wir alle teilen. Diese Zusammenkunft dient nicht nur uns selber, sondern auch künftigen Generationen. Denn wir treffen uns als Treuhänder für alles Leben auf dieser Erde und für das Leben in der Zukunft.« Mangelnde internationale Zusammenarbeit war damals und ist heute mehr denn je ein großes Hindernis im Hinblick auf die Bewältigung der globalen Umweltprobleme. Um es vorwegzunehmen, die Stockholm- Konferenz und all die folgenden Konferenzen haben nicht zu den gewünschten Ergebnissen geführt. Die Welt steht heute vor dem Trümmerhaufen der internationalen Umweltdiplomatie. Da gibt es nichts zu beschönigen. Das klingt hart. Aber den Grad der Herausforderung etwa bei der Begrenzung des Klimawandels scheint außerhalb der Wissenschaft kaum jemand begriffen zu haben, und entsprechend mau sind die Anstrengungen der Länder.
Maurice Strong sprach in seiner Rede von einer Umweltkrise globalen Ausmaßes, die deutlich mache, dass »wir unsere Aktivitäten nicht nur im Hinblick auf den jeweiligen Zweck und die Interessen, denen sie dienen sollen, überprüfen müssen, sondern auch im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf alle Wechselbeziehungen, die die Qualität des menschlichen Lebens bestimmen«. Aber diese so überaus notwendige und doch eigentlich selbstverständliche Überprüfung menschlichen Handels in alle Richtungen findet bis heute so gut wie nicht statt. Unser Handeln ist nach wie vor weitgehend von Gier, Eigennutz und kurzfristigem Denken geprägt – und dies auf allen Ebenen, von der persönlichen über die unternehmerische bis zur staatlichen und zwischenstaatlichen Ebene. Die Folgen für Natur und Mensch wie auch für die zukünftigen Generationen blenden wir konsequent aus, obgleich sie entweder schon unübersehbar sind oder zumindest mit großer Sicherheit vorhersehbar. Es stellt sich daher die Frage, was uns eigentlich eine intakte Umwelt wert ist. Die seelenlose Funktionsweise des Welthandels führt zu existenziellen Problemen wie Klimawandel und Artensterben, beides Prozesse, die ungebremst voranschreiten und nicht kurzfristig, sondern nur über Jahrzehnte in den Griff zu bekommen sein werden. Der Klimawandel wird das Leben auf der Erde in den kommenden Jahrzehnten entscheidend mitprägen, weswegen gerade die junge Generation zu Recht aufgebracht ist. Sie ist es, die im Vergleich zu den jetzt an den Schalthebeln der Macht sitzenden Generation die größeren Lasten bezogen auf die Auswirkungen der Erderwärmung zu tragen haben wird, ohne dass sie viel dagegen tun könnte.
Obwohl der nachfolgende Ausspruch für Sie, liebe Leserinnen und Leser, schon ziemlich abgedroschen klingen mag, möchte ich ihn dennoch an dieser Stelle wiederholen, um die Art und Weise zu beschreiben, wie sich die Menschen seit Jahrzehnten auf der Erde verhalten: »Nach uns die Sintflut.« Jeder und jede von uns weiß, was mit dem Ausspruch gemeint ist. Die vier Worte drücken in aller Einfachheit die Gleichgültigkeit von uns Menschen gegenüber Zukünftigem aus. Das ist zwar verrückt, aber nun einmal die Realität. Wissen führt nicht zum Handeln. Wir Menschen müssen unsere Umwelt wertschätzen lernen und entsprechend handeln, wir dürfen das Wohl des Planeten nicht aus den Augen verlieren und müssen entschieden gegen diejenigen vorgehen, die glauben, dass ihnen allein die Erde gehört und sie sich ihrer Besitztümer bemächtigen können. Diese Forderungen sind im Grunde genommen selbstverständlich. Ich denke, die allermeisten von Ihnen könnten sie ohne Weiteres unterschreiben. Es bekümmert mich, diese Forderungen trotzdem seit vielen Jahren wiederholen zu müssen, wie so viele meiner Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichsten Fachdisziplinen. Wir drehen uns im Kreis und kommen in Sachen Nachhaltigkeit einfach nicht vom Fleck.
Wir verkaufen unsere Zukunft. Wir verscherbeln das, was für das Leben am allerwichtigsten ist, die günstigen Lebensbedingungen auf der Erde und damit das Wohlergehen unserer Kinder und Enkel, als wäre eine intakte Umwelt eine Ramschware, die keinen Wert besitzt und die man sich einfach neu beschaffen kann, wenn sie zerstört ist. Der Preis, den wir jetzt für die von uns angerichteten Umweltschäden zahlen, die sich beim Klima erst in einigen Jahren oder Jahrzehnten in aller Deutlichkeit zeigen werden, erscheint uns noch verlockend niedrig zu sein, weswegen uns die Belange der Umwelt nicht so wichtig sind. Der Preis, den wir für die Umweltschäden zahlen müssen, steigt aber selbst für die heutige Generation mit jedem Jahr weiter an. Die durch die globale Erwärmung verursachten Kosten explodieren förmlich, was man an den Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden an der Infrastruktur oder die Unterstützung bestimmter Wirtschaftszweige wie die Land- und Forstwirtschaft ablesen kann. Hinzu kommt der steigende Finanzbedarf für Klimaanpassungsmaßnahmen wie Hochwasserschutz oder Deicherhöhungen. Für die Kosten müssen wir alle über unsere Steuern aufkommen. Insofern sind alle Bürgerinnen und Bürger längst von der globalen Erwärmung betroffen.
Noch funktioniert unser Gemeinwesen einigermaßen, aber wie lange wird das noch der Fall sein? Die Klimaschäden werden zunehmen wie auch die Aufwendungen für den Klimaschutz. Wir stehen schließlich in der Pflicht, unsere eigenen Klimaziele einzuhalten. Das Ansteigen des CO2-Preises in Deutschland ist beschlossene Sache und wird für uns alle spürbar sein. Die Proteste nehmen schon zu. Niemand, so scheint es, will für eine intakte Umwelt einen finanziellen Beitrag leisten. Ist uns also die Umwelt nichts wert? Wir haben so viele Ausreden parat, wenn es um den Schutz der Umwelt geht. Es gilt das Sankt-Florian-Prinzip. Sollen doch andere erst einmal ihren Beitrag leisten. In einigen Weltregionen ist die Lage mittlerweile geradezu prekär. Zum Teil sind die Schäden nicht mehr reparabel und auch nicht mehr finanziell auszugleichen, wobei Letzteres gerade in den armen Regionen der Welt gilt. Viele Menschen sind sich dort selbst überlassen und müssen zusehen, wie sie zurechtkommen. Wie sollen sie Landwirtschaft betreiben, wenn der Regen ausbleibt oder so stark ist, dass er ganze Ernten wegspült? Die Hilfe seitens der Industrienationen, die sich schließlich ihren Wohlstand auf Kosten der Umwelt erkauft haben und hauptsächlich für den Klimawandel verantwortlich sind, ist dabei ziemlich überschaubar.
Die Menschen sind dabei, die Umwelt regelrecht zu verhökern, ein Vorwurf, der insbesondere an die reichen Länder gerichtet ist. Zahlreiche Staaten generieren ihren Wohlstand schlicht durch Umweltzerstörung, etwa durch die Förderung fossiler Brennstoffe oder die Zerstörung von Lebensraum wie die tropischen Regenwälder. Konzerngewinne und persönlicher Profit scheinen in der heutigen Zeit über alles zu gehen. Und je größer die Konzerne und je wohlhabender die Menschen sind, umso mehr Treibhausgase, die die Erde aufheizen, stoßen sie im Schnitt aus. Das reichste eine Prozent der Weltbevölkerung verursachte 2019 laut einer Analyse der Entwicklungsorganisation Oxfam 16 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen. Das sind so viele klimaschädliche Treibhausgase wie die fünf Milliarden Menschen, die die ärmeren zwei Drittel der Weltbevölkerung ausmachten.4 Oxfam untersuchte in einer anderen Studie auch 125 der reichsten Milliardäre auf ihren klimatischen Fußabdruck.5 In der entsprechenden Pressemitteilung heißt es: »Schon die Emissionen durch ihren eigenen Konsum mit Privatjets, Superjachten oder Luxusvillen betragen das Tausendfache der weltweiten Pro-Kopf-Emissionen.« Und weiter heißt es dort, »dass die untersuchten Milliardäre die Emissionsintensität ihrer Investitionen schon allein dadurch auf ein Viertel reduzieren könnten, wenn sie ihre Investitionen in Fonds mit strengeren Umwelt- und Sozialstandards verlagern würden«. Und die Reichen werden immer reicher. In einer Anfang 2024 veröffentlichten Studie erklärt Oxfam: »Seit 2020 haben die reichsten fünf Männer der Welt ihr Vermögen verdoppelt. Im gleichen Zeitraum sind weltweit fast fünf Milliarden Menschen ärmer geworden. Not und Hunger sind für viele Menschen weltweit tägliche Realität. Bei den derzeitigen Raten wird es 230 Jahre dauern, um die Armut zu beenden, aber wir könnten in einem Jahrzehnt unseren ersten Billionär haben.«6
Die Investitionen der 125 reichsten Milliardäre in umweltschädliche Industrien wie fossile Brennstoffe und Zement sind doppelt so hoch wie der Durchschnitt der sogenannten S & P 500-Unternehmensgruppe, die die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst.7,8 Es kann doch nicht angehen, dass das Klima auf dem Altar des Profits von einigen wenigen Konzernen oder Superreichen geopfert wird. Aber auch im Kleinen spielen Umweltinteressen keine große Rolle: Hauptsache die Rendite stimmt, negative Aspekte der getätigten Investments mögen vielleicht verstanden worden sein, werden aber meistens ausgeblendet. Das Weltwirtschaftssystem, in dem wir leben, scheint Umweltzerstörung förmlich herauszufordern. Wir schwelgen im Wohlstand oder in dem, was wir dafür halten, und leisten uns allerlei Luxus, bezahlen tun wir letztlich mit unserer Umwelt. Nur wird es irgendwann beispielsweise das Klima, das wir gekannt haben und das uns ernährt hat, nicht mehr geben. Zurückkaufen können wir es dann nicht mehr, egal wie viel Geld wir auf den Tisch des Hauses legen und zu welchem Verzicht wir dann bereit sein sollten.
Ich habe stets betont, dass wir die gewaltigen Herausforderungen, wie zum Beispiel die Klimakrise oder das Artensterben, denen sich die Menschheit gegenübersieht, nicht in Isolation werden lösen können. Die zahlreichen Umweltprobleme sind schlicht die verschiedenen Symptome des Mangels an Nachhaltigkeit. Die damalige indische Ministerpräsidentin Indira Gandhi beschrieb es 1972 auf der Stockholm-Konferenz mit den folgenden Worten: »Das Leben ist eins, und wir haben nur diese eine Erde. Alles ist miteinander verknüpft: Bevölkerungsexplosion, Armut, Unwissenheit, Krankheit, Umweltverschmutzung, die Ansammlung von nuklearen, biologischen und chemischen Waffen. Ein Teufelskreis! Jedes Thema ist wichtig, aber es wäre vergebliche Mühe, jedes einzeln zu behandeln.« So ist es, Frau Gandhi! Wir müssen deswegen vom System her denken, das sich die Menschen geschaffen haben, welches nur dann gut funktionieren kann, wenn es Gerechtigkeit und ein gutes Miteinander der Menschen garantiert. Gerade beim Wirtschaftssystem ist dies nicht der Fall. Der zweifache Grimme-Preisträger Florian Opitz nennt es mit seiner Dokumentation beim Namen. Der Film heißt System Error. Treffender kann man es nicht ausdrücken. Der Systemfehler wird am Ende zum Absturz des Gesamtsystems führen, weswegen wir den Fehler schnellstens abstellen müssen. Der Systemfehler besteht im scheinbaren Zwang nach Wachstum auf Kosten der natürlichen Ressourcen der Erde, wodurch immer mehr Schaden an der Umwelt angerichtet wird. »Alle sind Teil dieses Systems, und zumindest diejenigen, die in den wohlhabenden Industrieländern leben, haben es sich in diesem System gemütlich gemacht«, so lautet die Botschaft der Dokumentation.9 Wir in den reichen Ländern wissen es, trotzdem fällt es uns schwer, daran zu arbeiten, das System zum Besseren zu verändern, obwohl wir es doch wollen. Bei vielen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, herrscht ein Ohnmachtsgefühl vor, weil die Aufgabe zu gewaltig und damit so gut wie unlösbar erscheint.
Hinzu kommt, dass wir Menschen offenbar nicht in Frieden miteinander leben können oder wollen. Enorm viel Kraft wird in sinnlose Kriege gesteckt, die unermessliches Leid über Millionen von Menschen bringen. Da ist der Krieg im Nahen Osten, ausgelöst durch die Terrororganisation Hamas, die Israel am 7. Oktober 2023 überfallen hatte, wobei der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern schon seit Jahrzehnten andauert. Der Überfall Russlands auf die Ukraine vom 24. Februar 2022 hält immer noch an, und ein Ende des jetzt schon über zwei Jahre langen Krieges ist nicht in Sicht. Das sind nur zwei Beispiele. Es gibt noch weitere kriegerische Auseinandersetzungen, zum Beispiel Bürgerkriege wie die im Jemen oder Sudan. Vielleicht steht demnächst ein Überfall Chinas auf Taiwan an, womit die chinesische Regierung dem Inselstaat offen droht. Die Voraussetzungen für eine enge internationale Kooperation und damit für einen globalen Umweltschutz, wie er auf der Stockholm-Konferenz vor über 50 Jahren eingefordert worden war, stehen schlechter denn je, wenn man die aktuellen geopolitischen Entwicklungen betrachtet. Die Despoten dieser Welt scheinen gemeinsame Sache zu machen, was man anhand des Krieges Russlands gegen die Ukraine ablesen kann. Zu den direkten oder indirekten Unterstützern Russlands zählen unter anderem China, Iran, Nordkorea und die Türkei. Eine Welt ohne Frieden wird sich immer mehr Krisen gegenübersehen. Deswegen, fürchte ich, wird es keinen nennenswerten Klimaschutz geben, solange die Menschen gegen sich selbst kämpfen und nicht gemeinsam für eine bessere Welt. Treibhausgase sind äußerst langlebig, kennen daher keine Grenzen und heizen den Planeten überall auf, wenn sie erst einmal in der Atmosphäre sind. Werden die Regierenden der Welt diese Zusammenhänge jemals begreifen, oder ist das Streben nach Macht einfach zu groß? Sollte am Ende Vernunft der menschlichen Natur widersprechen?
Ich werde zu Beginn des Buches die Dinglichkeit des Klimaschutzes beschreiben, obwohl diese inzwischen hinreichend klar sein sollte. Der Handlungsdruck ist durch das Jahr 2023 mit seinen vielen extremen Wetterereignissen überdeutlich geworden, weswegen ich einen besonderen Blick auf die Ereignisse des Jahres werfen werde. So wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen aus den Klimawissenschaften habe auch ich schon seit Jahrzehnten auf die potenziellen und teilweise katastrophalen Auswirkungen der globalen Erwärmung hingewiesen, die sich in den letzten Jahren immer offener zeigen. Das Jahr 2023 hat den bisherigen Höhepunkt in dieser Entwicklung markiert. So war es unter anderem das heißeste Jahr seit Beginn der Messungen. Die Menschen haben ihr Schicksal herausgefordert, indem sie die Wissenschaft nicht ernst genommen haben, und müssen nun die Konsequenzen des an Fahrt gewinnenden globalen Klimawandels tragen, den sie selbst verursacht haben und der sich noch etliche Jahre lang weiter fortsetzen wird, ohne dass man dem viel wird entgegensetzen können.
Einerseits, weil das Erdsystem mit Verzögerung reagiert. Und andererseits, weil die Weltwirtschaft eben auch ein träges System ist. Sie fußt auf Ressourcenverschwendung und Umweltzerstörung. Die Funktionsweise der Weltwirtschaft wird sich nicht von heute auf morgen ändern lassen. Deswegen werden in den kommenden Jahrzehnten noch mehr Treibhausgase in die Atmosphäre gelangen, die den Planeten weiter erwärmen werden. Ich werde einige Gründe diskutieren, warum wir beim globalen Klimaschutz selbst nach Jahrzehnten des Wissens über Ursachen und Folgen nicht ins Handeln kommen. Das Verzwickte beim Klimawandel ist eben, dass der Ort des Ausstoßes von Treibhausgasen unerheblich ist, weil die Gase so überaus lange in der Atmosphäre verweilen. Deswegen sind sie imstande, sich um den Erdball zu verteilen, und überall auf der Welt wirksam. Die Staaten sitzen alle im selben Boot und müssen zu ihrer aller Wohl gemeinsam gegen die globale Erwärmung vorangehen. Das ist nicht der Fall, vielmehr bestimmen nationale, meist wirtschaftlich getriebene Interessen das Handeln der Länder, weswegen wir bei der Begrenzung der globalen Erwärmung nicht so richtig vom Fleck kommen. Das ist dumm, aber die Realität, der wir uns stellen müssen. Die Menschen haben sich ein völlig unzulängliches System geschaffen, und das gilt es zu reformieren. Ideen dazu gibt es viele, sie scheitern aber vor allem an der Praxistauglichkeit. Nehmen Sie als Beispiel China, den derzeit größten Verursacher von CO2, oder Russland, den viertgrößten Emittenten. Diesen beiden Ländern wie auch einigen anderen Ländern können Sie beispielsweise nicht mit Gerechtigkeitsargumenten kommen. Die zählen bei denen nicht.
Eines möchte ich gleich zu Beginn klarstellen: Wir sollten uns nicht der Hoffnung hingeben, dass es in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten Technologien geben wird, mit denen man nennenswerte CO2-Mengen aus der Atmosphäre entfernen und dadurch die globale Erwärmung verlangsamen könnte. Es wird kein Weg daran vorbeiführen, auf der einen Seite den weltweiten Ausstoß von Treibhausgasen drastisch zu verringern und auf der anderen Seite die Ökosysteme besser zu schützen oder so weit es geht wiederherzustellen, damit wir ihre Funktion als Klimaregulatoren stärken. Wenn wir auf technische Maßnahmen setzen und weiterhin unsere Energieversorgung mit fossilen Brennstoffen sichern wollen, werden wir kostbare Zeit verlieren, um die Emissionen zu senken, und wir werden Innovation in nachhaltige und damit zukunftsorientierte Technologien behindern.
Ich werde in dem Buch aber auch deutlich machen, dass es trotz der vielen Hemmnisse prinzipiell immer noch möglich wäre, eine übermäßige Aufheizung der Erde zu vermeiden, die man langläufig als Klimakatastrophe oder Klimakollaps bezeichnen würde. Ob die Welt es verhindern wird, das Klima gegen die Wand zu fahren, steht in den Sternen. Die Leitlinie für den internationalen Klimaschutz ist das Pariser Klimaabkommen aus dem Jahr 2015. Darin haben sich die Länder darauf verständigt, die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen, besser auf 1,5 Grad Celsius, wobei man als vorindustrielle Zeit üblicherweise das Mittel der Jahre 1850 bis 1900 wählt. Die Welt läuft Gefahr, die Ziele des Abkommens zu reißen. Bezogen auf das 1,5-Grad-Ziel ist dies wohl schon geschehen, worauf ich unten noch im Detail eingehen werde. Der größte Haken des Abkommens besteht darin, dass es nicht bindend ist, sondern auf freiwillige Umsetzung in den einzelnen Staaten setzt. Trotzdem gibt es winzige Zeichen der Hoffnung. Völlig tatenlos ist die Welt in den letzten Jahren eben auch nicht gewesen. Die Dynamik beim Ausbau der erneuerbaren Energien und die Steigerung der Energieeffizienz war so vor einigen Jahren nicht vorherzusehen. Die Fortschritte haben gezeigt, dass die Welt durchaus zu Veränderungen fähig ist, wenngleich diese bislang nicht ausreichen, um von einer Kehrtwende beim Klimaschutz sprechen zu können. Was vor allen Dingen fehlt, ist der politische Wille in einer auseinanderfallenden Weltgesellschaft, in der gegensätzliche Interessen dominieren.
Die Fieberkurve der Erde – Fakten zum Klimawandel
Was man über das Klimaproblem wissen sollte
Ich bekomme viele Briefe und auch jede Menge E-Mails, in denen die menschliche Klimabeeinflussung zumindest angezweifelt oder auch mit zum Teil großer Vehemenz in Abrede gestellt wird. Oft werden meine Kolleginnen und Kollegen aus der Klimaforschung und selbstverständlich auch ich als Deppen hingestellt, die von Tuten und Blasen keine Ahnung hätten. Ich frage mich, warum das so ist, obwohl doch die wichtigsten Voraussagen der Klimaforschung aus den letzten Jahrzehnten eingetroffen sind. Beispielsweise ist die globale Durchschnittstemperatur an der Erdoberfläche mit einer Rate angestiegen, wie es vor einigen Jahrzehnten prognostiziert wurde, sollten die atmosphärischen Treibhausgaskonzentrationen fortgesetzt ansteigen.
Für die Skepsis gegenüber der Klimaforschung gibt es mehrere Gründe. So haben Verschwörungserzählungen in der heutigen Zeit Konjunktur, und es wird praktisch alles angezweifelt, selbst die Gefährlichkeit des Coronavirus. Das kann mich als Klimawissenschaftler aber keineswegs beruhigen, weil ich die Gefahr sehe, dass sich unsere Gesellschaft in eine Richtung entwickelt, in der Fakten nicht mehr die Rolle im gesellschaftlichen Diskurs spielen, die sie spielen sollten. Bei einigen mag das Zweifeln schlicht auf Unwissenheit beruhen. Schließlich handelt es sich beim menschengemachten Klimawandel um komplizierte physikalische Vorgänge, die für Nichtfachleute nicht ohne Weiteres nachzuvollziehen sind. Trotzdem würde ich selber es mir nicht anmaßen, Dinge zu beurteilen, von denen ich so gut wie nichts verstehe, wie zum Beispiel die Zweckmäßigkeit der sogenannten Stringtheorie in der theoretischen Physik, um zu einer vollständigen Weltformel zu gelangen.10 Für diejenigen unter Ihnen, die das Klimaproblem in seinen Grundzügen verstehen möchten, ist dieses Kapitel gedacht. Die sogenannten Klimaleugner, die Fakten gegenüber nicht mehr zugänglich sind und ohnehin glauben, alles besser zu wissen als die weltweit renommiertesten Klimawissenschaftlerinnen und Klimawissenschaftler, und die abstrusesten Behauptungen aufstellen, warum es auf der Erde wärmer wird, dürfen die folgenden Zeilen aber auch gerne lesen.
Die Erde wird von der Sonne ständig mit Energie beliefert. Ein Teil der Sonnenstrahlung, die bei uns ankommt, wird in den Weltraum zurückreflektiert, ein anderer Teil von der Atmosphäre etwa in der Ozonschicht absorbiert, und der Rest gelangt durch die Atmosphäre an die Erdoberfläche. Die dort ankommende Energie des Sonnenlichts erwärmt die Land- und Meeresregionen, die ihrerseits Wärme in Form von Infrarotstrahlung in die Richtung des Weltraums aussenden.11 Einige Gase in unserer Atmosphäre, Treibhausgase genannt, die nur einen äußerst geringen Anteil an der Atmosphäre besitzen, verhindern, dass der Großteil der von der Erdoberfläche ausgesendeten Infrarotstrahlung direkt in den Weltraum entweicht. Die Treibhausgase absorbieren die von der Erdoberfläche kommende Wärmestrahlung und senden ihrerseits wiederum Infrarotstrahlung in alle Richtungen aus, auch in Richtung der Erdoberfläche. Im Endeffekt wirken die Treibhausgase so ähnlich wie eine Decke, die Wärme am Körper hält. Eine andere Analogie wäre das Treibhaus. In diesem Bild übernehmen die Treibhausgase die Rolle des Glases. Daher rührt auch der Name Treibhauseffekt.
Der Treibhauseffekt hält die Erdoberfläche warm genug, um Leben zu ermöglichen. Der Wasserdampf, die unsichtbare und gasförmige Phase des Wassers (H2O), ist das wichtigste Treibhausgas und liefert mit etwa zwei Dritteln den größten Beitrag zum (natürlichen) Treibhauseffekt, gefolgt von Kohlendioxid (CO2), Ozon, Methan und Lachgas. Die Menschen stoßen seit dem Beginn der Industrialisierung große Mengen Treibhausgase in die Atmosphäre aus, die sich dort ansammeln. Mehr Treibhausgase in unserer Lufthülle verstärken den Treibhauseffekt, wobei man die Verstärkung durch die Menschen als den zusätzlichen oder anthropogenen Treibhauseffekt bezeichnet. Der stärkere Treibhauseffekt führt zu einem Temperaturanstieg an der Erdoberfläche über das natürliche Maß hinaus, weswegen man in diesem Zusammenhang auch von der globalen Erwärmung spricht. Darin besteht der Kern des Klimaproblems. Hierbei geht es in erster Linie um das Treibhausgas CO2. Die Menschen emittieren derzeit ungefähr 40 Milliarden Tonnen des Gases. Das geschieht in allererster Linie durch die Verfeuerung der fossilen Brennstoffe Kohle, Erdöl und Erdgas zur Energiegewinnung. Dabei ist die Kohle global betrachtet immer noch der am meisten verbrannte fossile Energieträger, zugleich derjenige mit dem größten CO2-Ausstoß pro Energieeinheit und der mit den größten bekannten Reserven. Der Wasserdampf wirkt als sehr wichtiges Rückkopplungsgas. Er selbst wird nicht in nennenswerten Mengen von den Menschen ausgestoßen. Der Anteil des Wasserdampfs in der Luft erhöht sich allerdings, wenn sich die Lufttemperaturen infolge des Anstiegs der anderen Treibausgase wie etwa des CO2 erhöhen, was die Erwärmung durch die von den Menschen ausgestoßenen Treibhausgase erheblich verstärkt.
In den Jahrhunderten vor dem Beginn des Industriezeitalters war die Strahlungsbilanz der Erde in etwa ausgeglichen. Die globale Durchschnittstemperatur an der Erdoberfläche war recht stabil und nur geringen Schwankungen unterlegen. Die Temperatur ging von der Mittelalterlichen Warmzeit vor etwa tausend Jahren bis zum späten 19. Jahrhundert infolge einer etwas geringeren Sonneneinstrahlung und verstärkter Vulkanaktivität um ein paar Zehntel Grad Celsius zurück. Danach kehrte sich der Trend um und die Erde erwärmte sich, wobei sich der Erwärmungstrend mit der Zeit noch beschleunigt hat und in den letzten Jahrzehnten besonders stark gewesen ist. Inzwischen verzeichnen wir Rekordtemperaturen (Abbildung 1). Allein in den letzten 50 Jahren hat sich die Erdoberfläche um etwa 1 Grad Celsius erwärmt, was zumindest für die letzten zwei Jahrtausende einmalig ist, für die wir sehr gute Rekonstruktionen der Temperaturen besitzen, und mit einiger Wahrscheinlichkeit selbst für die letzten hunderttausend Jahre.
Abbildung 1: Die Temperaturen an der Erdoberfläche (°C) als Abweichung der Temperaturen in der vorindustriellen Zeit (1850–1900). Das Jahr 2023 war mit Abstand das bisher wärmste Jahr. Links seit 1850 und geglättet mit einem Fünf-Jahres-Filter (der schraffierte Bereich gibt die Unsicherheit an), rechts Jahreswerte seit 1967 (die Unsicherheit ist mit Punkten dargestellt).12
Nach einem deutlichen Anstieg in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts kühlten sich die globalen Durchschnittstemperaturen nach 1940 um etwa 0,2 °C ab und blieben bis 1970 auf einem niedrigen Niveau; danach begannen sie wieder rasch anzusteigen. Klimaskeptiker behaupten, dass die Erwärmungspause in der Mitte des 20. Jahrhunderts von ungefähr 1940 bis 1970 nach dem Anstieg der Temperatur zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Beweis gegen den Einfluss von CO2 auf die Temperatur sei. Schließlich seien die CO2-Konzentrationen in der Zeit der Erwärmungspause weiter angestiegen, weswegen die globale Erwärmung nicht menschlichen Ursprungs sein könne. Die Abkühlung in der Mitte des Jahrhunderts ist weitgehend auf eine außergewöhnlich hohe Konzentration sogenannter Sulfataerosole in der Atmosphäre zurückzuführen, die durch industrielle Aktivitäten und durch Vulkanausbrüche freigesetzt werden. Sulfataerosole wirken sich kühlend auf das Klima aus, weil sie das Licht der Sonne streuen und ihre Energie teilweise zurück ins All reflektieren. Der Anstieg der Sulfataerosole war weitgehend der Zunahme der industriellen Aktivitäten am Ende des Zweiten Weltkriegs geschuldet. Darüber hinaus erzeugte der gewaltige Ausbruch des Vulkans Mount Agung im Jahr 1963 Aerosole, die die untere Atmosphäre um mehrere Zehntel Grad Celsius abkühlten, während die Sonnenaktivität nach einem Anstieg zu Beginn des Jahrhunderts abflachte. Die in Europa und Nordamerika eingeführten Gesetze zur Luftreinhaltung verringerten die Emissionen von Aerosolen signifikant. Als die Aerosolwerte in der Atmosphäre sanken, wurde ihre kühlende Wirkung bald durch die wärmende Wirkung der stetig ansteigenden atmosphärischen Treibhausgaskonzentrationen übertroffen. Die Erklärung der Erwärmungspause in der Mitte des 20. Jahrhunderts auf der Basis der Sulfataerosole wird nicht nur von den Beobachtungen, sondern auch von zahlreichen Klimamodellen gestützt, die den beobachteten Temperaturverlauf an der Erdoberfläche seit 1850 – trotz gegenteiliger Behauptungen aus der Klimaskeptikerszene – realistisch simulieren. Klimamodelle, die lediglich natürliche Faktoren wie die Sonnenaktivität und Vulkanausbrüche berücksichtigen, geben die Temperaturen des 20. Jahrhunderts nur ungenügend wieder und zeigen keinen nennenswerten Erwärmungstrend. Wenn die Modelle die menschlichen Treibhausgas- und Aerosolemissionen mit einbeziehen, simulieren sie die historische Temperaturentwicklung einschließlich der Erwärmungspause recht gut.
An dieser Stelle möchte ich einen kleinen Exkurs machen und die Frage erörtern, was es eigentlich mit der globalen Durchschnittstemperatur auf sich hat, die im Zentrum der Debatte steht. Ich bekomme des Öfteren zu hören, dass es aus verschiedenen Gründen nicht sinnvoll sein kann, eine Durchschnittstemperatur für die gesamte Erdoberfläche zu definieren. Das Konzept einer über den ganzen Globus gemittelten Temperatur mag in der Tat seltsam erscheinen. Schließlich können sich zu einem Zeitpunkt die höchste und die niedrigste Temperatur an der Erdoberfläche um zig Grade Celsius voneinander unterscheiden. Die Temperaturen schwanken von Nacht zu Tag und zwischen den jahreszeitlichen Extremen in der nördlichen und südlichen Hemisphäre. Das bedeutet, dass einige Teile der Erde recht kalt sein können, während es in anderen Teilen unerträglich heiß ist. Von einer durchschnittlichen Temperatur zu sprechen, mag daher auf den ersten Blick als unsinnig erscheinen. Das Konzept einer globalen Durchschnittstemperatur ist jedoch praktisch, um vergangene Veränderungen im Energiehaushalt der Erde zu erkennen. Wenn die einfallende Sonnenenergie durch einen gleich großen Wärmeverlust in den Weltraum ausgeglichen ist, befindet sich die Erde im Strahlungsgleichgewicht, und die globale Temperatur ist relativ stabil. Alles, was die Menge der ein- oder ausgehenden Energie erhöht oder verringert, stört das Strahlungsgleichgewicht der Erde; die global gemittelte Temperatur steigt oder fällt daraufhin, wobei es wegen der trägen Meere eine Zeitverzögerung gibt. Der Anstieg der Treibhausgase in der Atmosphäre durch menschliche Aktivitäten hat in den letzten Jahrzehnten zu einer positiven Imbalance im Energiehaushalt der Erde geführt, die durch Satellitenmessungen belegt ist und einen Anstieg der Durchschnittstemperatur an der Erdoberfläche nach sich ziehen muss, die wir auch beobachten. Schließlich sei erwähnt, dass die Definition einer Durchschnittstemperatur auch für politische Verhandlungen sehr hilfreich ist.
Der Grund für die globale Erwärmung der letzten Jahrzehnte ist demnach der Ausstoß von Treibhausgasen durch die Menschen, hauptsächlich von CO2, dessen kumulativer Klimaeffekt sich jetzt in aller Deutlichkeit zeigt. Der Gehalt des Gases in der Atmosphäre ist beispiellos in der Geschichte der Menschheit. Die CO₂-Werte, die wir heute in der Luft messen, gab es zuletzt vermutlich vor 14 Millionen Jahren.13 Allein dieser Sachverhalt sollte uns Menschen wachrütteln. Wir nehmen die Information aber nur stoisch zur Kenntnis, wohlwissend, dass in der Vergangenheit sehr hohe Treibhausgaskonzentrationen auch Phasen sehr hoher Temperaturen an der Erdoberfläche gewesen sind.
Der Anteil des CO2 in der Atmosphäre erreicht Jahr für Jahr historische Höchststände, obwohl dessen Konzentration schon seit Jahrzenten weit außerhalb der natürlichen Schwankungsbreite während der letzten Jahrmillionen liegt. Auch die Anstiegsrate des atmosphärischen CO2-Gehalts, in der Wissenschaft als CO2-Wachstumsrate bezeichnet, ist einmalig. Der CO2-Gehalt der Luft ist um etwa 50 Prozent gegenüber der vorindustriellen Zeit angestiegen. Zum Vergleich: Die atmosphärische Kohlendioxidkonzentration lag in den 10 000 Jahren vor der industriellen Revolution recht konstant bei ungefähr 280 ppm.14 Heute messen wir schon ca. 420 ppm. Das scheint aber kaum jemanden zu interessieren. Der Anstieg der Treibhausgase in der Atmosphäre ist den Medien kaum noch eine Nachricht wert, obwohl uns Menschen ob der ihresgleichen suchenden Veränderung in der Zusammensetzung der Atmosphäre die Alarmglocken läuten müssten.
Daten für sich allein erzeugen halt keine Gefühle oder Emotionen und führen deswegen auch nicht notwendigerweise zum Handeln. Bei Fieber fühlen wir Menschen uns schlecht, weswegen wir im Allgemeinen Maßnahmen ergreifen, um es zu senken. Offenbar geht es der Menschheit noch nicht schlecht genug, wenn es sich um die globale Erwärmung handelt, obwohl die Erdtemperatur durch menschliche Aktivitäten im Mittel schon um mehr als ein Grad Celsius angestiegen ist und die Auswirkungen der Erwärmung deutlich spürbar sind. Das Klimaproblem ist so gesehen tatsächlich so etwas wie ein Test für die Weisheit der Menschen, wie es Maurice Strong 1972 in seiner Eröffnungsrede auf der Stockholm-Konferenz ausgedrückt hatte, als er die Delegierten fragte, ob die Menschen weise genug wären, das zu tun, was sie für ihr Wohlergehen tun müssten.
Die Scharlatane dieser Welt, die die menschliche Klimabeeinflussung bestreiten, sind in der öffentlichen Diskussion ziemlich präsent und vor allem laut, sodass die wissenschaftlichen Erkenntnisse in der öffentlichen Debatte unterzugehen drohen und die Gefahr besteht, dass sie als nur eine Meinung unter vielen wahrgenommen werden. Die sogenannten Argumente der Klimaleugner sind seit Jahren widerlegt, weswegen ich hier nicht weiter auf sie eingehen werde. Es hält sich jedoch hartnäckig eine Erzählung gegen die menschliche Klimabeeinflussung, die ich an dieser Stelle aufgreifen möchte, weil ich mit ihr in den letzten Jahren des Öfteren konfrontiert worden bin, unter anderem auch von Forschenden aus Disziplinen jenseits der Klimaforschung. Ein Beweis dafür, dass CO2 nicht der Hauptgrund für die Erwärmung auf unserem Planeten ist, würde durch die zeitgleiche Erwärmung anderer Planeten und Monde in unserem Sonnensystem geliefert, obwohl diese offenkundig keine menschlichen Emissionen von Treibhausgasen hätten. Deswegen sei es die Sonne, die die Erwärmung auf der Erde verursache.
Zunächst einmal: Die Planeten und Monde, von denen behauptet wird, dass sie sich erwärmen, sind insgesamt nur acht von Dutzenden von großen Himmelskörpern in unserem Sonnensystem. Es gibt zudem bei einigen der infrage stehenden Planeten wie Mars und Jupiter überhaupt keine belastbare Beobachtungsevidenz dafür, dass sie sich tatsächlich erwärmen. Und schließlich – und das ist das gewichtigste Argument gegen die Sonne als Treiber der globalen Erwärmung – hat die Leuchtkraft der Sonne seit 1950 leicht abgenommen, und damit hat die Sonne in den letzten Jahrzehnten einen abkühlenden Effekt gehabt. Zuletzt noch diese Information: Alle äußeren Planeten in unserem Sonnensystem besitzen wesentlich längere Umlaufzeiten als die Erde. Saturn und seine Monde zum Beispiel brauchen 30 Erdjahre, um die Sonne zu umkreisen, sodass drei Jahrzehnte Beobachtungen nur einem Saturnjahr entsprechen. Uranus hat eine 84-jährige Umlaufbahn und eine Achsneigung von 98 Grad, sodass seine Jahreszeiten extrem sind. Der Planet dreht sich wie ein umgekippter Kreisel. Das bedeutet, dass die Sonne manchmal direkt über den Polen steht. Neptun schließlich hat seit seiner Entdeckung im Jahr 1846 gerade mal etwas mehr als eine Umlaufbahn um die Sonne vollendet. Die Klimaveränderungen auf den äußeren Planeten unseres Sonnensystems können also schlicht jahreszeitlicher Natur sein.
Halten wir fest: Die globale Erwärmung, die wir seit Beginn des Industriezeitalters beobachten, ist durch den Ausstoß von Treibhausgasen durch die Menschen verursacht. Oftmals haben die angeblichen Beweise gegen den menschlichen Einfluss einfach nur den Anschein von Wissenschaftlichkeit, bei denen einem bei näherer Betrachtung die Haare zu Berge stehen. All die sogenannten Beweise, die den Faktor Mensch bei der Erklärung der globalen Erwärmung wegzudiskutieren versuchen, halten einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht stand, stammen aus dubiosen Quellen15 und nicht aus der wissenschaftlichen Literatur, beruhen auf der Fehlinterpretation von Messdaten, oder sie sind das Resultat von falschen Annahmen in den Berechnungen oder haarsträubenden physikalischen Fehlern.
In voller Fahrt
Der Großteil der globalen Erwärmung von inzwischen deutlich mehr als 1 Grad Celsius gegenüber der vorindustriellen Zeit wurde in den letzten Jahrzehnten beobachtet (Abbildung 1). Das Jahr 2023 ragte dabei in fast jeder Hinsicht heraus und hatte es wirklich in sich. Es war ein Warnsignal für die Welt im Hinblick auf die Dringlichkeit von Klimaschutzmaßnahmen – und ein ganz besonders lautes dazu. So war 2023 auch das Jahr mit den bisher historisch höchsten fossilen CO2-Emissionen.16 Es war darüber hinaus das Jahr mit der heißesten Durchschnittstemperatur an der Erdoberfläche seit Beginn der flächendeckenden Messungen 1850. Die Temperatur hatte am 17. November 2023 die 2-Grad-Marke übertroffen, wie das europäische Erdbeobachtungsprogramm Copernicus mitteilte.17 Dieser Novembertag war der allererste Tag überhaupt, an dem die globale Durchschnittstemperatur um 2 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau gelegen hatte. 2 Grad ist die Grenze, die nach den Erkenntnissen der Wissenschaft besser nicht dauerhaft überschritten werden sollte, um unliebsame Überraschungen wie zum Beispiel das Überschreiten von Kipppunkten zu vermeiden, deren Eintrittswahrscheinlichkeit ab einer globalen Erwärmung von 2 Grad Celsius extrem zunehmen würde. Aus diesem Grund steht die 2-Grad-Grenze auch als Hauptziel im Pariser Klimaabkommen aus dem Jahr 2015. Das Abkommen scheint allerdings bis zum heutigen Tag von den Staaten nicht so richtig ernst genommen zu werden, obwohl sie es doch unterschrieben hatten. Die Länder spielen eine Art Klimamikado. Die meisten Länder sehen in keiner Weise ein, dass gerade ihr Land jetzt Klimaschutzanstrengungen unternehmen sollte, und warten darauf, dass andere Länder den Anfang machen. Die Folge dieser Untätigkeit sind die immer weiter ansteigenden Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre und die unvermindert voranschreitende Erderwärmung.
Die lauen Klimaschutzanstrengungen der Länder haben vielfältige Gründe, wobei einer von ihnen die natürliche Variabilität des Klimas ist. Viele Menschen, darunter auch einige führende Politikerinnen und Politiker, haben immer noch den Eindruck, dass es mit der Erderwärmung nicht so weit her sein kann. Schließlich kommen doch immer noch recht kalte Temperaturen vor. Man wundert sich beispielsweise auch, wenn die Temperaturen an der Erdoberfläche ein paar Jahre lang nicht ansteigen. Macht die Klimaerwärmung eine Pause oder hat sie vielleicht ganz aufgehört? Umgekehrt stellt sich vielen Menschen die Frage, ob sich die Klimaerwärmung nach einem besonders warmen Jahr beschleunigt hat. Letzteres war gerade 2023 der Fall, als neue Rekordtemperaturen an der Erdoberfläche im Gebietsmittel vieler Länder und auch bei uns in Deutschland gemessen wurden. Viele Menschen waren in Sorge, ob vielleicht ein Kipppunkt überschritten worden sei, und auch die Medien thematisierten die Frage einer sich beschleunigenden Erderwärmung. Ich sehe derzeit weder das eine noch das andere, d. h. für mich läuft die globale Erwärmung nach »Plan«, also so, wie es von den Klimamodellen schon vor vielen Jahren unter der Annahme weiter ansteigender atmosphärischer Treibhausgaskonzentrationen vorhergesagt worden war.