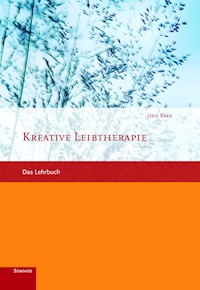14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Semnos
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Nach den viel beachteten Fachbüchern über Kunst- und Gestaltungstherapie (Gefühlssterne, Angstfresser, Verwandlungsbilder ...) sowie Tanz- und Bewegungstherapie (Leibbewegungen, Herzkreise und der Tanz der Würde) stellen Udo Baer und Gabriele Frick-Baer ein Fachbuch vor, in dem sie ihre praktischen Erfahrungen, Methoden und theoretischen Modelle der Musiktherapie vorstellen. Wie immer praxisbezogen, handfest, verständlich. Das Buch wendet sich ausdrücklich nicht nur an Musiktherapeut/innen, sondern auch an alle anderen Therapeut/innen, die Interesse haben, Klänge in ihre Arbeit mit Menschen einzubeziehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Fachbücher therapie kreativ
Band 3
Klingen, um in sich zu wohnen
Methoden und Modelle leiborientierter Musiktherapie
Band 3.1: Vom klingenden Namensbild bis zum musikalischen Dialog
Baer, Udo / Frick-Baer, Gabriele
Klingen, um in sich zu wohnen: Methoden und Modelle leiborientierter Musiktherapie
Band 3.1: Vom klingenden Namensbild bis zum musikalischen Dialog
Neukirchen-Vluyn : 2. Auflage 2009 in 2 Bänden
ISBN 978-3-934933-45-3
© 2009 Affenkönig Verlag, Neukirchen-Vluyn
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Lore Remke, Unna / Barbara Meier, Bonn
Satz: TRITUM, Jena
Schneider Visuelle Kommunikation unter
Verwendung eines Bildes von © Klaus Schneider
eBook-Herstellung und Auslieferung:Brockhaus Commission, Kornwestheimwww.brocom.de
Udo Baer, Gabriele Frick-Baer
Klingen, um in sich zu wohnen
Methoden und Modelle leiborientierter Musiktherapie
Band 3.1: Vom klingenden Namensbild bis zum musikalischen Dialog
Gabriele Frick-Baer
Neukirchen-Vluyn – Jg. 1952. Dipl. Pädagogin, Kreativer Leibtherapeut (HPG). Mitbegründerin der Zukunftswerkstatt therapie kreativ. Sie arbeitet seit vielen Jahren in therapeutischer Praxis und als Leiterin von Seminaren und Ausbildungsgruppen in künstlerischen Therapien, u. a. in Kreativer Traumatherapie. Autorin zahlreicher Fachbücher und Artikel.
www.therapie-kreativ-baer.de
Udo Baer
Neukirchen-Vluyn – Jg. 1949. Dr. phil., Dipl. Pädagoge, Kreativer Leibtherapeut (HPG). Leiter der Zukunftswerkstatt therapie kreativ, die er auch mitbegründete. Er arbeitet seit vielen Jahren in therapeutischer Praxis und leitet Aus- und Fortbildungen in künstlerischen Therapien. Zahlreiche Veröffentlichungen. www.zukunftswerkstatt-tk.de
Inhalt
Band 3.1:
Vom klingenden Namensbild bis zum musikalischen Dialog
Der Blick über den Tellerrand oder: Falsche Bescheidenheit
Kleiner Essay als Einleitung für ein großes Buch Hans-Helmut Decker-Voigt
Vorwort
1 Wer bin ich? – Musiktherapeutische Wege der Selbstwahrnehmung und Selbstwertschätzung
1.1 Das klingende Namensbild
1.2 Die sechs Kostbarkeiten
1.3 Die Stimme der eigenen Kostbarkeit
1.4 Die eigene Stimme als Zugang zum Ich
1.5 Klänge, Instrumente, musikalische Parameter
2 Die musikalische Biografie
2.1 Mein Leben – meine CD
2.2 The best of
2.3 Instrumenten-Parcours
2.4 Filmmusik
2.5 Zurückhören
2.6 Die alte Szene in der neuen
2.7 Wie man musizieren gelernt hat
2.8 Die soziale Dimension der musikalischen Biografie
2.9 Coping
3 Leibbewegungen in der Musiktherapie
3.1 Leibregungen und Leibbewegungen
3.2 Raum- und Richtungs-Leibbewegungen
3.2.1 Vor (vorne) – zurück (hinten)
3.2.2 Rechts – links
3.2.3 Hinein (innen) – hinaus (außen)
3.2.4 Hinauf (oben) – hinunter (unten)
3.3 Konstitutive Leibbewegungen
3.3.1 Ruhig – unruhig
3.3.2 Diffus – prägnant
3.3.3 Eng (engen) – weit (weiten)
3.3.4 Gespannt (spannen) – gelöst (lösen)
3.3.5 Lebendig – unlebendig
3.3.6 Laut – leise
3.3.7 Andere Konstitutive Leibbewegungen
3.4 In sich wohnen – sich fremd sein
3.5 Zehn Hinweise und Tipps
4 Affektive Leibregungen
4.1 Befinden, Stimmung, Gefühl
4.2 Atmosphären
4.3 Mit Stimmungen spielen
4.4 Gefühle und „Gefühle“
4.5 Gefühlsstern
4.6 Grammatik der Gefühle
4.6.1 Gefühle „umtauschen“
4.6.2 Gefühle „ohne Grund“
4.6.3 Delegierte Gefühle
4.6.4 Gefühle: sowohl als auch
5 Erregungskonturen
5.1 Tinas Crescendos
5.2 Erregungskonturen im Überblick
5.3 Erlebnisöffnende Zugänge und Therapiehinweise
6 Musikalisches Verraumen
6.1 Warum Verraumen funktioniert
6.2 Musiktherapeutische Arbeit mit den Bedeutungsräumen
6.3 Dreier-Formen des musikalischen Verraumens
6.3.1 Die Schamsonate
6.3.2 Die Sonatenform
6.3.3 Andere Dreier-Formen
6.4 Musikalisches Verraumen leiblicher Regungen und Themen
6.4.1 Gefühle
6.4.2 Körper
6.4.3 Prozesse
6.4.4 Übergänge, Zwischenräume, Grenzen
6.4.5 Der sichere Ort
6.4.6 „Banale“ Themen
7 Familien- und andere Beziehungsstrukturen
7.1 Musikalische Identifikation
7.2 Sozialverraumen
7.3 Beziehungskalimba
8 Körperklänge, Körperbilder
8.1 Grundlagen: Körperschema, Körperbild, Körperbildarbeit
8.2 Wege zu Körperbild und Körperklang
8.2.1 Systematische Körperbildarbeit
8.2.2 „Körperklang“ beim Wort genommen
8.2.3 Weiterarbeit mit den Bildern und Klängen des Körpers
8.2.4 Fragmentiertes Körperbild
8.3 Gesundheit – Krankheit – Psychosomatik
9 Ständchen
10 Musikalische Dialoge
10.1 Musikalischer Dialog im therapeutischen Prozess
10.2 Tridentität
10.2.1 Offenheit und therapeutische Absicht
10.2.2 Nährender Dialog
10.2.3 Spiegelnder Dialog
10.2.4 Dialog im Gegenüber
10.2.5 Fallen im musikalischen Dialog
10.3 Mit Resonanzen spielen
10.3.1 Kontakt und Resonanz
10.3.2 Resonanzen im musikalischen Dialog
10.3.3 Resonanzbereitschaft und Schwingungsfähigkeit
10.3.4 Resonanzverläufe und Resonanzmuster
10.3.5 Resonanzebenen
Der Blick über den Tellerrand oder Falsche Bescheidenheit
Kleiner Essay als Einleitung für ein großes Buch Hans-Helmut Decker-Voigt
Leiborientierte Musiktherapie – ein Brückenschlag
„Leiborientierte Musiktherapie“ schildert dies Buch. Eine neue Methodenbezeichnung?
Ist damit das Rad (der Musiktherapie) – wieder einmal neu erfunden? Eine neue, weitere der mindestens zwölf „Schulen der Musiktherapie“, wie sie sich gegenwärtig allein im deutschsprachigen Bereich zeigen? Auf dem mühsamen Weg zu einem einigermaßen gemeinsamen Profil gegenüber dem Arbeitgeber Gesundheitswesen?
Dann wäre dieses neue Rad eines, das den Weg der Musiktherapie hin zu einem selbstständigen Heilberuf im Gesundheitswesen der Zukunft eher mühsamer werden ließe, zum Bremsweg, denn als Erleichterung auf diesem Weg.
Ein solches Rad ist sie nicht, diese in diesem Buch vorgestellte leiborientierte Musiktherapie, bei der nur die Begrifflichkeit vielleicht für manche musiktherapeutisch Informierte oder Profis neu sein mag.
Was die Autoren hinter dem Reichtum ihrer Praxismodelle an Menschenbild und Theoriebildung schildern (ab Kapitel 19) ist mehr als nur ein Verwandter 1. Grades „der“ Musiktherapieszene. Denn tiefenpsychologisch-phänomenologisches Empfinden, Wahrnehmen, Denken und therapeutisches Handeln sind Udo Baer und Gabriele Frick-Baer ebenso „eigen“ wie den meisten der ausgebildeten Musiktherapeuten. Zu denen sich die beiden Autoren im respektvoll-bescheidenen Abstand halten, wenn sie hoffen, dass dieses Buch denen Anregungen geben kann, die mit Musik im psychotherapeutischen Prozess arbeiten. Darunter auch MusiktherapeutInnen.
Zuviel der Bescheidenheit. Ich kann für die Musiktherapie-Szene nur hoffen, dass dieses Buch ebenso positiv überraschte Leser findet – wie ich einer wurde, dem während des Arbeitens mit diesem Buch das deltahafte Gefühl geschenkt wurde, über den Tellerrand der im engeren Sinne musiktherapiespezifischen Fachveröffentlichungen hinausgucken zu können. Fachveröffentlichungen, die für das heutige Profil der Musiktherapie in Forschung und Lehre zwar existentiell wichtig waren und sind, die aber doch – wie in allen Fächern mit zu hohem Tellerrand – von einem ziemlich gleichbleibenden, manchmal inzestuös anmutenden Autorenkernkreis gespeist werden.
Es ist ein Opus magnus, ein großes Werk, was Udo Baer und Gabriele Frick-Baer hiermit der Fachöffentlichkeit vorstellen. Einmal quantitativ, weit mehr noch qualitativ, das die Vielfalt der Musiktherapien nicht anreichert, sondern vorhandene Distanzen zwischen bestehenden Musiktherapien verringern hilft. Besonders die Distanz zwischen den Musiktherapien, die vor dem Hintergrund der Psychoanalyse, der Verhaltenstherapie und der Humanistischen Psychologie gewachsen sind.
Ein Methoden-Schatz und wie er zu heben ist
Methodisch finden Leser, die ohnehin mit aktiver Improvisation oder mit rezeptiven Verfahren der Musiktherapie arbeiten, einen Schatz von weiterführenden oder überraschenden Praxismodellen vor, die in bestehendes Methodenrepertoire integriert werden können.
Beispiele, die ich als Erweiterung, Veränderung, Varianten bestehender musiktherapeutischer Praxismodelle (etwa die von Fritz Hegi, Isabelle Frohne-Hagemann und von mir, s. Literaturverzeichnis) sehe:
das Arbeiten mit der musikalischen Biografie des Klienten (Panorama-Arbeit) in Kap. 2 („Musikalische Biografie“) oder
das Arbeiten mit musikalischen Familien- und anderen Aufstellungen unter systemischen Aspekten (wie sie sich ohnehin durch das Buch durchziehen) in Kap. 7 („Familien- und andere Beziehungsstrukturen“)
das Arbeiten mit Affekten in Kap. 4 („Affektive Leibregungen“). Hier ist für den Leser nur die Akzeptanz der leibphilosophisch begründeten therapeutischen Terminologie nötig, um dahinter vertraute entwicklungspsychologische Begründungen nach Daniel Stern u.a. zu finden. Also „wie bei uns zu haus“ (in der klinischen Musiktherapie). Nur mit dem Vorzug des Überschreitens des Tellerrands
das Arbeiten mit Körperklängen, Körperbildern in Kap. 8 oder
das Arbeiten mit musikalischen Dialogen in Kap. 10.
Beispiele, die ich als neue „Module“ sehe, die im Musiktherapie-Methodenrepertoire ausgezeichnet integrierbar sind:
Das Arbeiten mit den Leibbewegungen des Körpers und der Musik in Kap. 3 (Leibbewegungen in der Musiktherapie) oder
das Arbeiten mit dem „Musikalischen Verraumen“ in Kap. 6 (hocheffizient: „Die Schamsonate“ und „Andere Dreier-Formen“ für das posttraumatologische Arbeiten z. B. in dem wachsenden Bereich der Musiktherapie bei sexuellem Missbrauch oder z. B. in dem Bereich der Frühstörungen durch entgleiste Triangulierungserfahrungen).
Die Bezugsetzung der Musiktherapie zu bestimmter Klientel ist eine gute Reflexion (Kap. 18) und selbst „Banales“ (Kap. 6.3.1) – als solches betitelt – ist es in diesem Buch nicht.
Basismedizinische und neurologische Sicherheiten vermittelt dieses Werk auch durch klare Informationsbündelungen (ab Kapitel 19) – mehr als sie in manchen der „biochemisch-reinen“ analytischen Musiktherapien zu finden sind. Leider.
Wenn ich die Fülle von Praxismodellen dieses Buches hervorhebe, dann heißt dies: Kein Rezept. Vielmehr der Auftrag an den Nutzer dieses Buches, die von den Autoren geschilderten methodischen Schritte auf den eigenen Praxisrahmen zu beziehen, zu modifizieren, auf die eigene Klientel, die eigenen Patienten zu spezifizieren. Es gibt keine pädagogischen oder therapeutischen Spielmodelle für unveränderten Transfer, sondern immer nur die achtsame, sorgfältige neue Bezugsetzung zum neuen Menschen als Gegenüber in der Einzeltherapie oder der Gruppe.
Ein persönliches Buch, eines, das per-soniert
Das Menschenbild dieser therapeutischen Praxeologie ist nicht nur in den geschriebenen Worten dieses Buches geprägt vom Geist der Humanistischen Psychologie. Vielmehr beeindruckt mich, wie die therapeutischen Begegnungen mit Klienten und Patienten in den zahlreichen Fallvignetten dieses Buches wirklich als „Begegnung“ abstrahlen und den Leser in diese Begegnungen hineinnehmen – im Sinne der „Begegnung“ Martin Bubers oder der gelingenden „Kontaktgestaltung“ im Sinne von Fritz Perls.
Das Buch wärmt und lässt sicher nicht nur mich „die Überraschung“ im Abenteuer des therapeutischen Prozesses mit dem künstlerisch-therapeutischen Medium Musik ebenso miterleben wie die behutsame – von therapeutischem Eros geprägte – Compliance in Einzeltherapien wie in Gruppen.
Hinter diesem Buch stehen die Biographien der beiden Autoren, die mir auffallen, weil sie beide eine besondere Kompetenz für Brückenschläge, für interdisziplinäres Denken und Handeln ausweisen: Von den Diplom-Studiengängen in Erziehungswissenschaft und entsprechender Praxis wanderten und trafen die Autoren sich im intermodalen therapeutischen Umgang mit Tanz, Bewegung, Musik, eingebunden in das therapeutische Gespräch.
Diese Art ihres Umgangs mit den Medien erscheint mir gleichermaßen als Zentrum und Rahmen für die heutige psychotherapeutische Praxis von Udo und Gabriele Frick-Baer und die von ihnen entwickelten Weiter- und Ausbildungsgänge innerhalb ihrer „Zukunftswerkstatt“ sowie in ihren bisherigen Veröffentlichungen (s. Info-Seiten des Verlages am Schluss).
Wem gehört die Musiktherapie?
Angesichts des Reichtums in diesem Werk über die „Leiborientierte Musiktherapie“ stellte sich mir neu die Frage nach dem „Besitz“ der Musiktherapie, wem gehört sie?
Die laute Frage war in den 70er und 80er Jahren noch die zwischen Medizinern einerseits und Musiktherapeuten andererseits. Inzwischen ist diese Frage durch die Entwicklung der Musik als Künstlerische Psychotherapie einerseits und als Musikmedizin (Musik im schulmedizinischen Behandlungskonzept) andererseits friedbringend und kooperativ beantwortet worden.
Dafür tauchte später dieselbe Frage auf zwischen Musiktherapie und Sozialpädagogik. Im Kontext der Sozialpädagogik, der die Klientel von Udo Baer und Gabriele Frick-Baer häufig entstammt, fanden die frühesten Lehrveranstaltungen für Musiktherapie an den neugegründeten Fachhochschulen ab 1971 statt. Denen erst folgten eigenständige Studiengangsgründungen in Heidelberg und Hamburg.
Vor diesem Hintergrund wundert es mich nicht, dass mit der Leiborientierten Musiktherapie in aller Stille und seitab der offiziellen Musiktherapie-Mainstreams eine Akzentuierung entwickelt wurde und hier vorgestellt wird, die vom Menschenbild und dem Methoden-Pluralismus her ihre Wurzeln in diesen frühen Jahren der Musiktherapie findet, in welcher Musiktherapie noch von der Dyade „Psychotherapeutisches Denken – Sozialpädagogisches Denken“ gespeist wurde.
Ich denke nicht, dass die „Leiborientierte Musiktherapie“ einen eigenen Weg gehen sollte und wird. Das will sie auch nicht, wie ich die Autoren verstehe. Aber sie trägt zu einem Ziel bei, das nicht nur ich mir für die Musiktherapie der Gegenwart für die Zukunft wünsche: Dass Musiktherapie-Wissen und Musiktherapie-Praxishilfen eines Tages ähnlich selbstverständliche Bestandteile aller Gesundheitsberufe sind, wie es heutzutage beispielsweise „die Psychologie“ ist. In den frühen Jahren der Profilierungsnöte von Tiefen-Psychologie, Wahrnehmungspsychologie, Entwicklungspsychologie und Klinischer Psychologie achteten diese peinlich darauf, dass ihr Wissen ihr Wissen bleibe. Manche Kompetenz blieb so „Herrschaftswissen“. Teilweise angemessen und richtig, weil auch die Fächer, ihre Menschenbilder, ihre Theorien sich erst bilden und stabilisieren mussten.
Heute ist es für jede Ausbildung als Erzieherin, als Ergotherapeutin, als Ärztin und Pädagogin, also in jedem Interaktionsberuf, selbstverständlich, dass psychologisches Wissen mit vermittelt wird – ohne sich mit Psychologen verwechseln zu wollen und zu dürfen.
Dieses wünsche ich mir auch für Musiktherapie-Wissen und bestimmte Praxis-Anwendungen: Eingang zu finden in alle Ausbildungen und Weiterbildungen, in denen es um die Begleitung von Menschen geht.
Einige Musiktherapeuten kultivieren und präsentieren ihr Wissen heutzutage – immer noch – aus dem Elfenbeinturm heraus.
Natürlich müssen wir darauf achten, das berufspolitische Profil der Musiktherapeuten sorgsam zu hüten und weiter zu schärfen, indem Musiktherapie nicht inflationiert.
Aber ein Buch wie dieses zeigt mir, wie bereichernd, wie konstruktiv Musiktherapie-Wissen und Musiktherapie-Praxis wachsen können – außerhalb der enggefassten klinisch verstandenen Musiktherapie und als Beitrag für sie.
Eines Tages werden wir Musiktherapie dank der professionellen Musiktherapeuten und dank Menschen wie Udo Baer und Gabriele Frick-Baer als selbstverständliches Wissen in hoffentlich vielen anderen Interaktionsberufen finden. In denen, die sich die Prägung und Entwicklung und Begleitung menschlicher Persönlichkeit nicht ohne Musik und ihre therapeutische Wirkung vorstellen können.
Diese jetzt vorliegende „Leiborientierte Musiktherapie“ wird hoffentlich von vielen Musiktherapeuten gewürdigt – ganz sicher auch und hoffentlich durch konstruktive Kritik in Rezensionen und Diskussionen. Kritik, die in diesem Essay nicht sinnvoll platziert ist, weil er dieses Buch „wärmstens empfiehlt“. Nicht als neuerfundenes Rad, nicht als Non-plus-ultra, nicht als bremsendes fünftes Rad am Wagen der Musiktherapie. Sondern als Rad, das das Rollen des Wagens stabilisieren hilft, flexibler sein lässt.
Eben – über den Rand hinaus. Nicht des Tellers, sondern der Welt der Musiktherapie, die für manche eben doch noch eine Scheibe ist.
Hans-Helmut Decker-Voigt, Prof. Dr., ist Direktor des Instituts für Musiktherapie der Hochschule für Musik und Theater, Präsident der Akademie für Weiterbildung in Musiktherapie und künstlerischer Psychotherapie der Herbert von Karajan-Stiftung Berlin und Verfasser zahlreicher, in sieben Sprachen übersetzter Standardwerke zur Musiktherapie und zur Wechselbeziehung von Mensch und Musik.
www.decker-voigt-archiv.de
Vorwort
„Wie geht es Ihnen?“
Der Klient zuckt mit den Schultern. „Ich weiß nicht.“
Und schweigt. Nach zwei Minuten: „Mit mir ist nichts los.“
Der Therapeut fragt nach, versucht Kontakt herzustellen, fragt z. B. nach den Ereignissen der letzten Tage und erhält als Antwort: „Nichts Besonderes.“ Er erkundigt sich, wie der Klient gerade seinen Körper spürt, und erhält als Antwort wieder ein Schulterzucken: „Gar nicht.“ Er fragt danach, was der Klient gerade denkt, und wieder kommt ein Schulterzucken: „Nichts. Da ist alles leer.“
Der Therapeut ist zunächst ratlos. Schließlich sagt er (man kann’s ja mal versuchen): „Wie klingt denn das Nichts? Wie klingt denn die Leere? Nehmen Sie ein Instrument und versuchen Sie, das Nichts oder die Leere erklingen zu lassen.“
Der Klient schaut auf und blickt fragend zu den Musikinstrumenten.
„Soll ich Ihnen ein Instrument bringen?“ fragt der Therapeut.
Der Klient nickt. Der Therapeut bringt dem Klienten, der mittlerweile in Bewegungslosigkeit nahezu erstarrt ist, das große Monochord und stellt es aufrecht vor ihn hin. Dieser hebt langsam die rechte Hand und zupft an einer Saite. Sein Gesichtsausdruck wirkt überrascht, als er den klaren, fast kraftvollen Ton vernimmt. Er lauscht lange dem Nachhall. Und noch einmal greift er in die Saite, stärker noch als beim ersten Mal. Dem Therapeuten scheint es wie eine Klage – oder eher noch wie ein Hilferuf – zu klingen.
Nachdem der Klient seinen Klang ein drittes Mal ertönen lässt, schaut er den Therapeuten an. Der Therapeut fragt: „Darf ich antworten?“ Der Klient nickt stumm.
Der Therapeut setzt sich auf die andere Seite des Monochords und antwortet auf den Ton des Klienten, indem er – leiser und weniger dynamisch als der Klient – über drei Saiten des Monochords streicht. Und wieder der Klang des Klienten, genauso kraftvoll und laut wie vorher, allerdings zieht er diesmal die Hand über die ganze Breite des Monochords. Und erneut antwortet der Therapeut. Ein Kontakt entsteht, hergestellt fast ohne Worte, ein Resonanzprozess hat begonnen, in dessen Entwicklung dieser Klient seiner gebremsten Lebendigkeit, seiner in der Leere, im Nichts versickerten inneren Fülle des Erlebens allmählich auf die Spur kommen kann.
Solche und viele ähnliche Erfahrungen haben unser Interesse geweckt, das Musizieren sowie das Musikhören in unsere therapeutische Praxis einzubeziehen. Wenn Menschen musizieren, erklingt ihr Erleben. Wenn Menschen musizieren, können sie ihr Klingen verändern und damit auch spielerisch Veränderungen ihres Lebens und Erlebens proben. Wenn Menschen musizieren, werden sie hörbar und können Resonanz erfahren. All diese Erfahrungen sind kleine Schritte auf einem großen Weg. Eine an ihrer Magersucht leidende Klientin hat am Ende eines längeren musiktherapeutischen Prozesses gesagt: „Ich habe gelernt zu klingen. Und ich klinge, um in mir zu wohnen.“ Dieser Satz, der die Bemühungen unserer KlientInnen wunderbar zusammenfasst, klingt in unseren Ohren so stimmig, dass wir ihn in den Titel des Buches gestellt haben.
Ein nicht zu behebender Mangel dieses Buches besteht darin, dass es von Klängen, Tönen, Geräuschen, Stimmen handelt – aber nicht hörbar ist. Das, was im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit und Interesses steht und dort seinen gewichtigen Raum einnimmt – eben das Erklingen und Erhörtwerden unserer KlientInnen, findet sich oft nur in einem kurzen, lapidar anmutenden Satz wieder wie: „Lass bitte deine Angst erklingen.“, oder: „Wie hört sich deine Sehnsucht an?“ bzw. „Und dann musizierte sie ihre Wut.“ oder „Er spielte seinen Schmerz auf der Trommel.“ Wir sind darauf angewiesen, dass Sie sich, liebe Leserin und lieber Leser, den Beschreibungen musiktherapeutischer Prozesse öffnen, ihrer musikalischen Fantasie freien Lauf lassen und ihr Beachtung und Bedeutung schenken.
Im Unterschied wohl zu den meisten MusiktherapeutInnen waren wir beiden AutorInnen nicht zuerst MusikerInnen und haben uns dann zu MusiktherapeutInnen entwickelt. Ich, die Autorin, habe meine musikalische Ausbildung in Flöten-, Klavier- und Geigenspiel über das Jugendorchester hinaus nicht fortgesetzt. Ich, der Autor, habe zwar musikalische Wurzeln in meiner Kindheit, aus denen jedoch auf Grund von wechselhaften Lebensumständen, v. a. der Flucht aus der damaligen DDR, lange Jahre nichts weiter erwuchs. Zwei unserer beider Lebensträume, die nicht in Erfüllung gehen werden, hängen mit Musik als Kunst zusammen: Die eine von uns wäre gerne Sängerin, der andere Saxophonist – beide umkreisen wir diesen Traum in seinen zartesten Anfängen mit Scheu. Umso glücklicher schätzen wir uns, dass wir uns andere Lebensträume erfüllen konnten, unter anderem den, mit aller Leidenschaft TherapeutInnen zu sein, die Musik als bereicherndes Element in ihre Arbeit einbeziehen können. Therapeutisch haben wir immer nach Möglichkeiten des Ausdrucks und der Kommunikation, die über die Alltagsworte hinaus reichen, gesucht und uns anfangs auf die künstlerische Gestaltung sowie das Körpererleben und den Tanz konzentriert. In diesen Fachbereichen haben wir uns um grundlegende Modelle und Konzepte bemüht, wie Sie bei Interesse u. a. unseren Büchern: „Gefühlssterne, Angstfresser, Verwandlungsbilder …“ (Kunst- und Gestaltungstherapie) und „Leibbewegungen“ (Tanztherapie) entnehmen können. In unserer Reihe „Bibliothek der Gefühle“ finden Sie unsere professionelle Liebe zu allen therapeutisch zu nutzenden Medien wie Kunst und Gestaltung, Bewegung und Tanz, Musik und Poesie wieder. In der Therapie ging und geht es uns immer darum, das Erleben des Menschen und all seine Lebensäußerungen ernst zu nehmen. Da das Äußern von Tönen eine Lebensäußerung ist (wir bezeichnen sie als eine der „Primären Leibbewegungen“), erzwang die innere Logik des therapeutischen Prozesses, der Musik Beachtung zu schenken und Respekt zu zollen. Wir wurden immer mutiger und sicherer bzw. wir gewöhnten uns an unsere Unsicherheiten und wurden gleichzeitig experimentierfreudiger. Wir begannen, unser methodisches Spektrum zu erweitern. Wir lernten und lernen vor allem von den KlientInnen – unter ihnen neben völlig „Ungeübten“ auch MusikerInnen und (angehende) MusiktherapeutInnen – und freuen uns daran, welche kreativen Lösungen sie gemeinsam mit uns finden, das, was sie bewegt, erklingen zu lassen.
So entstanden aus der Wertschätzung des Musizierens in der therapeutischen Arbeit einige Methoden und Praxisansätze, die im Rahmen unserer Ausbildungen bei der Zukunftswerkstatt Tanz, Musik und Gestaltung und darüber hinaus auf Interesse stießen.
In diesem Buch möchten wir deshalb unsere Erfahrungen so vorstellen, dass Kolleginnen und Kollegen davon Nutzen haben. Wir hoffen, MusiktherapeutInnen die eine oder andere Anregung geben zu können, und wünschen uns, auch TherapeutInnen, die keine ausgebildeten MusikerInnen oder MusiktherapeutInnen sind, Mut zu machen, Elemente des Musizierens und Musikhörens in ihre therapeutische Arbeit zu integrieren.
Im Mittelpunkt dieses Buches stehen also vor allem methodische Anleitungen, die wir anhand von Praxisberichten demonstrieren (Band 1), oftmals bereits verwoben mit den spezifischen theoretischen Grundlagen, soweit sie unserer Auffassung nach das Verständnis erweitern helfen. Dort gibt es auch praktische Hilfen, Haltungen, Handreichungen, die weder spezifische Methoden noch theoretische Grundlagen betreffen. Sie betreffen die Arbeit mit bestimmten Personengruppen, Hinweise zum therapeutischen Prozess, besondere niedrigschwellige Zugänge für Menschen mit Hemmungen, sich musikalisch auszudrücken, und anderes mehr.
Wir haben unsere Erläuterungen mit zahlreichen Beispielen aus unserer therapeutischen Praxis illustriert und belegt. Da wir unsere praktischen Erfahrungen überwiegend in der Einzeltherapie und in Seminaren machen, stammen die meisten Beispiele aus diesem Feld. Wir haben auch Erfahrungen in der institutionellen Therapie, in unterschiedlichem Maße, in der Psychiatrie zum Beispiel mehr als mit Behinderten. Wir wissen aber, dass viele Musikoder andere TherapeutInnen mit KlientInnen oder PatientInnen arbeiten, die sich nicht – wie die meisten unserer KlientInnen – mehr oder weniger „freiwillig“ in Therapie begeben und Veränderungen suchen. Wir sind uns dennoch sicher, dass die meisten der vorgestellten Methoden, wenn auch nicht alle und wenn auch abgewandelt, in der Forensik oder psychiatrischen Klinik, mit Behinderten oder Verstummten möglich sind. Da in den meisten Methodik-Kapiteln diese Erfahrungen in den Beispielen nur einen beschränkten Platz finden, haben wir den niedrigschwelligen musiktherapeutischen Verfahren und der Arbeit mit bestimmten Personengruppen in Kapitel 18 einen besonderen Raum gegeben.
Eine der Quellen unserer musiktherapeutischen Arbeit ist das Erleben der Musik oder, besser gesagt, des Musizierens und Musikhörens. Das, was dem Musizieren und dem Musikhören innewohnt, haben wir versucht, in Band 2 so zu beschreiben, dass das große Potenzial, aus dem die Musiktherapie schöpfen kann, deutlich wird. Ebenfalls in Band 2 haben wir, wenn auch knapp, die Aspekte zusammenfassend dargestellt, die uns in jeder therapeutischen Arbeit wichtig sind, hier besonders in der Musiktherapie („Was uns am Herzen liegt“).
Für die ausführlicheren Bezüge zu den wissenschaftlichen Quellen und ideengeschichtlichen Wurzeln müssen wir auf unsere anderen Veröffentlichungen verweisen. Dieses Buch sollte vor allem ein Buch für die praktische Arbeit werden.
Verzichtet haben wir auf Berichte und ausführliche Erläuterungen, auf ein isoliertes Methodenkapitel zur musikalischen Improvisation, einer Hauptmethode der Musiktherapie. Dazu gibt es hinreichende Literatur (z. B. Hegi, Lenz), die wir hier nicht wiederholen wollen. Dennoch taucht das musikalische Improvisieren natürlich häufig in den jeweiligen methodischen und inhaltlichen Zusammenhängen auf. Ebenfalls verzichtet haben wir auf besondere Erläuterungen zur intermedialen Arbeit. Unser therapeutischer Ansatz betont, dass gewünschte Veränderungen von Lebensmustern, an denen KlientInnen leiden, nur möglich sind, wenn sich die Muster des Erlebens eines Menschen ändern. Deshalb bieten wir in der Therapie viele Erlebnis öffnende Experimente an, die immer auch Angebote sind, Veränderung auszuprobieren. Wir wissen, dass die kreativen Möglichkeiten des Musizierens, der Gestaltung, des Tanzes und der Bewegung sowie der Poesie Erlebnis öffnend sind. Was liegt also näher, als zwischen den verschiedenen kreativen Ausdrucksmöglichkeiten „hin und her zu springen“. Jeder Medienwechsel weist über die Änderung der Technik hinaus, ist ein Angebot, neue Aspekte des Erlebens zu entdecken. Solche Wechsel- und Verknüpfungsmöglichkeiten ziehen sich durch das ganze Buch, durch viele der vorgestellten Methoden. Dieses Buch ist also nicht puristisch auf Musik beschränkt, wenngleich die Nutzung des Musizierens und Musikhörens im Vordergrund steht und Gegenstand dieser Veröffentlichung ist.
Da wir zu wissen meinen, dass die meisten TherapeutInnen an praktischer Methodik interessiert sind, haben wir deren Beschreibung an den Anfang gestellt, um von da aus eine Verbindung, eine Brücke zur Theorie herzustellen. Wer eher an den theoretischen Grundlegungen interessiert ist, von seiner Art zu lesen und zu lernen eher dieses Bodens bedarf, um Praxis einordnen und anwenden zu können, möge mit Kapitel 19 beginnen. Manche theoretischen Grundlagen, die sich auf spezielle Fachgebiete beziehen, wie unser Krisenmodell oder Grundlagen der Hirnforschung, finden Sie wiederum in den eher „praktischen“ Kapiteln vorher. Theorie macht für uns dann Sinn, wenn sie praxisbezogen, nachvollziehbar und an Erfahrungen überprüfbar, im besten Sinn einfach ist. Darum haben wir uns bemüht. Sie können das Buch deshalb auch an irgendeiner Stelle zu lesen beginnen, die Sie gerade besonders interessiert und die Sie mit Hilfe des Stichwortverzeichnisses oder der Inhaltsangabe gefunden haben, und sich dann kreuz und quer auf ihrem persönlichen Weg durch die Kapitel begeben. Wir haben zahlreiche Querverweise eingestreut, um einen solchen Weg zu erleichtern.
Und noch einige Hinweise: Wir reden in diesem Buch meistens von KlientInnen und meinen damit auch PatientInnen. Wir sehen keine grundsätzlichen Unterscheidungen, die Bezeichnung KlientInnen ist uns lediglich vertrauter und gewohnter.
Zumeist sprechen wir unsere KlientInnen mit „Sie“ an. In unseren Seminaren, Fortbildungsgruppen und Supervisionen ist dagegen das „Du“ üblich. Da wir in diesem Buch auch Beispiele aus diesem Bereich anführen und da wir KlientInnen, die wir in Gruppenbegegnungen geduzt haben, auch in Einzelbegegnungen mit „Du“ ansprechen, verwenden wir in diesem Buch beide Anredeformen. Wenn in den Beispielen von „dem Therapeuten“ bzw. „der Therapeutin“ die Rede ist, so meinen wir uns beide damit. Sollte es sich dabei um eine Kollegin oder einen Kollegen handeln, weisen wir ausdrücklich darauf hin.
Die musiktherapeutische Gruppenarbeit ist eine wunderbare Möglichkeit, eigenes Erleben gemeinsam mit dem anderer Menschen hörbar werden zu lassen, andere zu beeinflussen und gleichzeitig beeinflusst zu werden. Soll aber innerhalb einer Gruppe das besondere Eigene erklingen, gibt es eine Schwierigkeit: die wunderbare Eigenschaft des Musizierens, andere Menschen zu beeinflussen, kann störend wirken, da die Klänge der anderen die Suche nach dem eigenen musikalischen Ausdruck beeinflussen. Wir beschreiben in diesem Buch Anleitungen, in denen innerhalb einer Gruppenarbeit aufgefordert wird, persönliches Erleben musikalisch auszudrücken. Dies ist nur in Gruppen möglich, die klein sind und deren TeilnehmerInnen in der Lage sind, Klänge anderer zu hören und gleichzeitig Eigenes zu betonen. Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, muss bei einer Gruppenarbeit der musikalische Ausdruck nacheinander erfolgen.
Ob man unseren Beitrag einer „Richtung“ zuordnen kann, sei dahingestellt und ist uns nicht wichtig. Sicherlich verstehen wir uns als Teil der Strömung humanistischer Psychologie und teilen die meisten von deren Grundannahmen. KollegInnen, die mit uns zusammenarbeiten, bezeichneten die Musiktherapie, die wir vertreten, gelegentlich als „leiborientierte Musiktherapie“, was wir gerne aufgegriffen haben, und verweisen damit v. a. auf unsere leibphilosophischen Quellen. Und sicherlich „atmen“ die vorgestellten Methoden und Praxisbeispiele unsere leibtherapeutischen Grundlagen. Es ist uns ein besonderes Anliegen, die Möglichkeiten des leibphänomenologischen Ansatzes für die Therapie fruchtbar zu machen, auch für die Musiktherapie. Und gleichzeitig gilt, dass alle MusiktherapeutInnen, ganz gleich aus welcher „Richtung“ oder „Schule“ sie stammen, die hier vorgestellten Anregungen nutzen können. Zumindest wünschen wir uns das.
Wer noch mehr Zuordnungen sucht: Nimmt man die gängige Unterscheidung zwischen „rezeptiver Musiktherapie“ und „aktiver Musiktherapie“, so ließe sich aus vielen hier vorgestellten Praxisansätzen ein dritter Schwerpunkt, der der „themenzentrierten Musiktherapie“, benennen (s. u. a. Kap. 15). Doch wie dem auch sei: Etiketten erleichtern zwar das Zuordnen und die Orientierung, entscheidend aber ist der Nutzen, den man im Gebrauch des Inhalts gewinnen kann. Diesen Nutzen wünschen wir Ihnen und den Menschen, mit denen Sie arbeiten.
Wir danken Martin Lenz, der die ersten musiktherapeutischen Fortbildungsgruppen innerhalb der Zukunftswerkstatt therapie kreativ geleitet hat und dessen Leidenschaft für die musikalische Improvisation uns Mut gemacht und angestiftet hat. Wir danken Monika Vogel dafür, dass sie in ihrer Lehrtätigkeit auch einen Teil der Pioniertätigkeit geleistet hat, Musiktherapie mit leiborientierter Kunst- und Gestaltungstherapie zusammenzuführen.
Wie so oft hat Susanne Wolters schnell, zuverlässig und engagiert den Hauptteil der Schreibarbeiten übernommen und haben Cosima und Klaus Schneider die Umschlagsgestaltung und Antje Händel aufbauend auf Sabine Bremers Arbeiten zur ersten Auflage kreativ und zügig sowohl die Gestaltung als auch die Produktion des Buches übernommen. Wir danken sehr. Dies gilt auch für Lore Remkes engagierte Lektoratsarbeit.
Viele Kapitel dieses Buches sind in ihrer Rohfassung als Arbeitsmaterialien für die späteren, von uns geleiteten musiktherapeutischen Ausbildungsgruppen entstanden. Wir danken den TeilnehmerInnen der Fortbildungen, den KollegInnen in der Fortbildungsleitung und aus der „Arbeitsgruppe Musiktherapie“ Waltraut Barnowski-Geiser, Eva-Maria Brettschneider und Ralf Hollnack und den MusiktherapeutInnen Marlis Marchand und Lutz Debus sowie – last not least – Martin Lenz für ihre engagierten und kompetenten Rückmeldungen und Anregungen. Herzlichen Dank auch an Prof. Dr. Hans-Helmut Decker-Voigt für die Ermutigung, dieses Buch zu veröffentlichen, und für seine Bereitschaft, trotz seiner zahlreichen Verpflichtungen ein Vorwort zu verfassen, aus dem ein Essay geworden ist, mit dem er dieses Buch würdigt und in die Musiktherapieentwicklung einordnet. Auch für die zahlreichen Anregungen aus seinen Veröffentlichungen bedanken wir uns bei ihm sowie bei den anderen in diesem Buch zitierten (Musik-)TherapeutInnen. Wir danken allen KlientInnen, bei denen wir, wie Jeffrey Eugenides es in einem Roman ausgedrückt hat, Zeugen werden durften, „wie ein Ich das Ich entdeckte, das es sein konnte“ (Eugenides 2003, S. 472).
1
Wer bin ich? – Musiktherapeutische Wege der Selbstwahrnehmung und Selbstwertschätzung
Wer bin ich? – Die Beschäftigung mit dieser Frage zieht sich wie ein roter Faden durch viele therapeutische Prozesse. KlientInnen sind verunsichert in ihrer Selbstwahrnehmung, manches in ihnen und an ihnen erleben sie als fremd, brüchig oder unzusammenhängend. Sie wünschen sich Rückmeldungen, Spiegelungen von uns TherapeutInnen und sie wünschen sich Wege, zu einer stimmigeren und sicheren Selbsteinschätzung zu finden.
Damit verbunden ist die Frage der Selbstwertschätzung. Wer sich nicht selber klar genug wahrnimmt, sich nicht auch den unangenehmen, ungeliebten Seiten wahrhaftig stellt, wird auch unklar in dem sein, was er an sich selbst wertschätzt. Die Selbstwertschätzung vieler KlientInnen wurde durch Beschämungen, Missachtungen und Gewalt erniedrigt oder von Verboten und Tabus überlagert. Wer sich in der Therapie mit sich selbst beschäftigt, landet unweigerlich auch bei der Frage, wie wertvoll er sich selbst einschätzt. Wir werden einige Methoden darstellen, mit denen wir auf musiktherapeutischen Wegen KlientInnen darin unterstützen, sich selber besser kennen zu lernen und zu versuchen, das, was in ihnen kostbar und schätzenswert ist, zu entdecken und mit Zuneigung ernst zu nehmen.
1.1 Das klingende Namensbild
Namen sind wichtig. Namen sind Teil unserer Identität. Mit unserem Namen ist unser Selbstbild verknüpft. In unserem Namen steckt unsere Geschichte. Mit unserem Namen werden wir von anderen Menschen identifiziert. Es liegt also nahe, den Namen zum Klingen zu bringen. Wir wollen ihn, bevor es ans Musizieren geht, zum Ausgangspunkt eines Selbstbildes machen, also ein Namensbild gestalten.
„Aber mit welchem Namen beginne ich?“, fragen sich viele KlientInnen. „Ist es mein Vorname oder mein Nachname? Nehme ich den Namen meiner Eltern oder lehne ich diesen ab? Ist es der Name, der Doppelname oder der Name meines Partners oder meiner Partnerin, den ich in der Ehe angenommen habe?“ Und dann fallen ihnen Schimpfnamen ein, Kosenamen oder Spitznamen. Jeder Name hat eine Geschichte und eine Bedeutung. Zu jedem Namen werden Geschichten assoziiert, angenehme und unangenehme, liebevolle und beschämende. Den Namen zu präsentieren, bedeutet, sich zu präsentieren, sich vorzustellen. „Ich heiße“, meint immer auch: „Ich bin“.
Zur Erstellung des Namensbildes geben wir folgende Anregungen:
„Wählen Sie einen Namen aus. Sie haben zwar einen offiziellen Namen, aber Sie haben sicher noch viele Namen darüber hinaus. Sie können Ihren Vornamen nehmen oder Ihren Nachnamen, Ihren Geburtsnamen oder Ihren Spitznamen oder einen Kosenamen, vielleicht sogar ihren Wunschnamen. Wählen Sie den Namen aus, der Ihnen jetzt am ehesten in den Sinn kommt, der Ihnen jetzt wichtig ist und Sie vielleicht auch neugierig macht.“
„Nehmen Sie einen Stift, Ölkreide oder Pastellkreide in der Farbe Ihrer Wahl in die Hand und ein großes Blatt Papier und schreiben oder malen Sie Ihren Namen auf das Blatt.“
„Betrachten Sie nun Ihren Namen und malen Sie das Bild weiter, lassen Sie aus Ihrem Namen ein Namensbild entstehen. Vielleicht braucht Ihr Name eine Umgebung, vielleicht regen der Schriftzug oder einzelne Buchstaben zur Gestaltung von Figuren, Landschaften, Personen, Fabelwesen usw. an. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf.“
Nun soll dieses Namensbild zum Klingen gebracht werden:
„Befestigen Sie Ihr Bild an der Wand oder legen Sie es irgendwo auf den Boden, wo Sie es gut betrachten können. Schauen Sie es sich an, lassen Sie es auf sich wirken. Nehmen Sie wahr, welche Empfindungen, Gedanken und Gefühle es auslöst, und dann holen Sie sich ein Instrument – Sie können auch Ihre Stimme benutzen – und behandeln Sie Ihr Namensbild wie eine Partitur. Lassen Sie Ihr Namensbild erklingen …“
Je nach Namensbild, je nach den Empfindungen beim Betrachten, je nachdem, was die Beschäftigung mit dem Namen, dem Malen und dem Sinnieren darüber ausgelöst hat, entstehen Klänge unterschiedlicher Art und Weise. Manche finden nach einigem Experimentieren und Suchen ein Namens-„Thema“, so, wie es bei Wagner das „Tristan-Thema“ oder das „Isolde-Thema“ gibt. Andere spielen eher Gefühle oder Stimmungen, die die Beschäftigung mit dem Namen hervorgerufen hat. Wieder andere sind angetan von dem, was sie an Neuem oder Vielfältigem in sich und auf dem Bild entdecken, und improvisieren, indem sie Töne, Klänge, Melodien, Rhythmen erklingen lassen.
Danach gilt es, den KlientInnen eine Möglichkeit zu verschaffen, Echos auf ihr klingendes Namensbild zu erhalten. In der Einzeltherapie geben der Therapeut oder die Therapeutin die Rückmeldung, in der Gruppe zusätzlich andere TeilnehmerInnen. Die KlientInnen spielen die Klänge ihres Namens anderen vor, zeigen vielleicht auch noch ihr Bild, erzählen etwas darüber und erhalten Echos: Wie hat es sich angehört, was wurde beim Hören und Schauen gefühlt, was ist aufgefallen? usw. Die Rückmeldung kann in Worten erfolgen oder musikalisch. Das Selbstbild eines Menschen ist immer auch ein Fremdbild. Wir Menschen brauchen die Rückmeldungen anderer, um zu wissen, wer wir sind. Wir brauchen ehrliche Rückmeldungen, wohlwollende, auch kritische, aber keine niedermachenden oder verachtenden. Die bloße Gegenüberstellung von Selbstbild und Fremdbild ist unfruchtbar. Das Selbstbild erwächst aus dem Gemisch von Selbstwahrnehmungen und Rückmeldungen anderer Menschen. Es geht eher darum, zwischen den Fremdbildern zu differenzieren, Menschen darin zu unterstützen, aus den Rückmeldungen, die sie erhalten, diejenigen auszuwählen, die sie akzeptieren und integrieren können, und den Mut und die Kraft zu gewinnen, andere abzulehnen. Deswegen ist der gegenseitige Austausch über das klingende Namensbild so wesentlich. Und dann kann es sehr bewegend und hilfreich sein, noch einmal das Namensbild erklingen zu lassen, um diesen Prozess der Differenzierung musikalisch zu unterstützen und all das zu spielen oder zu singen und zu hören, was sich davon im Selbstbild verankern kann.
Es besteht auch die Möglichkeit, den eigenen Namen unmittelbar zu vertonen. Dies hat sich aber für den Erlebensprozess als nicht so fruchtbar herausgestellt wie der beschriebene Weg. Bei einer unmittelbaren Vertonung sind häufig die Hemmungen größer und viele Menschen neigen dazu, nach formalen künstlerischen Tricks zu suchen, so, wie Bach sein B-A-C-H vertont hat. Doch wer kann das schon wie Bach! Häufig führen solche Bestrebungen zu Kopfknoten, die den Erlebensprozess bremsen oder gar nicht erst in Gang kommen lassen. Das Malen schafft Zeit und Raum für die vielfältigen Erinnerungen, Geschichten, Assoziationen, die mit dem eigenen Namen verbunden sind, und lässt das in den Vordergrund treten, was im Moment besonders wichtig ist. Und die Namensbild-Partitur bleibt erhalten; der musikalische Moment ist nicht ganz so flüchtig. Sie kann später wieder vertont werden, vielleicht ähnlich, vielleicht aber auch, z. B. durch Perspektivwechsel, indem man sie auf den Kopf stellt, neu – und damit der Entwicklung, der Veränderung, dem Überraschenden einen klingenden Spielraum gebend.
1.2 Die sechs Kostbarkeiten
Beginnen wir mit einem Beispiel:
Eine Klientin leidet an Entscheidungsschwäche. Immer wenn sie Entscheidungen treffen muss, große oder kleine, gerät sie ins Schwanken, wird unsicher, weiß nicht, was sie tun, in welche Richtung sie sich bewegen soll. In der Therapie hat sie dieses und jenes versucht, sie kennt auch die Quellen und Gründe ihrer Entscheidungsunsicherheit – aber es ändert sich wenig.
An der Entscheidungsfindung zu arbeiten, was für viele KlientInnen ein wichtiger Ansatz ist, hilft ihr nicht weiter, da ihre Entscheidungsunsicherheit in einer tiefgreifenden Verunsicherung ihres Selbstbildes begründet ist. Wenn andere Menschen ihr Positives zurückmelden, nimmt sie das einen Moment zur Kenntnis und lässt es dann von sich abperlen – wie von einer Teflonplatte. Sie nimmt positive Rückmeldungen nicht in sich hinein.
Zu tief und zu selbstverständlich hat sie die von ihren Großeltern oft geäußerte Haltung übernommen, dass sie nichts wert sei, dass sie letzten Endes genauso „schlecht“ sei wie ihre früh verstorbene Mutter oder wie ihr Vater, der „Tunichtgut“.
Therapeut und Klientin suchen gemeinsam nach Wegen, auf denen sie lernen könnte, sich selbst wertzuschätzen.
In einer Stunde schlägt der Therapeut vor: „Ich möchte Sie heute bitten, mich zu einem Besuch in ein chinesisches Restaurant einzuladen. Dort werden wir auf die ‚sechs Kostbarkeiten’, die auf der Speisekarte angeboten werden, aufmerksam. Die sechs Kostbarkeiten vereinen das beste, was das Restaurant zu bieten hat. Ich bitte Sie, nun zu überlegen, welche sechs Kostbarkeiten Sie haben, was Sie an sich und in sich kostbar finden.“ Die Klientin schreckt zurück und meint, dass sie doch nie sechs Kostbarkeiten finden könne.
Der Therapeut: „Auch im chinesischen Restaurant wird jede Kostbarkeit nacheinander serviert. Beginnen Sie mit einer Kostbarkeit, beginnen Sie mit einer Eigenschaft, Tätigkeit, Kompetenz, was auch immer, mit einem Aspekt Ihrer Lebendigkeit, die Sie an sich schätzen, die Sie an sich für kostbar halten.“