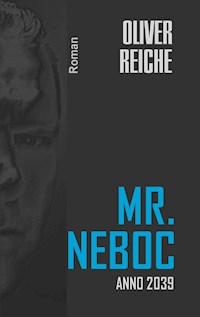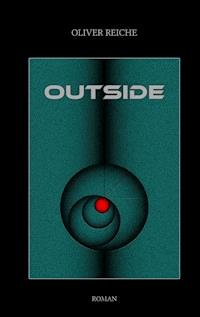Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der Suizid ihres ehemaligen Mentors trifft Sarah Dumont unverhofft. Doch war es wirklich Selbstmord? Warum sollte sich ein Mann, der im Leben alles erreicht hat, umbringen? Sie beginnt diese Dinge zu hinterfragen, aber es geschehen noch mehr Selbstmorde, Obdachlose verschwinden spurlos, Krankenakten geben Rätsel auf. Bis Dumont bei ihren Recherchen mit etwas konfrontiert wird, was bisher undenkbar erschien. Ein Albtraum wird Realität, und er könnte die Welt für immer verändern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 507
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch:
Sarah Dumont führt ein zurückgezogenes Leben, als sie vom überraschenden Selbstmord ihres ehemaligen Mentors erfährt. Doch es bestehen Zweifel: Hat sich der Mann, dem sie so viel zu verdanken hat, wirklich umgebracht? Versteckt sich die Antwort in seinem kurzen Abschiedsbrief?
Dumont kämpft nicht nur gegen die Dämonen ihrer Vergangenheit, je tiefer sie recherchiert, desto mehr Fragen tun sich auf: Warum und wohin verschwinden Obdachlose? Was hat es mit dem Unternehmen `ACEMA´ auf sich? Warum häufen sich merkwürdige Abschiedsbriefe weiterer Suizidopfer? Welche Rolle spielt Kriminalkommissar Zulawski, der vorgibt sie zu unterstützen, wirklich?
Bis sie auf etwas stößt, was bisher vollkommen unmöglich erschien. Ein Albtraum wird Realität, und er könnte die Machtverhältnisse auf der ganzen Welt verändern.
Der Autor:
Oliver Reiche, Jahrgang 1965, arbeitet als Projektleiter in der Bauund Immobilienbranche. Nebenbei schreibt er Romane oder Drehbücher, betätigt sich als Jugendleiter in einem Fußballverein oder gönnt sich Miniauszeiten in seinem Kleingarten. Er lebt mit seiner Familie in Dresden.
Von ihm sind bereits die SF-Kurzgeschichtensammlung `Primus´ sowie die Romane `Outside´ und `Mr. Neboc´ verfügbar.
Weitere Informationen unter: www.oliver-reiche.de
Für meine Frau.
Zum Glück bist du real.
Inhaltsverzeichnis
TICK-TICK
ESUS
RATTENPLAGE
VEGA SICILIO
MADEMOISELLE DÉTECTIVE
83_ARDEM
ACEMA
NEBENWIRKUNGEN
SCHULDGEFÜHLE
INTERCITY EXPRESS
KÜNSTLICHE EVOLUTION
PUZZLESTÜCK
MEERESTRÄNEN
WALTHER P88
ALTE KONTAKTE
DUNKELZIFFER
BESUCHER
ENTFÜHRT
IN MEMORIAM
DUNKLE TRÄUME
TIEFER FALL
WEISSE TOURISTIN
GESTÄNDNIS
KATAKOMBEN
SPURENSUCHE
BROT & SPIELE
ÜBEREINSTIMMUNGEN
IMAGESCHADEN
ARVED-SVEN SÖRENSEN
FRAGILITÄT
HÖLLENSCHLUND
KOGNITUM
ANNA 2.0
WORLD´S END
MOUNT EVEREST
MARYNA
1
TICK-TICK
Tick-Tick.
Schnurr.
Tick-Tick.
Es war nicht nur das Geräusch, das ihn wach werden ließ, sondern die unausgesprochene, furchterregende Assoziation im Unterbewusstsein, die sich dahinter verbarg. Wie ein grauenhaftes Wesen, das sich aus nebligem Dunst schält.
Schnurr.
Tick-Tick.
Der Mann öffnete mühsam die Augen, als würde er aus einem intensiven, verwirrenden Traum auftauchen und jetzt fürchten, die Realität zu sehen. Er nahm seine Umgebung wahr, doch sie befand sich hinter einem Schleier, in einer anderen Welt – scheinbar zu weit entfernt, um wirklich mit ihr verbunden zu sein.
Erst nach einer Weile wurde ihm bewusst, dass er sich in einem abgedunkelten Raum befand. In seinem Blickfeld über einer Tür leuchtete, schwach und grünlich wie in einem Kino, ein Notausgangsschild. Sein Blick wanderte behäbig umher, als spielte Zeit keine Rolle. Da waren mehrere Tische, auf denen anscheinend verschieden große Käfige standen. Undeutlich vernahm er ein leises, verstörendes Fiepen und Scharren aus dieser Richtung, als hausten dort gequälte Tiere.
Er sah langsam an sich hinunter, nur um festzustellen, dass er wie hingeworfen auf einem bequemen Sessel lag. Zugleich kroch ein eigenwilliger Geruch in seine Nase, der ihn entfernt an Putzmittel erinnerte. Diese Erkenntnisse drangen nur gemächlich zu ihm durch, weil seine Gedanken schwerfällig arbeiteten. Als wäre sein Gehirn eine alte, abgenutzte Maschine kurz vor der Verschrottung.
Jetzt gelang es ihm, den Kopf zu drehen. Er sah die schemenhaften Umrisse einiger Metallspinde, Computerbildschirme, Aktenordner auf einem Tisch und ein beschriebenes Flipchart. Er kannte diese Umgebung, er wusste genau, dass er sie kannte. Es musste dafür doch … eine Erinnerung geben.
Er versuchte aufzustehen, sich zu bewegen – doch sein Körper gehorchte nicht. Eine Weile dämmerte er so dahin, bewegungsunfähig, nutzlos, mit offenen Augen, wie im Wachkoma.
Was war das Letzte, an das er sich erinnern konnte? Wo genau befand er sich?
Die Erkenntnis kam wie ein winziges, aber plötzlich aufstrahlendes Licht: Die Käfige! Darin befanden sich Ratten, gehalten für Tierversuche. Er befand sich in einem Labor! In seinem Labor! An seinem Arbeitsplatz!
Aber wie kam er in diesen Sessel? War er darauf eingeschlafen? Wenn nur sein Kopf wieder klar würde, wenn nur dieses Schwindelgefühl nachließ, welches ihn beständig in eine dunkle Tiefe zu ziehen drohte.
Weitere Erinnerungen drängten nach vorn, doch sie waren undeutlich, traumhaft und verzerrt. Er hatte zu einer ungewöhnlichen Zeit sein Labor aufgesucht, dreiundzwanzig Uhr oder später. Aber warum? Hing es mit den Zweifeln zusammen, die ihn in letzter Zeit plagten?
Das Denken strengte ihn an, machte ihn wieder müde, lethargisch … er musste sich verdammt noch Mal konzentrieren!
Die Versuche liefen nicht wie erhofft. Mehr und mehr Tiere starben einen sinnlosen Tod. Briefe und E-Mails von Tierschutzorganisationen wurden zunehmend aggressiver. Auch die Anzahl der umsonst im Labor verbrachten Stunden summierte sich unaufhaltsam, während gleichzeitig die Beendigung des Projektes unmittelbar bevorstand. War es das alles wert gewesen? Mit einem Mal kamen ihm die letzten Jahre bedeutungslos und leer vor.
Er schaffte es, die Finger seiner linken Hand zu bewegen, aber nach wie vor verweigerten die restlichen Gliedmaßen den Dienst. Hatte er einen Schlaganfall erlitten?
Und was, zum Teufel, machte er auf diesem Sessel? Was hatte es mit dem eigenartigen Geruch auf sich? Oder roch es nur nach Alkohol? Er hatte zu oft versucht, damit Probleme zu lösen, obwohl er auf eine schizophrene Art wusste, dass das keinen Sinn ergab. Hatte er auch diesmal wieder zur Flasche gegriffen und war irgendwann einfach auf dem Sessel eingeschlafen? Was war das Letzte, an das er sich sicher erinnern konnte? Warum hatte er diese Lücken in der Erinnerung, die nur Fragmente von früher zuließen?
Tick-Tick.
Schnurr. Es klang wie das wohlige Mauzen einer Katze.
Tick-Tick.
Wieder drang das Geräusch in seinen Kopf, blieb dann dort haften und forderte schließlich seine Aufmerksamkeit. Es klang wie eine Uhr. Ein Wecker vielleicht, Zeit zum Aufstehen. War das hier nur ein Traum, ein dummes, haltloses Gespinst seiner Gedanken? Wieder benötigte er einige Zeit um zu erkennen, woher das Ticken kam. Direkt vor ihm auf einem Rollcontainer, keine fünfzig Zentimeter von dem Sessel entfernt, lag ein Gegenstand.
Größer als eine Uhr. Unregelmäßige Form. Drähte.
Keine Uhr.
Tick-Tick.
Schnurr.
Sekunden später überfiel ihn die Assoziation wieder. Die unausgesprochenen, furchterregenden Dinge, die sich hinter dem Geräusch verbargen, manifestierten sich zu etwas, vor dem er plötzlich Angst bekam. Auf seiner Stirn bildeten sich Schweißperlen.
Hatte er, in einem Anflug von düsterer Verzweiflung, mit Hilfe von Alkohol und Tabletten etwas in Gang gesetzt, was jetzt unaufhaltsam ablief? Was auch immer gerade stattfand, er musste von hier fort. Aufstehen und verschwinden, sofort. Er versuchte sich nach vorn zu werfen, zur Seite, Hauptsache irgendetwas tun. Umsonst. Erneut blockierte sein Körper die Zusammenarbeit. Es war, als hielt ihn ein unsichtbarer Gegner fest und ließ damit seine Anstrengungen ins Leere laufen.
Schließlich schaffte er es, sich aufrecht zu setzen, so dass sich sein Oberkörper nur wenige Zentimeter entfernt von dem Gegenstand auf dem Rollcontainer befand. Vergebens versuchte er, einen seiner bleischweren Arme zu heben. Er wollte einen Plan entwickeln, eine Idee, doch seine Panik überlagerte jede dieser Überlegungen.
Ergebnislose, pochende Gedanken wirbelten in seinem Kopf hin und her, bis auch das keine Rolle mehr spielte.
Die Wucht der Explosion nahm in Sekundenbruchteilen alles mit sich: Seine diffusen Erinnerungen, seine Angst sowie das rasende Schlagen seines Herzens.
2
ESUS
Der junge Kriminalkommissar stand mit zusammengekniffen Augen auf dem trostlosen, fast leeren Parkplatz. Es war Mitte Juli, kurz nach fünf Uhr. Seine Kopfschmerzen machten ihm zu schaffen und er fror, obwohl die Temperatur jetzt schon über 20 Grad betrug. Aus irgendeinem nicht nachvollziehbaren Grund hatte er schlecht geschlafen, sich hin und her gewälzt und war zwei Mal in der Nacht pinkeln gegangen.
Vielleicht gehörte das irgendwie zum Alterungsprozess ab einunddreißig dazu, wobei der berufliche Stress die ganze Sache wahrscheinlich noch verstärkte. Dafür ging in zwei Wochen der Flieger nach Mallorca, wo er sich entspannen würde. Er steckte die Hände in die Hosentaschen und betrachtete kritisch das Gebäude vor sich.
Durch den Anruf vor einer Stunde wusste er, dass es sich um ein Gründer- und Gewerbezentrum handelte, irgendwann Anfang der neunziger Jahre errichtet. Soweit er es verstanden hatte, konnten hier neu gegründete Unternehmen mit geringem Startkapital erste Gehversuche wagen, begünstigt durch niedrige Mieten und andere Subventionen.
An der glatten, kartongrauen Fassade rankten frische Brandspuren empor, sie ähnelten einem Geflecht dunkler Pflanzen. Die Feuerwehr hatte den Brand bereits vor zwei Stunden gelöscht, doch bei der anschließenden Sicherung des Gebäudes war sie auf eine Leiche gestoßen. Aus diesem Grund stand er jetzt in seiner Eigenschaft als Kriminalkommissar hier. Bis vor einem Jahr war er immer in Begleitung eines dienstälteren Kollegen unterwegs gewesen.
Hunderte Bruchstücke der offensichtlich durch eine Explosion zersplitterten Fenster lagen sowohl auf dem Betonpflaster als auch dem kümmerlichen Rasen verstreut. Sie glänzten in der Morgensonne wie flach gedrückte Tautropfen. Eine monströse Attika bildete den Abschluss des vierten Obergeschosses, während auf dem Flachdach eigenartige Aufbauten in den Himmel ragten. Das längliche Gebäude verfügte über drei Haupteingänge, an der linken Front schloss sich ein eingeschossiger Flachbau mit großen Hallentoren an.
Im Wesentlichen, fand er, glich das Gebäude in seiner Einfallslosigkeit und Form einer etwas zu groß geratenen, lädierten Schuhschachtel – ein Zeugnis misslungener Architektur.
Er ging in Richtung des linken Einganges. Der davor postierte Polizeibeamte nickte ihm emotionslos und wissend zu. „Zweites Obergeschoss.“
Der junge Kriminalkommissar nickte wortlos zurück, dann trat er durch die breite Eingangstür. In dem ebenfalls sehr schlicht gehaltenen Foyer des Gebäudes hing eine schmucklose Tafel, die die Namen der Unternehmen und deren jeweiligen Standort in diesem Teil des Gebäudes preisgab. Im zweiten Obergeschoss schien es nur eine einzige Firma zu geben, zumindest fand er in der entsprechenden Zeile nur einen Aufdruck: `ESUS – Biomedizinisches Labor Berlin´.
Er wandte sich dem Treppenhaus zu. Die stark abgenutzten Stufen und zerschrammten Betonwände waren ein weiterer Beweis dafür, dass das Gewerbezentrum seine besten Zeiten hinter sich hatte.
Die beißende Ausdünstung nach verbranntem Kunststoff und etwas anderem, das sich mit Bildern von Sterbenden und alten Friedhöfen verband, intensivierte sich von Treppenstufe zu Treppenstufe. Es erinnerte ihn an einen Geruch von einem anderen Tatort vor einem Jahr. Damals lag diese Ausdünstung noch zwei oder drei Tage unter der Zunge und haftete wie angeklebt in der Nase. Eine halbe Flasche Wodka hatte seine Geschmacks- und Sinneseindrücke wieder in eine andere Richtung gelenkt.
Am Treppenaufgang zum zweiten Obergeschoss stand ein weiterer, in sich versunkener Polizeibeamter mit unnatürlich blassem Gesicht. Der Mann sah aus, als hätte er sich gerade erbrochen oder sei im Begriff, dies in den nächsten Minuten zu tun.
Die Eingangstür des Labors, dem eigentlichen Ort des Geschehens, ragte windschief in den Gang hinein. Dies ließ auf eine äußerst heftige Druckwelle schließen, für die nur eine wirklich starke Explosion verantwortlich sein konnte. Die Glasscherben der Türfüllung verteilten sich wie von einem Blumenkind sorgfältig in dem langen Gang gestreut. In dem Mauerwerk aus weiß gestrichenem Kalksandstein steckten einzelne Glasstücke.
Neben der Tür hing ein kleines Messingschild an der Wand mit der Aufschrift `ESUS´, das somit jeden Zweifel ausräumte. Ein unglücklich dreinblickender Polizeibeamter mit Mundschutz stand direkt daneben.
Der junge Kriminalkommissar betrat vorsichtig den Raum, während er erfolglos versuchte, den starken, unnatürlichen Geruch zu ignorieren, der seine Kopfschmerzen augenblicklich verstärkte. Er sah sich um. In dem gesamten Labor für Tierversuche existierte auf den ersten Blick nichts mehr, was je wieder sinnvoll zu verwenden wäre. Das betraf sowohl die Reste der Käfige, die Computer und Messgeräte als auch das übrige Interieur. Auch die von der Explosion nicht in ihre Einzelteile zerlegten Gegenstände waren durch den anschließenden Brand deformiert und zu bizarren Formen geschmolzen, bis der Löschschaum der Feuerwehr das Wüten gnädig beendete. In einer Ecke des Raumes, mit dem Rücken zu ihm und in seine Tätigkeit vertieft, kniete ein glatzköpfiger Mann in einem weißen Kittel. Als der Kriminalkommissar sich räusperte, sah sich der Glatzkopf kurz zu ihm um, bis er ihn mit einer knappen Handbewegung zu sich winkte.
Vor dem Gerichtsmediziner lag ein nur noch schwer als Mensch zu identifizierendes Etwas mit aufgerissenem Brustkorb, verrenkt wie eine Schaufensterpuppe. Durch den Brand war die Leiche so weit verkohlt, dass man kaum noch unterscheiden konnte, wo Kleidungsfetzen aufhörten und Haut begann.
Der Weißkittel stand mühsam auf, während der junge Kommissar ihn kopfschüttelnd beobachtete. Auch wenn der Mann eine Koryphäe war, seine körperlichen Probleme waren unübersehbar. Wenn der Mann schlau war, gönnte er sich vor seinem Ausscheiden aus dem Dienst noch ein künstliches Hüftgelenk.
„Was?“, knurrte der Gerichtsmediziner mürrisch zur Begrüßung. „Irgendwann trifft es auch einen jungen Kerl wie dich. Das geht schneller als du denkst.“
Der Gerichtsmediziner war dafür bekannt, dass er jeden duzte, der ihm über den Weg lief. Dafür war er nicht nachtragend, wenn man ihm Paroli bot.
„Möglich“, räumte der Kriminalkommissar emotionslos ein. „Aber aktuell habe ich nicht vor, länger als notwendig im Polizeidienst zuzubringen. Ich glaube schon, dass ich ab einem gewissen Alter eingewickelt in eine Decke in irgendeinem Schaukelstuhl im sonnigen Süden sitze und Däumchen drehe. Das nennt sich Pensionierung.“ Er bemerkte den abweisenden Gesichtsausdruck seines Gegenübers. „Aber hier ist es natürlich viel schöner.“
„Irgendeiner muss es ja machen.“ Der Glatzkopf streifte sich die Handschuhe ab, um dann als Erklärung für seine Worte mit einer kurzen Kopfbewegung auf das zerstörte Labor zu deuten.
Die beiden Männer schwiegen ein paar Sekunden, während der jüngere grübelte, was sich in den letzten Minuten vor der Explosion in diesem Raum wohl abgespielt haben mochte.
„Was haben Sie für mich?“, fragte er.
„Ich bin erst seit fünfzehn Minuten hier, viel ist es also noch nicht.“ Der Glatzkopf wies mit einer weiteren kurzen Handbewegung auf die Leiche. „Vermutlich Professor Karl Oehme, der Laborleiter. Eindeutig Sprengstoff mit anschließendem Brand. Das Metallschild an seinem Kittel mit seinem Namen darauf ist erstaunlicherweise das Einzige, was die Sache hier halbwegs überstanden hat. Aber letztlich bedeutet so ein Schild gar nichts. Heute Nachmittag weiß ich bezüglich der Identifikation mehr.“
Der Kriminalkommissar sah sich wieder um. Bei jeder Bewegung drohte sein Kopf zu zerspringen. „Ich habe noch nie davon gehört, dass in einem Labor für Tierversuche mit Sprengstoff gearbeitet wird. Und schon gar nicht in den Größenordnungen, die einen solchen Schaden verursachen.“
„Nein. Das wäre mir ebenfalls neu“, pflichtete ihm der Gerichtsmediziner ohne jede Ironie bei. „Es sieht für mich fast so aus, als hätte er das hier selbst zu verantworten.“ Er zeigte auf einen Sessel mit verkohltem und verschweltem Bezug, welcher umgekippt einen halben Meter neben dem Toten lag. „Möglicherweise saß er zum Zeitpunkt der Explosion darauf und der Explosionsherd befand sich sehr nahe an seinem Körper. Das würde den aufgerissenen Brustkorb erklären. Um das sicher beurteilen zu können, müsste ich allerdings Blut- oder Gewebereste auf dem Stoffbezug finden. Aber so, wie das Feuer hier gewütet hat … die labortechnische Untersuchung wird eine Weile dauern.“
Selbst mit pochenden Kopfschmerzen wunderte sich der junge Kommissar, mit welcher Selbstverständlichkeit der Gerichtsmediziner und dessen Kollegen aus der Pathologie über diese schlimmen Dinge sprachen. Vielleicht würde er sich nie daran gewöhnen.
„Wie muss ich mir das vorstellen?“, sinnierte er laut. „Er sitzt da auf seinem Sessel in seinem Labor? Mit der Sprengladung vor dem Bauch, weil er sich umbringen will? Er sitzt einfach da und wartet, bis es zu Ende ist? Wäre ich irgendwie nicht der Typ dafür.“
„Wir müssen abwarten, ob der Zündmechanismus rekonstruiert werden kann. Das könnte Rückschlüsse zulassen auf die Art und Weise, wie sich das hier abgespielt hat. Vielleicht musste er gar nicht dasitzen und warten, sondern hat einfach nur auf einen Knopf gedrückt?“
„Ist das nicht genau das Gleiche?“, wunderte sich der junge Mann.
Der Glatzkopf zuckte mit den Schultern. „Das kannst du nicht wissen. Wer weiß, wie seine letzten Stunden verlaufen sind.“
„Vielleicht war er an dem Stuhl festgebunden?“, kam die Gegenfrage.
„Das wäre theoretisch eine Option. Nur existiert dafür nicht der geringste Hinweis. Auf den ersten Blick gibt es keine Faserspuren, weder an der Leiche, noch an dem Stuhl. Je nach Art der Faser eines Strickes finde ich vielleicht noch minimale Rückstände, aber wohlgemerkt, zwischen dem vermutlichen Zeitpunkt der Explosion und dem Beginn der Löscharbeiten lagen achtunddreißig Minuten. Die Feuerwehr ist nicht gleich auf das Gelände gekommen. Eine verflucht lange Zeit für ein Feuer, um sich auszutoben.“
Der junge Kriminalkommissar nickte zustimmend. Es war schon eine Legende, dass sein älterer Kollege immer erstaunlich gut informiert war. Das lag nicht zuletzt an dessen hervorragenden Kontakten sowie dem ausdrücklichen Wunsch, so schnell als möglich auch über scheinbare Nebensächlichkeiten informiert zu werden. „Was das Feuer fressen kann, das frisst es, oder?“, bemerkte er tiefgründig.
Statt einer Antwort zog der Gerichtsmediziner geräuschvoll Luft durch die Nase ein. „Riechst du das? Ausgehend vom Geruch würde ich sagen, er hat vorher Benzin über alles gekippt. Er hat also auch an die Zeit nach der Explosion gedacht. Würde mich nicht wundern, wenn wir hier irgendwo noch einen zerbeulten Kanister finden.“
Der Jüngere gab sich nicht die Mühe einer intensiven Geruchsprobe. „Interessant. Er bringt sich also nicht nur auf seiner Arbeitsstelle um. Er will auch, dass alles was dazugehört, mit zerstört wird. Moralische Bedenken, könnte man vermuten. Tierversuche und so.“
Der Mediziner zuckte mit den Schultern. „Möglich, ja. Einerseits merkwürdig, dass ihm das nach einer derart langen Berufstätigkeit einfällt. Andererseits kann sich das auch entsprechend aufgestaut haben. Die Psyche mancher Menschen ist eben ein Rätsel, von den Abgründen darin ganz zu schweigen. Vielleicht ist aber auch an anderer Stelle etwas gründlich schief gelaufen oder es sind einfach nur familiäre Probleme, die zu so etwas führen.“
„Familiär? Sich in die Luft zu sprengen, weil die Frau weggelaufen ist, halte ich dann doch für übertrieben.“
„Keine Ahnung. Wenn du vierzig Jahre verheiratet bist, hast du vielleicht eine andere Meinung darüber. Frag doch mal seine Mitarbeiter.“
Der Kommissar nickte mühsam, weil seine Kopfschmerzen einen kritischen Punkt erreicht hatten. „Ja, das wird wohl nicht ausbleiben.“ Er wischte mit der Schuhspitze ein wenig Ruß auf dem Fußboden breit. „Haben Sie zufällig eine Ahnung, wo ich hier in der Gegend einen Kaffee herbekomme?“ Eine Tasse Kaffee und eine Schmerztablette – manchmal reduzierten sich Wünsche auf ein Minimum.
Der Glatzkopf steckte nachdenklich die Hände in seine Kitteltaschen, doch er sah nicht einmal auf, als er antwortete. „Tankstelle. 300 Meter.“
3
RATTENPLAGE
Der junge Kriminalkommissar betrachtete den ihm gegenüber sitzenden Mann interessiert. Leon Wagenburg entsprach mit seinen als Zopf zusammengebundenen langen Haaren, den bunten Shorts sowie dem straff über seinen Bauch spannenden, verwaschenen T-Shirt nicht unbedingt dem klassischen Bild eines Wissenschaftlers. Ebenso wirkte er auf den ersten Blick nicht sonderlich intelligent, sein Doktortitel jedoch sagte etwas anderes. Wagenburg war fünfundvierzig Jahre alt und ihm damit etliche Jahre voraus. Er besaß die schwammigen Gesichtszüge eines Mannes, der zu viel und zu ungesund aß und wog vermutlich um die 100 Kilogramm.
Jetzt saßen Wagenburg und er allein in der Cafeteria des Gründer- und Gewerbezentrums – die sich in einem anderen Gebäudeteil als das zerstörte Labor befand – an einem Esstisch für sechs Personen, während vom Tresen leise Radiomusik herüberdudelte.
Die Explosion war nun vier Tage her. Der Kriminalkommissar fühlte sich nach der Kopfschmerzattacke erholt und wieder bereit, Verbrechen aufzuklären.
„Wie ich hörte, war Professor Oehme sehr beliebt?“, begann er so behutsam wie möglich.
Wagenburg nickte mechanisch, während er ihn mit einem seltsam leeren Blick ansah. „Ja. Definitiv. Manchmal ein wenig verdreht, aber ansonsten absolut auf der Höhe. Mit ihm konnte man immer konstruktiv diskutieren, er hat fast nie den Chef raushängen lassen.“
„Tut mir leid für Sie.“
„Ja.“ Wagenburg presste die Lippen aufeinander, um schließlich den Blick abzuwenden.
Der junge Kriminalkommissar folgte dem Blick und sah in den trostlosen Innenhof des Gebäudes, in dem ein einsamer, dürrer Strauch im Schatten um sein Überleben kämpfte. Das erinnerte ihn an den Innenhof eines Gefängnisses, in dem er einmal zu einer Befragung gewesen war. Die ganze Atmosphäre war einfach deprimierend gewesen.
„Wie lange arbeiteten Sie schon für ihn beziehungsweise für ESUS?“
„Sechs Jahre und acht Monate. Ich bin kurz nach Projektbeginn zum Team gestoßen.“
Die Antwort kam sofort und ohne jede Überlegung. Es klang, als hätte Wagenburg mit dieser Frage gerechnet, was der junge Kriminalkommissar als nicht ungewöhnlich einschätzte.
„Nach Projektbeginn?“ Er zog aus dem vor ihm liegenden hellbraunen Umschlag einen Hefter mit nur wenigen Seiten Papier heraus, öffnete ihn und zeigte Wagenburg die erste Seite. „Das Projekt?“
Der Angesprochene warf einen kurzen Blick auf das Papier, um den Polizeibeamten danach traurig anzusehen. „Ja, genau das Projekt. Das ist der letzte Quartalsbericht. Wo haben Sie den her?“
„Datiert auf März diesen Jahres“, ergänzte der Kriminalkommissar, ohne auf die Frage seines Gegenübers einzugehen. „Neben Ihnen und Karl Oehme gab es noch drei weitere Projektbeteiligte. Zwei davon habe ich schon befragt, Laura Steinbrück weilt leider noch in Australien. Unabhängig davon habe ich den Bericht gelesen und versucht, die ganze Sache zu verstehen. Hat auf Grund der fehlenden Fachkenntnisse nicht wirklich funktioniert.“
Wagenburg sah ihn mit nachsichtiger Miene an. Dann fuhr er sich mit einer Hand auf eine fast schon kokette Art durch seinen blonden Zopf, die trotz der weiblichen Attitüde irgendwie zu ihm passte.
„Im Wesentlichen, sagen wir mal, geht es um neuronale Vernetzung durch Reizstimulierung bei zwei Versuchstieren, in dem Fall Ratten. Ist ein Tier erregt oder hat Hunger, geht es dem andern genauso. Dafür benötigt man unter anderem eine präzise Feinabstimmung mehrerer körpereigener Parameter, die Messung der Hirnstromaktivitäten und so weiter. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir im Laufe der letzten sieben Jahre mehr als einhundert Ratten verbraucht.“
„Meinen Sie mit `verbraucht´ die Anzahl der Tiere, die bei den Versuchen gestorben sind?“
„Ja, sicher.“ Leon Wagenburg bekam einen störrischen Gesichtsausdruck. „Das wird doch jetzt von Ihrer Seite keine ethische Diskussion, oder? Außerdem ist die Verwendung sämtlicher Tiere genau dokumentiert und es gibt glaube ich nur sehr wenige Lebewesen, die derartig viele Nachkommen produzieren wie Ratten. In manchen Städten Deutschlands spricht man sogar schon von einer Rattenplage. Wie im Mittelalter. Da kann man schon mal großzügiger sein.“
Der Kriminalkommissar schob den Forschungsbericht zurück in den Umschlag. Dass eine Spezies sehr viel Nachwuchs bekam stellte seines Erachtens keinen Grund dar, sorglos mit deren Leben umzugehen. Andererseits gab es sicherlich in verschiedenen Bereichen der Forschung wenig Alternativen zu Tierversuchen.
„Wie ich schon andeutete, ich bin ein Laie auf dem Gebiet“, drückte er sich um eine klare Stellungnahme. „Vielleicht aber können Sie mir deswegen erklären, wo Ihre Forschung Anwendung findet?“
Wagenburg drehte die fast leere Tasse Kaffee in seiner Hand um deren Achse wie ein verlegener Schuljunge. „Momentan findet sie noch nirgendwo Anwendung, wir reden hier von erweiterter Grundlagenforschung. Doch wenn es ausgereift ist, gibt es einige Einsatzmöglichkeiten, denken Sie nur an die Medizin.“ Er stellte mit einer entschlossenen Bewegung die Tasse zur Seite, atmete tief aus und lehnte sich dem Kriminalkommissar entgegen. „Das Projekt wurde übrigens eingestellt, falls man Ihnen das noch nicht gesagt hat. Wenn Sie also nach Gründen für seinen Tod suchen – die hätten ihm das Projekt lassen sollen, verdammt! Fünfzehn Jahre Projektarbeit, einfach umsonst!“
„Ich dachte, es waren nur knapp sieben Jahre?“, unterbrach der Kommissar seinen Gesprächspartner.
„Ja, stimmt. Aber nur, soweit es das offizielle Projekt betrifft. Doch er hat auch schon davor acht Jahre daran geforscht, nur eben mit privaten Mitteln! Karl hat sogar manchmal nachts noch dagesessen und getüftelt, ist Versuchsanordnungen wieder und wieder durchgegangen. Er hat dafür gelebt, war von seiner Vision überzeugt! Manchmal hat er es als sein Lebenswerk bezeichnet. Kein Wunder, dass…“ Wagenburg wischte sich fahrig mit einer Hand über sein Gesicht und sah sich dann gehetzt um. „Einfach so das Projekt einzustellen“, fuhr er erbost fort, „das machen nur Bürokraten, die keine Ahnung haben, was wirklich dahintersteckt.“
Der plötzliche Ausbruch des Mannes überraschte den Kriminalkommissar nicht. Durch die Befragungen der zwei Kollegen von Leon Wagenburg wusste er bereits, dass auch diese sich um die Früchte ihrer Arbeit betrogen fühlten.
„Bezüglich der Einstellung des Projektes – kennen Sie Details?“, erkundigte er sich milde. „Ich hoffe doch, er hat sein Team irgendwie eingeweiht.“
Wagenburg zuckte mit den Schultern, bevor er unruhig auf seinem Stuhl hin und her rutschte. „So weit ging die Demokratie dann doch nicht. Vor ungefähr zwei Monaten ist ein Typ von irgendeinem EU-Gremium bei ihm vorbeigekommen, hat eine halbe Stunde mit ihm geredet … und das war es dann: Die Fördermittel werden im Monat Juli das letzte Mal gezahlt, sämtliche Unterlagen sind spätestens bis dahin zu übergeben, danach wird das Projekt eingestellt.“ Der Mann schüttelte den Kopf, so dass sein Pferdeschwanz hin und her schwang. „Und ich Idiot dachte noch, die erhöhen uns das Budget.“
Trotz seiner kurzen polizeilichen Laufbahn war der junge Kriminalkommissar schon mit seltsamen Entscheidungen in Berührung gekommen, wo er feststellen musste, dass es Dinge gab, die sich ihm einfach nicht erschlossen. „Ich muss zugeben, dass ich das nicht wirklich verstehe. Was hat die Europäische Union mit Ihrer Forschung an Ratten zu tun?“
„Wie gesagt, Karl hatte ja schon eine Weile alleine daran gearbeitet. Irgendwann ist ihm die Arbeit über den Kopf gewachsen, außerdem ging das Geld zur Neige. Zu dem Zeitpunkt wäre es gegenüber der Wissenschaft geradezu fahrlässig gewesen, aufzugeben. Und für die wirklich tieferen Untersuchungen benötigt man auch die entsprechenden Geräte. Also hat er denen in Brüssel seine bisherigen Ergebnisse unter die Nase gehalten und sich damit um einen Forschungsauftrag beworben. Es hat funktioniert. Dort oben im Labor stehen, oder standen, Geräte im Wert von ein paar Millionen Euro herum. Dann hat er ein paar Leute angestellt und los ging es.“
„Was es nicht alles gibt“, sinnierte der Kommissar verwundert. Er hatte schon im Studium davon gehört, dass die Beantragung von Geldern aus dem Topf der EU, wie letztens für die dringend notwendige Erhöhung der inneren Sicherheit, ein umständliches und aufwändiges Verfahren darstellte. Umso erstaunlicher fand er, dass ein völlig unbekannter Wissenschaftler über mehrere Jahre Fördergelder für ein derartiges Forschungsprojekt erhalten hatte.
„Ja“, riss ihn Wagenburg aus seinen Überlegungen. „Es war ein tolles Projekt mit Perspektiven, man brauchte nur etwas Phantasie. Es hat zwar fast ein Jahr gedauert, bis die Genehmigung kam, aber dann sind die Gelder problemlos geflossen, auch wenn nur Karl die genauen Beträge kannte.“
„Aber warum stellt die EU das Projekt ein, wenn es so toll ist wie Sie sagen?“
„Wie gesagt, Karl hat uns die offizielle Begründung des Gremiums für den Projektabbruch nicht mitgeteilt. Wie er sagte, sei diese Geheimhaltung ein Teil des Vertrages über die Fördergelder. Ich persönlich gehe davon aus, dass den feinen Herren der Projektfortschritt nicht weit genug gediehen war. Auch wenn wir nie einer klar definierten Zielsetzung unterlagen, vermute ich, dass sich der Geldgeber nach der Projektlaufzeit mehr erhofft hat als das, was wir vorzuweisen hatten. Vielleicht wurde in Brüssel auch eine neue Tierschutzrichtlinie verabschiedet und wir sind damit über Nacht zu den Bösen avanciert. Keine Ahnung. In jedem Fall aber haben die uns ersatzlos den Hahn zugedreht, damit nicht noch mehr Geld verbrannt wird.“
Ein Projekt, das nach sieben Jahren nicht über Grundlagenforschung herausgekommen war. Aus der Sicht eines Steuerzahlers konnte der junge Kriminalkommissar die Herangehensweise des EU-Gremiums durchaus nachvollziehen.
Die Tür zur Cafeteria öffnete sich und eine Gruppe Männer in blauschwarzer Arbeitskleidung kam herein. Sie unterhielten sich weithin vernehmbar, wobei sie den zwei bereits Anwesenden nicht die geringste Beachtung schenkten.
Wagenburg beugte sich wieder zu seinem Gesprächspartner hinüber. „Darf ich Sie noch etwas fragen?“, sagte er mit bittendem Unterton, während sich die Ankömmlinge gegenseitig lautstark über ihre Überlegungen zur Essensbestellung informierten.
„Ja, selbstverständlich.“
„Hat man denn etwas retten können? Unsere Forschungsergebnisse, das ganze Material, was ist damit?“ Seine Augen fixierten den jungen Mann auf eine seltsame Art und Weise, wie ein Fiebernder, der sich ein Mittel gegen seine Krankheit erhofft.
„Nein, tut mir leid, nicht das Geringste“, antwortete der Kriminalkommissar nach ein paar Sekunden des Nachdenkens. „Was die Explosion nicht sofort zerstört hat, ist geschmolzen oder verbrannt. Sogar der Server im Nebenraum. Alles in allem kein schöner Anblick, glauben Sie mir.“
Der Mann mit dem Zopf sah missbilligend zu der Gruppe der Männer hinüber, wobei nicht erkennbar war, ob das an der Antwort des Polizeibeamten lag oder auf die Anwesenheit der Männer zurückzuführen war.
„Das heißt, der Bericht, den Karl normalerweise in der Schublade seines Schreibtisches aufbewahrte, ist verbrannt“, fasste Wagenburg zusammen. „Jede digitale Kopie im Labor ist unbrauchbar. Und das Exemplar, das jetzt in Brüssel liegt, ist für uns vermutlich nicht zugänglich. Wahrscheinlich verrottet es gerade in irgendeinem Kellerarchiv. Wir haben also gar nichts, das Projekt ist komplett tot.“
Ein neuer Schwung Männer kam in die Cafeteria, was den Kommissar veranlasste, die Unterlagen in seine Aktentasche zu stecken. „Wenn Sie so wollen, ja“, erwiderte er Wagenburg. „Andererseits gehören die Forschungsergebnisse meines Erachtens dem, der die Forschung bezahlt. So gesehen hätte das Gremium nicht einmal eine Begründung für die Einstellung der Arbeiten liefern müssen. Aber selbstverständlich verstehe ich Ihre Sichtweise.“
Wagenburg schüttelte erneut den Kopf. „So viel Jahre Forschung für Nichts. Was für ein Irrsinn.“
Der Kriminalkommissar musterte den Mann, der nun gedankenverloren ins Leere sah. „Auch wenn es Ihnen jetzt vielleicht unangebracht erscheint: Was haben Sie an jenem bewussten Abend vor vier Tagen getan?“
Ein leichtes, bitteres Lächeln erschien auf dem Gesicht von Wagenburg. „Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann einmal nach einem Alibi gefragt werde. Anderseits habe ich mich schon gewundert, dass die Frage nicht eher gekommen ist.“ Seine Zunge strich kurz über seine Lippen, wie bei einer Katze, die vor ihrem Fressnapf sitzt. „Ich war zu einem Vortrag. Im Hilton-Hotel. Es ging mit um Neurolinguistik, zumindest im weitesten Sinne. Die Veranstaltung ging bis ungefähr 22.00 Uhr.“ Er sah den Kriminalkommissar an. „Das können Sie gern überprüfen. Ich glaube, ich habe zu Hause auch noch die Einladung herumliegen.“
„Kann jemand bestätigen, dass Sie dort waren?“
„Mit Sicherheit. Ich habe mich während der Veranstaltung mit ein paar Kollegen unterhalten. Danach sind einige noch ein Bier trinken gegangen, mich eingeschlossen. Ich kann Ihnen gern die Namen und Kontaktdaten heraussuchen, soweit ich das zusammenbekomme.“
„Ja, das wäre nett“, antwortete der junge Polizeibeamte nüchtern. „Eine Frage hätte ich trotzdem noch: Hatte Professor Oehme Probleme?“
Wagenburg verschränkte die Arme vor der Brust und lehnte sich zurück. „Probleme? Sie meinen, außer der Tatsache, dass man ihm sozusagen im Handstreich sein Lebenswerk weggenommen hat? Soll das ein Scherz sein?“
„Nein. Ich meine persönliche Probleme, die schon vor der Mitteilung über die Einstellung des Projektes ersichtlich waren. Frau? Kinder? Alkohol? Streitigkeiten mit anderen Kollegen? Fehlende wissenschaftliche Anerkennung? Geldsorgen?“, stellte der Kriminalkommissar seine Frage in ruhigem Tonfall richtig.
„Nun ja“, antwortete Wagenburg nach einer Weile gedehnt, „genaugenommen war fast von jedem etwas dabei. Seine Frau ist gestorben, das ist jetzt ungefähr ein Jahr her. Ob er Kinder hatte – keine Ahnung. Der Projektfortschritt hat ihn auch nicht zufriedengestellt, denn schließlich musste er die Fördermittel irgendwann anteilig zurückzahlen. Zudem kamen ihm in jüngster Zeit hin und wieder Bedenken, ob seine Arbeit aus ethischer Sicht vertretbar ist.“
„Die einhundert Ratten.“
„Manchmal muss man zu diesem Thema nur den falschen Artikel in der Zeitung lesen.“ Wagenburg hob die Hände, um die Widrigkeiten, den sie ausgesetzt waren, zu verdeutlichen. „Wenn man da einen schlechten Tag erwischt, kann man schon ins Grübeln kommen. Das hat jeder von uns schon einmal durchgemacht. Der Professor hat mich die letzten Monate ab und an zu einem Feierabendbier überreden wollen, das war früher gar nicht seine Art.“
„Wie haben Sie sich entschieden?“
Wagenburg zuckte mit den Schultern. „Ich hatte manchmal den Eindruck, er trinkt nach Feierabend. Wegen seiner Frau. Ich wollte dem keinen Vorschub leisten und bin außerdem der Meinung, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Das Fiasko mit dem Projekt hat seine Trinkgewohnheiten sicherlich nicht verbessert. So richtig glücklich hat er auf mich in letzter Zeit nicht gewirkt. Ich meine, ich habe ihn manchmal murmeln hören, dass er alles beenden will, aber ich habe dem nie wirklich eine große Bedeutung beigemessen. Wie man so etwas eben sagt, wenn es mal auf ganzer Linie nicht rund läuft. Ich weiß auch nicht, ob man seine letzte E-Mail wirklich so bewerten sollte, wie sie geschrieben ist.“
Der Kriminalkommissar beugte sich überrascht vor. „Welche letzte E-Mail?“
Der Mann mit dem blonden Zopf griff in die Brusttasche seines Hemdes, zog einen zusammengefalteten Zettel heraus und reichte ihn zögernd über den Tisch. „Ich dachte mir schon, dass Sie das vielleicht interessieren könnte. Ein Ausdruck von der eben genannten E-Mail. Liest sich, zumindest im Nachhinein gesehen, ein bisschen wie ein Abschiedsbrief. Die E-Mail hat er mir an dem bewussten Abend kurz nach Mitternacht geschrieben. Es ist niemand anderes im Verteiler. Da muss er schon im Labor gewesen sein, weil er seinen Laptop nie mit nach Hause genommen hat. Als ich es am nächsten Morgen gelesen und dann von den Ereignissen erfahren habe, war ich völlig fertig.“
Der junge Kriminalkommissar nahm das Blatt Papier entgegen. Er las es kurz durch, um es danach zu den restlichen Unterlagen zu legen. „Wir sehen uns das an. Auf jeden Fall danke ich Ihnen. Sie haben mir sehr geholfen“, sagte er mit einem Seitenblick auf drei Frauen, die jetzt die Cafeteria betraten. Daraufhin erhoben sich die beiden Männer gemeinsam wie auf ein unsichtbares Zeichen.
„Natürlich helfe ich Ihnen gern“, erwiderte Wagenburg unverbindlich. „Eines wollte ich aber noch loswerden: Die Sprinkleranlage war wegen Wartungsarbeiten oder irgendeinem Schaden eine Woche außer Betrieb. Im Prinzip also bis gestern. Es gab genug Aushänge mit dieser Information. Das heißt, alle die hier arbeiten wussten es. Ich weiß zwar, dass Karl schon immer ein umsichtiger Mensch war. aber ich hoffe, er hat sich nicht extra diesen Zeitraum herausgesucht, um sich umzubringen.“
FÜNF JAHRE SPÄTER
4
VEGA SICILIO
Für ihre zweiundsechzig Jahre, fand Marita Wendt, besaß sie noch eine ganz passable Figur. Sie drehte sich vor dem Flurspiegel, um zufrieden ihren nackten Körper zu betrachten. Anscheinend war sie der lebende Beweis, dass sich jahrelange Quälereien im Fitnessstudio doch lohnten. Auch ihre Lippen waren noch weich und voll. Das konnte sie von den meisten ihren mehr oder weniger gleichaltrigen ehemaligen Freundinnen nicht behaupten. Deren Lippen wirkten auf dem Gesicht häufig wie vertrocknete, dünne Striche.
Eine Bestätigung ihrer Selbstdiagnose hatten, wenn auch ungewollt, die drei Männer geliefert, mit denen sie in den letzten Wochen geschlafen hatte. Diese vermittelten nach dem Beischlaf allesamt den Eindruck, dass sie ihre körperliche Fitness und weichen Lippen zu schätzen wussten. Doch letztlich war das bedeutungslos, da es sich bei dem Sex nur um eine Position auf ihrer to-do-Liste handelte, die sie nun ohne weitere Emotionen abhaken konnte.
Sie fragte sich allerdings, ob die Männer sie auch so hemmungslos gevögelt hätten, wenn ihnen klar gewesen wäre, mit wem sie da im Bett lagen. Sie hatte viel Aufwand betrieben, um aus ihrer Wohnung sämtliche persönlichen Fotos oder Gegenstände zu verbannen, die Rückschlüsse auf ihre Person zuließen.
Einen Prost auf ihre Gründlichkeit.
Noch einen Prost darauf, dass sie ihren Geburtstag vor vier Tagen allein gefeiert hatte.
Sie gab ihrem Spiegelbild einen Luftkuss und hob das zur Hälfte geleerte Glas Rotwein in ihrer Hand, bevor sie es mit einem Zug austrank. Es war ein zu großer Schluck. Die Flüssigkeit lief zu beiden Seiten aus ihren Mundwinkeln, tropfte auf ihre Brüste, um sich anschließend in kleinen Lachen auf dem honigfarbenen Parkett zu sammeln. Sie versuchte, mit dem linken großen Zeh ein Fragezeichen aus der Flüssigkeit auf dem Fußboden zu formen, gab es aber schnell auf, weil sie Probleme mit dem Gleichgewicht bekam.
Ihr Blick fiel auf die Weinflasche, eine Vega Sicilio Unica Grand Reserva von 1995, die sie in der letzten Stunde geleert hatte. Das Getränk entsprach ihren Erwartungen in jeder Hinsicht zur vollsten Zufriedenheit. Mit einem angeheitertem Grinsen stellte sie fest, dass auch der Kaufpreis dafür, 1.320 Euro, eine wirklich sinnvolle Investition gewesen war. Genau wie bei den anderen Flaschen, die sie in den letzten Wochen getrunken hatte. Sie war noch nie eine gute Weinkennerin gewesen, doch bei der nicht so lange zurückliegenden Auswahl der Weine legte sie großen Wert auf ein gewisses Preisniveau, welches meistens einher ging mit einer erstklassigen Qualität. Das war sie sich schuldig. So mochte der Gesamtwert der Getränke insgesamt dreißigtausend Euro betragen, was jedoch ihren Kontostand nur marginal schmälerte.
Während sie mit den Augen die Stelle suchte, an der sie in weiser Voraussicht eine neue, bereits geöffnete Weinflasche abgestellt hatte, fiel ihr Blick auf die nur angelehnte Tür des Badezimmers. Sie nickte vor sich hin, als hätte sie der Anblick an etwas erinnert, was fast in Vergessenheit geraten wäre.
Auf nackten Füßen, wobei sie sich kurz an einer Wand abstützen musste, ging sie in den Raum, der ehemals ihr Schlafzimmer gewesen war. Sie lächelte dem glänzenden Parkett spitzbübisch zu, um sich dann zurück in den Flur und von dort aus in ihr Wohnzimmer zu begeben. Dabei handelte es sich um einen fünfzig Quadratmeter großen Raum mit Stuck an der Decke und Zugang auf einen Balkon, von dem man die gläserne Kuppel des Reichstags sah. Vermutlich war es nicht jedermann Sache, in seiner Freizeit die Arbeitsstätte der letzten zwanzig Jahre in Sichtweite zu haben, aber ihr gefiel der Ausblick. Sie ging mit langsamen, unsicheren Schritten weiter durch ihre Wohnung. Zweihundert Quadratmeter in allerfeinster Lage, die sie seit Jahren allein bewohnte. Keiner der Räume in ihrer Wohnung war – sofern man den Spiegel im Flur nicht dazuzählte – noch in irgendeiner Form möbliert. Die Spedition hatte fast zwei Tage benötigt, um alles abzutransportieren.
Sie hob die Weinflasche auf, die sie in eine Ecke des leeren Flures gestellt hatte, und betrat als letztes Zimmer das Bad. Als sie die Tür hinter sich schloss, konstatierte sie trotz ihres alkoholisierten Zustandes, dass sie alles perfekt vorbereitet hatte.
Auf dem Rand der Badewanne standen sieben Duftkerzen, die die einzige Lichtquelle darstellten. Vor einer Stunde hatte sie den Geruch noch als belebend empfunden, doch mittlerweile war dieses Gefühl erloschen.
Am Kopfende der Wanne stand eine kleine Dose, die ein grobkörniges, weißes Pulver enthielt. Neben der Dose wiederum lag ein Klappmesser. Es sah aus wie eines von der Sorte, das vielleicht Friseure aus nostalgischen Gründen nutzten oder ihre Berufskollegen im Orient.
Der Füllstand der Badewanne ließ sich nur ahnen, da der Schaum die Wasserfläche vollständig bedeckte.
Sie stellte das Glas und die Weinflasche vorsichtig auf den gefliesten Wannenrand.
Als sie in die Badewanne stieg, umfing das noch heiße Wasser ihren Körper wie eine liebevolle Umarmung. Sie tauchte so tief unter wie möglich, wo sie das wohlige Gefühl eine Weile auf sich wirken ließ. Doch schließlich setzte sie sich auf – sie musste diese Sache erledigen, um endlich ihren Frieden zu finden.
Sie öffnete die Dose, um dann mit einer resoluten Bewegung das Pulver darin in ihr leeres Weinglas zu kippen. Schließlich goss sie das Glas voller Wein, bevor sie unbeholfen mit einem Finger darin herumrührte, so dass ein trüber Sud entstand.
Ein paar Sekunden betrachtete sie das Glas in ihrer Hand, während sie überlegte, ob dieser Schritt wirklich der Richtige war. Eine weitere Sekunde später hatte sie sich diese Frage beantwortet.
Sie setzte das Glas an ihre Lippen und trank es mit einem Zug aus. Es schmeckte widerlich, da half auch der teuerste Wein nicht. In einem plötzlichen Anfall von Panik goss sie das Glas erneut voll, schwenkte es kurz hin und her, um dann den immer noch bitteren Sud entschlossen hinunterzuschlucken.
Wenn sie sich nicht in den nächsten Minuten erbrach, hatte sie ihr Ziel so gut wie erreicht. Da sie Zeit ihres Lebens eine penible Person gewesen war, würde sie danach dafür sorgen, dass auf den letzten Metern nichts mehr schief lief.
Sie streifte sich den Schaum vom linken Handgelenk, um ihre Adern zu begutachten. Ihre Arme waren im Laufe der letzten Jahre dünner geworden, so dass sie jetzt fast sehnig wirkten. Sie setzte das Barbiermesser an und führte mit einer einzigen schnellen Bewegung einen leicht diagonalen Schnitt vom Handgelenk in Richtung ihres Ellenbogens durch. Der Schmerz ließ sie – obwohl sie vor dreißig Minuten bereits zwei 800er Ibuprofen genommen hatte – kurz aufschreien. Doch als sie ihren Arm wieder in das warme Wasser tauchte, verebbte langsam das Pochen und Ziehen, um von einem gleichmäßigen Druck ersetzt zu werden.
Erschöpft, aber trotzdem zufrieden gestattete sie ihrem Körper, sich zu entspannen. Was getan werden musste, hatte sie getan. Drei weitere 800 Ibuprofen sowie fünfzehn laienhaft zerstoßene Schlaftabletten würden ihre Wirkung nicht verfehlen. Die offene Pulsader war lediglich die Absicherung.
Sie dachte an ihre glückliche Kindheit zurück, an ihre spröde Ehe, an die letzten furchtbaren Monate. Anfangs hatte sie sich und anderen noch etwas von einem Burn Out vorlügen können. Nach einigen Wochen jedoch wusste jeder in ihrem Umfeld, dass sie mit Dämonen kämpfte, die von anderer Natur waren. Es folgten erniedrigende psychiatrische Behandlungen, die sie verwirrten, noch tiefer in den zwischenzeitlichen Wahnsinn eintauchen ließen und sie mehr und mehr einsam machten.
Sie schloss kurz die Augen, als die ersten dunklen Wellen der Gleichgültigkeit, wie ein sanftes Echo oder als wären sie von weit entfernten Gestaden gekommen, in ihr Bewusstsein schwappten.
Ihr Körper wehrte sich dagegen, doch auch mit offenen Augen flimmerten die Erinnerungen weiter an ihr vorbei wie der Abspann eines alten Schwarz-Weiß-Filmes.
Der Prozess verlief unaufhaltsam. Sie verlor stückchenweise die Kontrolle über ihr Leben, wobei sie regelmäßig zu einer bösartigen, jähzornigen Frau mutierte. Als Konsequenz darauf zogen sich auch die treuesten Freunde nach und nach zurück.
Der lastende Druck an ihrem malträtierten Unterarm verklang langsam, während ihre Gesichtszüge weich wurden. Sie konnte spüren, wie die Dunkelheit sich in ihr ausbreitete, wie die einzelnen Wellen zu einer gleichmäßigen Brandung wurden, wie ihr Körper erschlaffte und ein kleines Stück weiter ins warme Wasser rutschte.
Hoffentlich, dachte sie matt, beachten die, die mich suchen, den Hinweis auf dem Zettel an der Badezimmertür. Als Warnung zu verstehen stand darauf, was sie in der Badewanne vorfinden würden. Unabhängig davon, ob man sie in drei Tagen oder drei Monaten fand, ihr Anblick würde in jedem Fall unerfreulich sein.
Es war angenehm und ungemein befriedigend, diese tiefe Müdigkeit zu spüren, dieses vollständige Loslassen, was einer Schwerelosigkeit gleichkam.
Einer ihrer letzten Gedanken war, dass sich so Astronauten fühlen mussten: Diese wunderbare Leichtigkeit, mit der sie einsam zwischen den Sternen schwebten. Ein winziger Mensch vor dem tiefschwarzen Hintergrund, der mit kleinen hellen Lichtern übersät war, die freundlich blinkten – wie eine Einladung, sie besuchen zu kommen.
Minuten später fühlte sie kaum noch, wie ihr die Realität entglitt. Das, was in ihrem Gehirn vor sich ging, führte zu keinem Ergebnis mehr, zu keiner Schlussfolgerung oder überhaupt etwas, sondern war nur noch ein einziges dumpfes, leiser werdendes Summen.
Ihr nackter Leib glitt unkontrolliert ein weiteres Stück ins Wasser, doch diesmal spürte sie weder die Bewegung, noch irgendetwas anderes. Der Kopf von Marita Wendt ruhte mitten zwischen den weichen Kissen aus Schaum, als die Dunkelheit für immer Besitz von ihr nahm.
5
MADEMOISELLE DÉTECTIVE
Der korpulente Mann, der im Schatten des Eingangsportals vor sich hin döste, hob den Kopf, als er das Motorengeräusch hörte. Ein weißer Range Rover Velar fuhr langsam die Einfahrt empor. Das Fahrzeug umrundete den riesigen Rhododendronbusch in der Mitte des Hofes, wo es schließlich zum Stehen kam.
Die Frau, die dem Fahrzeug entstieg, trug einen tiefroten, knielangen Rock und eine schwarze, kurzärmlige Bluse. Ihr linker Arm war vollständig von Tattoos übersät, einem Farbfeuerwerk an Kolibris, Schlingpflanzen, Blüten und Schmetterlingen. An ihre Füße und Waden schmiegten sich ebenfalls schwarze Stiefel, die genauso glänzten wie ihre dunklen Haare, die in sanften Wellen bis unterhalb ihrer Schulterblätter fielen.
Die Augen der Frau wanderten aufmerksam und schnell über die Vorsprünge, Sandsteinfiguren und Arabesken des Gebäudes, bis sie schließlich an der männlichen Gestalt hängen blieben. Als die Frau wenige Sekunden später unmittelbar vor ihm stand, versteifte sich sein Körper, während seine Lippen schmaler wurden. Er hielt die Kladde mit den Namen der angemeldeten Besucher nun nah vor seine kurzsichtigen Augen, als wäre sie ein Schutzschild.
Es konnte an diesem späten Sommernachmittag nur einen einzigen Grund geben, warum die Frau hier erschien, aber er befolgte stoisch seine Anweisungen: „Kann ich Ihnen helfen?“ Die Frage sollte dezent hilfsbereit klingen, dennoch schwang ein leichter Unterton mit, der Misstrauen und Ablehnung beinhaltete.
„Ich möchte zu Svenja van Merck, um zu kondolieren. Mein Name ist Sarah Dumont.“
„Sarah…?“
„Dumont.“
„Dumont“, wiederholte er grüblerisch. „Wie der Reifenhersteller?“
Die Frau legte den Kopf etwas schief, als könnte sie den dicken Mann dadurch besser sehen. Im Laufe der Jahre hatte sie auf die Frage nach ihrem Nachnamen schon sehr viele Assoziationen gehört, aber das hatte sie noch niemand gefragt. Sie überlegte, ob eine knackige Antwort geeignet wäre, doch der heutige Tag war nicht wirklich prädestiniert für derlei Dinge. Sie entschied sich für die humorlose Variante. „Vermutlich meinen Sie Dunlop. Die Antwort ist also `Nein´.“
„Sie sind spät dran“, offerierte der Mann ihr schließlich missmutig, als er ihren Namen gefunden hatte. „Hinter Ihrer Anmeldung steht: Ankunftszeit 16.00 Uhr. Nicht 18.30 Uhr. Sie haben Glück, dass sie noch hier ist.“
Okay, wahrscheinlich mochte er sie nicht, vielleicht kam er sich auch vorgeführt vor. Ein nachsichtiges Lächeln erschien auf dem Gesicht von Dumont. „Das mag ja sein. Aber ich dachte, in der offiziellen Information zur Kondolenz hätte gestanden, dass sie bis 19.00 Uhr Besuch empfängt. Wie man sich doch täuschen kann. Wenn ich mich in der Reihe hinten anstellen soll – sagen Sie es einfach.“
Sie sah sich demonstrativ um, wohl wissend, dass außer ihr kein weiterer Besucher wartete.
Der vierschrötige Kerl starrte verbissen an ihr vorbei den Range Rover an. „Sie ist in der Bibliothek. An der Treppe vorbei, den Gang geradeaus, letzte Tür links“, knurrte er schließlich. „Fassen Sie nichts an“, schob er giftig nach.
Sarah Dumont betrat das Haus, wo sie die Stille alter Mauern umfing, die sie augenblicklich in eine andere Zeit versetzte. Nichts, so schien es, war jünger als einhundert Jahre. Die seltsam trockene Luft roch abgestanden und leicht süßlich wie in einer Krypta. Zwei überdimensionale Gemälde hielten eigenartig entrückte Szenen fest, die auch gut zu einer satanischen Sekte gepasst hätten. Das matte Zwielicht der Deckenleuchten schien wie geschaffen dafür, sich zu verstecken, um anderen aufzulauern. Was noch fehlte waren Totenschädel in den Regalen, Folterwerkzeuge an den Wänden oder der Hinweis, dass das Haus als Kulisse für Gruselfilme gedient hatte. Sie fragte sich, wie sich die Bewohner des Hauses in dieser düsteren Umgebung wohl fühlen konnten.
Der Beschreibung des Türstehers folgend, öffnete sie am Ende des Ganges die linke Tür und betrat die Bibliothek.
Wieder wurde sie überrascht. Hatte sie sich die Bibliothek als einen weiteren musealen, verschrobenen Raum vorgestellt, so musste sie nun ihre Annahme revidieren.
Es handelte sich offenbar um einen neuen, vom Eingang des Hauses nicht sichtbaren Anbau. Breite Glasfronten gewährten einen ungehinderten Blick in den Garten, den eine bemerkenswerte Eiche dominierte. Sowohl an den Wänden als auch scheinbar willkürlich im Raum stehend, aber immer bis zur Decke reichend, standen ein Dutzend schlichte Regale. Sie waren mit dicken Böden versehen, die die Last einer unglaublichen Anzahl Bücher aufnahmen. Seitlich neben einer Fensterfront stand ein Ecksofa mit einem Beistelltisch, der zur Hälfte von einer üppigen Grünpflanze verdeckt wurde. Ein Ohrensessel mit abgenutzter Polsterung thronte ein Stück neben der Tür vor einem offenen Sideboard, in dem sich wiederum Bücher befanden.
Fast mittig platziert war ein ebenfalls mit Büchern bestücktes rundes Regal. Alles in allem spiegelte der Raum eher den Charme einer modernen Buchhandlung mit mehreren gemütlichen Leseecken wieder als einer altehrwürdigen Bibliothek.
„Wenn Sie mich suchen: ich bin hier“, ertönte überraschend eine ruhige, weibliche Stimme.
Sarah Dumont ging um das runde Bücherregal herum.
Auf einem olivgrünen Kanapee saß, aufrecht und würdevoll, eine zierliche ältere Dame. Sie trug ein enges graues Kleid mit dunklen Applikationen, das selbst im Sitzen noch raffiniert geschnitten aussah. Die weißen Haare und ihre Pagenfrisur passten perfekt zu ihrem intelligenten und leicht gebräunten Gesicht. Ihre graublauen Augen glänzten, doch Sarah Dumont vermochte nicht zu sagen ob das davon kam, dass sie geweint hatte.
Auf einem kleinen Getränkewagen neben dem Sofa standen eine zur Hälfte gefüllte Flasche Rotwein sowie ein fast leeres Weinglas. Daneben lagen ein aufgeschlagenes Buch und ein Smartphone.
„Mein Name ist Sarah Dumont“, stellte sie sich artig vor.
„Ich weiß“, sagte die weißhaarige Frau, „Hannes hat mich soeben informiert.“ Die alte Frau besaß eine klare, angenehme Stimme, die jedoch wenig Widerspruch zu dulden schien.
„Ich möchte Ihnen mein…“
„…Beileid ausdrücken. Vielen Dank.“
Auch wenn Dumont nicht über viel Erfahrung mit Trauerfeiern verfügte, so empfand sie das Verhalten von Svenja van Merck doch als ungewöhnlich. Es entstand eine kleine Pause, in der sie sich plötzlich fragte, ob es wirklich sinnvoll gewesen war, hier her zu kommen.
Die ältere Frau bemerkte die Irritation auf dem Gesicht von Dumont. „Entschuldigung, ich wollte Sie nicht verunsichern. Aber wenn man dreißig Mal am Tag den gleichen traurigen Satz hört, auch wenn es sich um eine ernste Angelegenheit und Mitgefühl handelt … nun ja, irgendwann wird man dessen müde.“
Eine ehrliche, nachvollziehbare Aussage, fand Dumont.
„Sarah Dumont“, sprach van Merck unvermittelt weiter und musterte Dumont nun mit einem eigentümlichen Blick. „Ich vermute, mit der Verlegerdynastie sind Sie nicht verwandt?“
„Nicht, dass ich wüsste.“
„Ich könnte schwören, Ihren Namen schon einmal gehört zu haben.“ Die Frau mit der Pagenfrisur änderte ein wenig ihre Sitzhaltung, wobei sie unauffällig auf ihre teuer wirkende Armbanduhr sah. “In welcher Beziehung standen Sie zu meinem Mann, wenn ich fragen darf?“
Das sollte beiläufig klingen, aber Dumont konnte die Sorge einer Frau heraushören, deren Mann zu oft bis in die späten Abendstunden Termine gehabt hatte.
„Ich bin die `Mademoiselle Détective´.“
Svenja van Merck sah sie mit einem fragenden Gesichtsausdruck an. „Ich kann Ihnen nicht ganz folgen.“
„Vor zwölf Jahren geriet ein deutscher Spitzenpolitiker in die Schlagzeilen, Burkhardt von Meerbusch-Weichsel, auch kurz BMW genannt. Leider hat er nicht nur Politik betrieben, sondern auch mit Erpressung, Entführung sowie Mädchenhandel zu tun. Ein Schwein, der seine staatlichen Aktivitäten genutzt hat, um sein wahres Ich zu verschleiern. Ich habe damals bei einer eher kleineren Tageszeitung gearbeitet und die Sache ausgegraben. Ihr Mann hat mich trotzdem von Anfang an unterstützt und letztlich den Prozess gegen den Drecksack gewonnen. Seitdem betitelte er mich gelegentlich als `Mademoiselle Détective´. Und bitte entschuldigen Sie meine Wortwahl.“
Das war noch nicht einmal die halbe Wahrheit darüber, was sie mit Paul van Merck verband, doch sie hielt es an einem Tag wie diesen für unklug, Öl ins Feuer zu gießen.
Die Frau auf dem Sofa akzeptierte die Erklärung mit einem knappen Nicken. „Abgesehen davon, dass Paul zu diesem Zeitpunkt noch nicht mein Mann war ... ja, jetzt erinnere ich mich. Er hat davon erzählt. Auch wenn er den Prozess gewonnen hatte – die Anwaltskammer war nicht amüsiert. In Folge hat es ihn damals einhunderttausend Euro Strafe gekostet, fast die anwaltliche Zulassung und einige wichtige Klienten. Wussten Sie das?“
Paul van Merck hatte Dumont im Detail davon erzählt, ihr jede Einzelheit der ihm erwachsenen Konsequenzen mitgeteilt. Aber er tat dies nicht, um besser dazustehen, sondern um ihre die Unberechenbarkeit des Rechtsystems, das er vertrat, zu offenbaren. „So im Detail wusste ich es nicht. Ich weiß nur, dass Meerbusch-Weichsel auch noch im Gefängnis durch seine alten Kontakte über außerordentlich viel Einfluss verfügte, zumindest die erste Zeit. Außerdem war er nicht der Einzige, der über die Klinge gesprungen ist. Das Ergebnis war dann wohl eine dubiose Entscheidung der Anwaltskammer. Ihr Mann hätte deren Entscheidung vor Gericht anfechten können, ist aber zu der Erkenntnis gekommen, dass dadurch noch mehr Schaden entstehen würde.“
„Er hatte sicherlich seine Gründe.“
„Ich glaube, einer dieser Gründe war ich. Meerbusch-Weichsel hat auch auf mich eine Hexenjagd veranstalten lassen. Ich sollte wegen Verleumdung, Falschaussage und Urkundenfälschung zwei Jahre ins Gefängnis. Die Anklage lief schon, auch wenn jeder wusste, dass die ganze Sache fingiert war. Nur weil Ihr Mann sich nicht gegen die Anwaltskammer gewehrt hat, wurde meine Strafe miniert. Er hat sozusagen einen Deal gemacht, um mir den Hintern zu retten.“
Svenja van Merck musterte Dumont unverhohlen. „Nichts für ungut, aber in gewissem Sinne wäre es irgendwie auch ungerecht gewesen, wenn mein Mann der alleinige Leidtragende gewesen wäre. Wie hoch ist Ihre Strafe ausgefallen?“
Dumont war sich nicht sicher, ob diese Bemerkung garstig gemeint war oder nicht. „Ich habe deswegen drei Monate im Gefängnis gesessen, um anschließend meinen Job zu verlieren. Das war der ausgehandelte Deal.“ Dumont zwang sich zu einem Lächeln. „Aber hey, shit happens. BMW war neun Jahre im Knast. Dort war er – wie solche Typen meistens – äußerst beliebt. Er ist in dieser Zeit mehrmals böse gestürzt, und das immer sehr unglücklich. Wie ich hörte, hat er einen künstlichen Unterkiefer oder etwas in der Art. Draußen hat er keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen. Ich finde, das war es wert. Zumindest, was meine Person betrifft.“
Die Frau mit der Pagenfrisur griff zu der Weinflasche und goss das Glas voller, als es vernünftig gewesen wäre. „War Ihnen nicht klar, welche Probleme auf Sie zukommen können, wenn Sie in dieser Liga im Trüben fischen?“
„Doch. Natürlich“, antwortete Dumont. An Warnungen darüber, dass Meerbusch-Weichsel ein unkalkulierbarer Drecksack mit ausgezeichneten Verbindungen war, hatte es nicht gefehlt. „Aber es kommt immer darauf an, wie stark man sich einem Unrecht verbunden fühlt. Entsprechend ist man auch bereit, sich so weit zu engagieren, dass die eigenen Belange erst ziemlich weit hinten kommen. Oder, um es etwas prosaischer auszudrücken, im Kampf für Gerechtigkeit und Wahrheit lohnt es sich, Risiken einzugehen.“
„Ihre Motivation muss demzufolge recht hoch gewesen sein, auch wenn Ihr letzter Satz die Anmutung eines Glückskeks-Spruches hat“, lächelte van Merck ein wenig. „Auf jeden Fall sieht es so aus, als hätten mein Mann als Rechtsanwalt und Sie die gleichen Ideale geteilt.“
Wenn Svenja van Merck wüsste, woher sie ihre Motivation bezogen hatte, dachte Dumont. Und dass Paul van Merck der einzige Mensch gewesen war, dem sie damals so weit vertraute, ihm ihr wild zusammengestelltes Sammelsurium an `Beweisen´ zu übergeben. Er hatte über einen Monat benötigt, um die relevanten Dokumente, Fotos und Belege aus dem Wust der Unterlagen heraus zu sortieren. Ein Monat, in dem ihre Vergangenheit nach ihr griff, an ihr zerrte und die Bilder in ihrem Kopf wieder begannen, ein schmutziges Eigenleben zu führen.
„Ja. Ich war und bin für die Unterstützung Ihres Mannes immer sehr dankbar.“ Im selben Augenblick fragte sich Dumont, ob ihre Worte für Svenja an Merck die gleiche Bedeutung hatten wie für sie. „Und, dass er mir überhaupt geglaubt hat.“
„Wie da so ist mit Dingen, die auf den ersten Blick wenig wahrscheinlich sind: Manchmal glaubt man sie und manchmal eben nicht“, sagte van Merck kryptisch. „Sie können sich übrigens gern irgendwo hinsetzen.“
Sarah Dumont sah sich um. Die Bezeichnung `irgendwo´ traf es ziemlich genau. Die nächste Sitzgelegenheit, ein schwerer, plüschiger Hocker, stand mindestens fünf Meter von ihr entfernt. Sie fragte sich, wie van Merck die Situation bei den anderen Besuchern gelöst hatte, die der alten Frau ihr Beileid bekunden wollten. „Danke“, antwortete sie, wobei sie einfach dort stehenblieb, wo sie stand.
Die alte Frau nickte abwesend. „Genaugenommen kannten Sie ihn länger als ich.“
„Ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann“, widersprach Dumont nach einigen Sekunden des Nachdenkens. „Er hat mich die ersten Jahre nach dieser Sache immer Mal zum Essen eingeladen. Da haben wir über Gott und die Welt gesprochen, er hat mir ungefragt Tipps für mein Leben gegeben oder mich aufgemuntert, wenn es bei mir schlecht lief. Es gab auch ein paar Telefonate zwischendurch – aber so richtig gekannt, glaube ich, habe ich ihn nicht.“
„Trotzdem. Ich weiß, dass er Sie mochte.“
Dumont sah Svenja van Merck überrascht an. Offensichtlich hatte deren verstorbener Gatte öfter von ihr gesprochen, als sie angenommen hatte.
„Ich mochte ihn auch. So, wie man einen … Mentor mag.“
Svenja van Merck sah Dumont aus ihren blaugrauen Augen auf eine Art und Weise an, die ihr ein leichtes Frösteln verursachte.
„Glauben Sie, er war der Typ für einen Selbstmord?“
Die Frage überraschte Dumont völlig. Über den Suizid von Paul van Merck hatte sie vor wenigen Tagen zufällig in der Presse gelesen. Nur aus diesem Grund war sie hier. Inwieweit ein Mensch wie er selbstmordgefährdet war – damit hatte sie sich nie auseinandergesetzt. Genauso erstaunlich war die Tatsache, dass seine Witwe ausgerechnet sie fragte.
„Wir hatten ungefähr die letzten sechs Jahre keinen Kontakt mehr“, begann sie zögernd. „In diesem Zeitraum kann viel passiert sein.“ Van Merck hatte seine Frau vor knapp sieben Jahren geheiratet. Möglicherweise bestand ein Zusammenhang zwischen diesem Umstand und der Tatsache, dass er die Treffen mit ihr nicht fortgeführt hatte. „Aber bis dahin – nein, ich glaube nicht, dass er der Typ Mensch war, der Hand an sich legt.“
„Ich verstehe es ebenfalls nicht.“
Die erste Frau ihres Mentors war zwei Jahre nach Beendigung des Prozesses verstorben. Das hatte ihn verschlossener und einsilbiger gemacht, aber nicht depressiv. Vielleicht jedoch hatte die Heirat mit Svenja etwas in ihm ausgelöst, holte den Schmerz über den erlittenen Verlust erneut hervor? Vielleicht war er über den Tod seiner ersten Frau nie wirklich hinweggekommen, sondern hatte die Ereignisse immer nur verdrängt? So, wie sie jetzt noch Dinge beschäftigten, die mehr als fünfundzwanzig Jahre zurück lagen? „Vielleicht hatte er Sorgen, von denen Sie nichts wussten? Privat? Finanziell?“
Der Bick von Svenja van Merck verriet eine leichte Belustigung, als hätte ihre Gesprächspartnerin einen Witz gerissen, der sich bei eingehender Betrachtung jedoch nicht als besonders originell erwies. „Sorgen? Hin und wieder haben wir gestritten, wie alle anderen Ehepaare auch.“ Sie sah nach draußen, als ließe sie Erinnerungen Revue passieren. „Doch wir haben anschließend über unsere Probleme gesprochen. Außerdem waren unsere Differenzen eher untergeordneter Natur. Nichts Gravierendes. Nichts von Dauer. Er hatte keine Sorgen. Nicht mit mir und auch mit niemand anderen sonst.“ Sie betrachtete eine Weile das Glas Rotwein auf die gleiche distanzierte Art, wie sie vorhin Sarah Dumont gemustert hatte. Dann fuhr sie fort. „Er besaß neben dieser Villa ein Anwesen in der Bretagne sowie ein sehr schönes Apartment in New York, wohin ich mich in den nächsten vierzehn Tagen zurückziehen werde. Er hatte schon vor unserer Heirat Beteiligungen an einem halben Dutzend international agierender Firmen, die alle nach wie vor schwarze Zahlen schreiben. Sein Vermögen wurde solide und konventionell verwaltet von einer Privatbank. Er hat nicht spekuliert, er hatte keine Schulden, er war kein Spieler. Ich würde wissen, wenn es da Probleme gegeben hätte.“
Natürlich konnte man immer die Frage stellen, ob Svenja van Merck wirklich in alle finanziellen Angelegenheiten ihres Mannes zu einhundert Prozent involviert war, sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht. Aber vielleicht war Paul van Merck ja der seriöse Eheund Geschäftsmann, der seine Frau an allen Entscheidungen beteiligt oder sie zumindest informiert hatte. Möglicherweise lag das Problem woanders.
„Er war ein international renommierter Anwalt. Da macht man sich sicherlich nicht nur Freunde. Ich weiß nicht, möglicherweise … gibt es in dieser Hinsicht Anhaltspunkte? Offene Rechnungen von früher? Drohungen? Merkwürdige Anrufe?“ Dumont ließ eine kleine wirkungsvolle Pause, bevor sie nachlegte. „Vielleicht hatte er vor irgendetwas Angst?“
Die alte Frau schloss theatralisch die Augen, wie um Dumont zu beweisen, dass sie ernsthaft über eine Frage nachdachte, die sie eigentlich für völligen Unsinn hielt.
„Ausgeschlossen“, urteilte van Merck schließlich. „Er hat seine Anteile an der Kanzlei ein Jahr nach unserer Hochzeit veräußert. Danach war er nur noch stiller Teilhaber, bis er schließlich diesen Abschnitt seines Lebens komplett hinter sich gelassen hat. Nach meiner Kenntnis bekam er nie wieder einen Anruf, der sich auf irgendeinen Fall bezog. Dieses Kunststück ist ihm gelungen, weil er seinen Abgang zwei Jahre lang gründlich vorbereitet hat.“
Svenja van Merck sah erneut auf ihre Armbanduhr, was darauf schließen ließ, dass sie entweder weiteren Besuch erwartete oder ihr das Gespräch mit Sarah Dumont zu lange dauerte.
„Hätte er in Angst vor möglichen Konsequenzen seiner früheren Tätigkeit gelebt, dann wäre das alles schon vor fünfzehn oder zehn Jahren geschehen. Selbst der Kampf gegen Blackwater hat keine Spuren hinterlassen.“ Van Merck schüttelte traurig den Kopf. „Und dabei hat er sich so auf den neuen Job gefreut. Schon deshalb verstehe ich es nicht.“
Sarah Dumont sah sie überrascht an. „Ein neuer Job? Ich dachte, er hätte sich zur Ruhe gesetzt – gemeinsame Zeit mit Ihnen, die Früchte der Arbeit genießen und dergleichen?“ Das war eine nicht unwesentliche Frage: Was bewog einen Menschen wie Paul van Merck, sich in seinem Alter noch mit geregelten Arbeitszeiten herumschlagen zu wollen? Er hatte ein erfülltes Berufsleben hinter sich, sein Kontostand ließ mit Sicherheit keine Wünsche offen – warum also das Wagnis eines Angestelltenverhältnisses auf sich nehmen? „Was war das für ein Job?“
„Dazu kann ich Ihnen wenig sagen. Eine Art Beratertätigkeit für ein Ministerium. Es gab ein Auswahlverfahren, aus dem er als Sieger hervorgegangen ist. Mehr durfte er mir nicht darüber erzählen“, erklärte sie, um sich gleich darauf das Weinglas an die Lippen zu setzen und es in einem Zug auszutrinken. Dumont hoffte, dass dies nicht ihren normalen Trinkgewohnheiten entsprach.
„Was haben Sie gesagt, als er sich dafür beworben hat?“, buhlte Dumont um mehr Informationen.