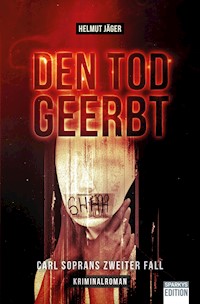4,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Sparkys Edition
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der Sommer der Schuldigen. Finnland. »Das Boot schaukelte sanft im Rhythmus der Wellen und trieb langsam auf den See hinaus. Die Ruder hingen über Bord und klopften mit leisen, dumpfen Schlägen an den Rumpf. Auf der anderen Seite des Sees legte sich ein orangeroter Streifen hinter die Wipfel der hochgewachsenen Kiefern und Fichten. Es war Mittsommer. Der Tag wollte nicht gehen und die Nacht nicht kommen.« Oberschwaben. »Der Blick richtete sich hinüber auf den Kahlschlag und danach in den Abendhimmel. Zwei Flugzeuge kreuzten ihre Kondensstreifen, eines kam aus den weißen Wolkentürmen. Das andere verschwand darin.« Ein finnischer Unternehmer verschwindet aus seinem Sommerhaus am See. Ein Oberschwäbischer Jäger kehrt aus dem Altorfer Wald nicht mehr zurück. Der Journalist Carl Sopran gerät wider Willen in ein Familiendrama, das weit über die Grenzen Oberschwabens hinausreicht und begibt sich seinerseits auf die Jagd nach einem Phantom, das handelt, wie ein Gepard in der Savanne: Unsichtbar im hohen Gras. Reaktionsschnell. Ausdauernd. Immer auf der Hut. Unerbittlich. Carl Soprans erster Fall.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Zum Buch
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Epilog
Der Autor Helmut Jäger
Sparkys Edition
Zum Buch
Der Sommer der Schuldigen.
Finnland. »Das Boot schaukelte sanft im Rhythmus der Wellen und trieb langsam auf den See hinaus. Die Ruder hingen über Bord und klopften mit leisen, dumpfen Schlägen an den Rumpf. Auf der anderen Seite des Sees legte sich ein orangeroter Streifen hinter die Wipfel der hochgewachsenen Kiefern und Fichten. Es war Mittsommer. Der Tag wollte nicht gehen und die Nacht nicht kommen.«
Oberschwaben. »Der Blick richtete sich hinüber auf den Kahlschlag und danach in den Abendhimmel. Zwei Flugzeuge kreuzten ihre Kondensstreifen, eines kam aus den weißen Wolkentürmen. Das andere verschwand darin.«
Ein finnischer Unternehmer verschwindet aus seinem Sommerhaus am See. Ein Oberschwäbischer Jäger kehrt aus dem Altorfer Wald nicht mehr zurück.
Der Journalist Carl Sopran gerät wider Willen in ein Familiendrama, das weit über die Grenzen Oberschwabens hinausreicht und begibt sich seinerseits auf die Jagd nach einem Phantom, das handelt, wie ein Gepard in der Savanne: Unsichtbar im hohen Gras. Reaktionsschnell. Ausdauernd. Immer auf der Hut. Unerbittlich.
Carl Soprans erster Fall.
Helmut Jäger
Komm und stirb
das Grab an der Schussen
Carl Soprans erster Fall
Kriminalroman
Impressum
Alle Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen oder Institutionen sind reiner Zufall.
Alle Rechte unterliegen dem Urheberrecht.
Verwendung und Vervielfältigung von Text und Bild nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages.
Lektorat: Hubert Romer
Korrektorat: Hubert Romer
Umschlaggestaltung: Jens Vogelsang
© 2025 Sparkys Edition
Herstellung und Verlag: Sparkys Edition,
Zu den Schafhofäckern 134, 73230 Kirchheim/Teck
E-Mail: [email protected]
Druck: Stückle Druck Ettenheim
ISBN: 978-3-949768-38-5
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Prolog
Vorsichtig nahm er das Buch aus dem Regal.
»Georg Trakl, Die Dichtungen«.
Wie oft er in den vergangenen zwanzig Jahren darin geblättert und gelesen hatte, wusste er nicht mehr. Neben einem Halskettchen mit goldenem Kreuzanhänger war es alles, was ihm zur Erinnerung an seine Mutter geblieben war. Vor knapp zwanzig Jahren, als er volljährig geworden war, hatte ihm seine Tante, die auch seine Pflegemutter gewesen war, beides als einziges Vermächtnis und Gedenken an seine leibliche Mutter ausgehändigt. Verpackt in einem kleinen Schuhkarton, der mit den Jahren schon etwas vergilbt, aber sichtlich bis dahin noch nicht geöffnet worden war.
Für ihn hatte es nie eine andere Mutter als seine Tante gegeben. Die Erinnerungen, die sich ein dreijähriges Kind bewahren kann, hatten sich mit den Jahren verflüchtigt. Zu seiner damals fast fünfzehn Jahre alten Stiefschwester konnte er kaum eine Beziehung aufbauen, sie verließ bereits drei Jahre später das Haus und ging zum Studieren nach Freiburg. Im Jahr darauf war auch der Onkel unerwartet verstorben. Sein noch junges Leben war vom Verlust von Bezugspersonen geprägt gewesen.
Das Buch, das er in der Hand hielt, war eingebunden, wie es früher bei Schulbüchern üblich gewesen war: dunkelblaues, leicht glänzendes Papier mit dezentem Rautenmuster, an den umgeschlagenen Innenseiten mit Klebestreifen befestigt, die er in den vergangenen zwanzig Jahren regelmäßig erneuert hatte.
Als Schüler hatte er keinen besonderen Bezug zur Literatur gehabt – und zu Gedichten schon gar nicht. Er war damals ein nüchterner Junge gewesen, der früh erwachsen geworden war. Als er das Buch zum ersten Mal aufgeschlagen hatte, hatte er zwischen den Seiten vierundneunzig und fünfundneunzig ein unbeschriebenes Blatt Papier gefunden. Er hatte es seit- dem an dieser Stelle liegen lassen. Abgegriffen und mehrfach eingerissen, markierte es die beiden Seiten des Gedichtbandes. Traurige, schwermütige Poesie, die sich in Kopf und Gemüt eingebrannt hatte und die ihn an seine Mutter denken ließ, die er gar nicht kannte. Sie war einfach zu früh gestorben, als dass er noch irgendeine Erinnerung an sie haben konnte.
Gut sechzig Jahre alt wäre sie mittlerweile gewesen. Sie musste die Gedichte von Trakl geliebt haben, sonst hätte sie ihm das Buch nicht vermacht. Sie lebte für ihn und mit ihm noch zwischen diesen Gedichten.
Der Wunsch, mehr über sie zu erfahren, war immer mehr zum Bedürfnis und in letzter Zeit beinahe zur Obsession geworden. Damit ging er abends schlafen und damit wachte er am Morgen auf. Seine Tante und Pflegemutter konnte er nicht mehr fragen, sie war schon lange gestorben.
Er hatte kein Bild von seiner leiblichen Mutter, nichts, nur diesen Gedichtband. Darin zu blättern, bereitete ihm zunehmend Unbehagen. Die Gedichte hatten Besitz von ihm ergriffen. Er suchte in ihnen seine Mutter, fand darin aber nur Schwermut, Dunkelheit und Tod. Dennoch kam er nicht los davon.
Behutsam strich er mit der linken Hand über den Buch- rücken. Am Rückenfalz hatte der Einband schon seit geraumer Zeit einen langen Riss, den er endlich reparieren sollte. Den Umschlag einfach wegzureißen oder zu erneuern, wäre nie in Frage gekommen.
Er hob ihn etwas an, um zu prüfen, ob sich die gerissenen Stellen nahtlos aneinanderfügen ließen. Da entdeckte er ein kleines Eckchen Papier. Vorsichtig bekam er es mit Daumen und Zeigefinger zu fassen und zog es hervor.
Ebenso wie das Blatt im Buch war es einmal gefaltet und kariert, vermutlich aus einem Schulrechenheft herausgetrennt.
Es war beidseitig mit geradliniger, eleganter Schreibschrift beschrieben.
Das Schreiben musste schon seit fast vierzig Jahren zwischen Einband und Buchrückseite gelegen haben. Die Schriftfarbe und das Blatt selbst zeigten außer dem scharfen Falz kaum Alterungsspuren.
23. April 1983
Mein lieber kleiner Sohn,
ich weiß nicht, ob du diesen Brief jemals finden wirst. Ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt will, dass du ihn findest. Sollte es doch so kommen, dann bist du schon erwachsen. Ich werde Isi und Max bitten, dich zu sich zu nehmen. Dann kannst du in einer richtigen Familie aufwachsen, du wirst sogar eine ältere Schwester haben. Ich werde hinterlassen, dass du dieses Buch an deinem achtzehnten Geburtstag bekommen sollst, das ist mir wichtig. Du bist noch so klein. Ich wünsche mir für dich, dass du so leben kannst, als hätte es mich nicht gegeben. Ich hätte dir nie ein schönes Familienleben bieten können. Ich hoffe auch, du wirst vergessen, wie oft ich dich allein bei Isi und Max lassen musste, wenn ich wegmusste. Ich werde nicht erfahren, ob du jemals danach fragen wirst, wer deine wirklichen Eltern waren. Ich habe unsägliche Angst davor, dass du mich eines Tages fragen wirst, warum du keinen Papa hast. Ich würde es dir auch nicht sagen können, weil ich es nicht weiß! Ich würde dich nie belügen können, und ich würde es aber auch nicht ertragen, dir die Umstände erzählen zu müssen, warum es dich gibt. Ich kann es dir nicht einmal schreiben. Ich habe geschwiegen, geschwiegen, ich bin schuld daran, weil ich nicht darüber reden kann, jetzt nicht und in Zukunft nicht. Ich habe die Erinnerung verloren. Ich habe ihre Gesichter verbrannt, zerschlagen, gelöscht, vergessen. Mit meiner kranken Seele und meinem kranken Körper würde ich nie eine Mutter sein können, die dich unbeschwert und lebenstüchtig macht. Du wirst es bei Isi, Max und Sibylle gut haben.
Die letzten Sätze brannten sich augenblicklich in sein Gedächtnis ein. Er hatte es geahnt, nein, er hatte es immer gewusst: Mit seiner Mutter hatte etwas nicht gestimmt. Kein junger, lebens- froher Mensch konnte Gefallen an den Werken eines schwermütigen Dichters finden, der an Drogen oder möglicherweise sogar durch Selbstmord gestorben war. Alle hatten ihm die Wahrheit vorenthalten, seine Tante, der Onkel und die Cousine. Sie hatten ihn in dem Glauben gelassen, seine Mutter sei früh an einer schweren Krankheit gestorben. Das war sie nicht, es musste etwas Schlimmes mit ihr passiert sein.
Waren sie sogar darin verwickelt? Er würde es herausfinden. Er faltete das Blatt zusammen, schob es vorsichtig zurück an seinen Platz zwischen Buchdeckel und Einband und reparierte die gerissene Stelle mit einem Stück Klebefilm.
1
Otto Forselius krümmte sich im Polstersessel. Die Schlinge aus Kabelbindern um seinen Hals ließ ihm nur so viel Luft, dass er gerade noch leise röchelnd atmen konnte. Jeder Ansatz eines Hilfeschreis erstarb in endlosem Würgen.
In seinem Hals hämmerte der Puls, und das Blut in seinem Kopf schien zu kochen, wie kurz vor dem Siedepunkt. Es fühlte sich an, als würde jede weitere Bewegung seinen Kopf in Stücke reißen.
Er spürte eine Bewegung auf der anderen Seite des Tisches. Unter äußerster Anstrengung hob er seine geschwollenen Augenlider so weit, wie er konnte.
Sein Gegenüber hatte sich aus dem Sofa erhoben und lief eine gefühlte Ewigkeit im Zimmer auf und ab, dabei vernahm Forselius ein permanentes, leises Murmeln. Er zählte seine Schritte. Jeder Schritt eine Zahl, exakt wie ein Sekundenzeiger. Was hatte der Mann vor mit ihm? Er hätte ihn schon längst töten können, für Forselius wäre es eine Erlösung gewesen. Warum ließ er ihn so erbärmlich leiden?
Die Todesangst fraß sich durch den geschundenen Körper. Dann verschwand er aus seinem Blickfeld, die Schritte und das Murmeln hörten plötzlich auf und Forselius spürte einen leichten Luftzug. War er auf die Toilette oder in die Küche gegangen? Oder wollte er sich auf der Veranda die Füße vertreten?
Zwischen der unsäglichen Angst und den unerträglichen Schmerzen machte sich in Otto Forselius urplötzlich ein letzter Rest von Lebenswillen bemerkbar. Er reagierte wie ferngesteuert, er hatte nichts mehr zu verlieren – zu gewinnen sowieso nichts mehr.
Der Mann, von dem er bisher nur die Augen hinter der zugezogenen Kapuze gesehen und die Stimme gehört hatte, hatte ihm irgendwann die Fesseln an den Handgelenken gelöst, die Schlinge um den Hals aber nicht. Forselius rutschte vom Sessel auf die Knie und hangelte sich mit seinen von den Fesseln geschundenen Händen an der Sofatischkante entlang zu seinem Notebook, an dem der andere gerade noch gesessen hatte. Er konnte seine Augen nicht mehr richtig öffnen, um auf den Bildschirm zu sehen, und musste seinen Kopf deshalb in den Nacken beugen, was ihm beinahe völlig die Luft raubte und einen weiteren Würgeanfall auslöste.
Schemenhaft erkannte er, dass sein Mailprogramm geöffnet war. Er ertastete die Maus rechts vom Notebook – und plötzlich war er klar wie seit Stunden nicht mehr. »geho@horger-holzbau. com« stand in der Adresszeile, das Textfeld war noch leer.
Sofort wurde Forselius bewusst, dass der andere beabsichtigte, eine Nachricht an die Adresse zu senden, die er förmlich aus ihm herausgeprügelt hatte. Mit zitternden Fingern schaffte er es gerade noch, die Mailadresse seines Bruders in die zweite Empfängerzeile zu setzen, da vernahm er Schritte. Er klickte auf »Senden«.
Otto Forselius konnte aus seiner Studienzeit noch leidlich gut Deutsch. Der Tod sprach, nein, er schrie auf Deutsch:
»Scheiße, was hast du da gemacht? Scheiße! Scheiße!«
Der andere packte Forselius mit der linken Hand am Hemd- kragen und zog mit der rechten so lange am Kabelbinder an seinem Hals, bis er nach einigen spastischen Zuckungen leblos auf den Holzboden sank. Er holte aus der Küche ein Papiertuch und wischte die Spucke ab, die Forselius im Todeskampf auf der Notebooktastatur und auf dem Tisch hinterlassen hatte. Er konnte sich keinen ungezügelten Zorn leisten, ein klarer Kopf war gefragt.
Forselius Tod war geplant gewesen, aber über die Konsequenzen der fehlgeleiteten Mail musste er sich auf der Rückreise Gedanken machen. Ein weiterer Fehler durfte ihm nicht noch einmal unterlaufen.
Die Liste war abgearbeitet: Autoschlüssel, Kreditkarten, Bankkarten, Reisepass, Handy, Ladegerät, Notebook mit Lade- gerät, sämtliche PINs, Passwörter und Zugangsdaten für Bankkonto, Handy, Notebook, E-Mail- und Facebook-Account.
Er faltete das Blatt mit den notierten PINs und Passwörtern und schob es zusammen mit den Bankkarten in einen wiederverschließbaren Plastikbeutel. Dann öffnete er den Reißverschluss seines weißen Einwegoveralls, steckte den Beutel in die Brusttasche seiner Fleecejacke, die er darunter trug, vergewisserte sich, dass das Notebook ausgeschaltet war, und packte es in seinen kleinen Rucksack. Danach ging er in die Schlafstube und blickte sich um.
Das massive Bett aus Kiefernholz war ungemacht. Er schüttelte Decke und Kopfkissen, strich beides glatt und warf die Tagesdecke darüber, die auf der anderen Hälfte lag. Das Wasserglas auf dem Nachtkästchen ließ er stehen.
Im Zimmer gab es keinen Kleiderschrank, aber eine Schiebetür, die den Zugang zu einer kleinen, begehbaren Ankleide bot. Er knipste den Lichtschalter an, die auf dem Boden liegende Schmutzwäsche ignorierte er.
In einem Regalfach neben der Kleiderstange fand er einen kleinen, schwarzen Hartschalenkoffer, den nahm er mit. Den Rucksack mit dem Notebook hatte er schon geschultert.
Zur Sicherheit schritt er noch einmal die Wohnstube ab und überprüfte, ob es genau so aussah wie vor knapp zwei Stunden, als er das Blockhaus am Päjännesee im Südwesten Finnlands betreten hatte, um das zu tun, was er lange vorbereitet hatte. Dann öffnete er die Tür nach draußen.
Alles war ruhig, der See schimmerte spiegelglatt durch die hoch gewachsenen Kiefern und Birken, deren Blätter ein leiser Windhauch sanft bewegte. Er blockierte die Tür mit dem Ruck- sack, um sie am Zufallen zu hindern, und zog den Toten nach draußen.
Anschließend rückte er Tisch, Sessel und Teppich wieder zurecht, und trat mit dem kleinen Koffer in der Hand auf die Veranda hinaus. Nach einem letzten Kontrollblick zurück in die Wohnstube ließ er die Tür hinter sich ins Schloss fallen, sperrte ab und legte den Zweitschlüssel in eine Balkenritze unter der Veranda. Dort, wo Forselius ihn immer deponierte, das wusste er nun auch. Koffer und Rucksack ließ er auf der Veranda stehen.
Der Zeitpunkt schien günstig zu sein. Für den bald anbrechenden neuen Tag war Regen angekündigt. Wenn er Glück hatte, würde sich die dunkle Wolkenwand, die bereits im Westen erkennbar war, über den Horizont schieben und der skandinavischen Frühsommernacht ihre Helligkeit nehmen.
Schon vor Tagen hatte er das Gelände, das Blockhaus und das Nebengebäude sondiert. Er ging den schmalen Pfad zwischen fast kniehohen Blaubeersträuchern zum Holz- und Geräteschuppen, der zwischen zwei hohen Kiefern stand, holte die Schubkarre heraus und schob sie zum Haus. Die Radnabe quietschte hörbar, aber nicht laut genug, als dass er sich Ge- danken darüber hätte machen müssen.
Um zu den nächstgelegenen beiden Sommerhäusern in der Nachbarbucht zu kommen, musste man eine andere Zufahrt vom Hauptweg durch den Wald benutzen oder mit dem Boot um die mit Kiefern und Birken bewachsene Landzunge herum- rudern. Von dort war er gekommen.
Es gab keinen Sichtkontakt. Es war Anfang der Woche und die Häuser waren vor den Sommerferien, die in Finnland erst an Mittsommer begannen, nur an den Wochenenden bewohnt. Auch das hatte er überprüft, bevor er das Boot vom Steg eines der Häuser entwendet hatte, weil Forselius sein Boot nicht am Steg gehabt hatte – was ihn überrascht hatte, das war nicht geplant gewesen.
Vor der Holztreppe zur Veranda stellte er die Karre ab. Er ging in die Hocke, fasste den toten, strangulierten Körper unter den Oberarmen und in den Kniekehlen und hievte ihn in die Schubkarre, sodass er in der Wanne lag, Kopf und Unterschenkel aber nach außen hingen. Mehr Platz gab es nicht.
Er rollte die Karre den von Wurzelwerk und Granitfelsen gesäumten Pfad zum Bootssteg hinunter. Bevor er den Körper auf den Steg kippte, vergewisserte er sich im Schutz des Ufergebüsches noch einmal, ob auch wirklich niemand auf dem See unterwegs war. Aber das hätte er gehört, alle Anwohner fuhren ihre Boote mit Außenborder. Geräusche wären weit über den See zu hören gewesen, wie das Gezeter einer Möwenkolonie draußen auf einer kleinen Felseninsel zeigte.
Er stieg in das dicht am Steg festgemachte Boot und zog den toten Körper langsam hinein. Dann kletterte er auf den Steg, schob die Karre nach oben und stellte sie in den Schuppen zurück. Von der Veranda aus ließ er seinen Blick ein letztes Mal über den See schweifen. Es war kurz nach Mitternacht, alles war still, die Möwen waren nicht mehr zu hören. Die Natur hatte ihre biologische Uhr auf Nachtruhe gestellt, auch wenn es um diese Jahreszeit bereits kaum dunkel wurde. Die Wolkenwand war nicht vorangekommen.
Dann schnappte er sich den kleinen Koffer und den Rucksack und ging hinunter zum See. Am Steg angekommen, ließ er sich ins Boot gleiten und legte Rucksack und Koffer ab. Aus einer schwarzen Sporttasche, die er im Boot gelassen hatte, holte er eine Bleiweste hervor. Er war gut vorbereitet. Nachdem er die Gummihandschuhe, die Einwegfüßlinge und den Overall ausgezogen hatte, stopfte er alles zusammen mit dem kleinen Rucksack in die Tasche und zog den Reißverschluss zu. Anschließend legte er dem Toten die Bleiweste um und löste die Kette vom Steg.
Mit der rechten Hand stieß er das Boot ab und setzte sich in die Mitte, den gekrümmten Körper des Toten zwischen den Beinen. Langsam, Meter für Meter, glitt es vom Ufer weg. Nun ergriff er die Ruder, steckte sie in die Beschläge und ruderte mit langsamen, lautlosen Schlägen in Richtung Südwesten zur nächsten Bucht, in der es keine Sommerhäuser mehr gab.
Als das Blockhaus allmählich aus seinem Blickfeld ver-schwunden war, holte er die Ruder ein, griff hinter sich nach der Sporttasche und holte daraus ein kurzes Metallrohr hervor. Daran befestigte er eine Schnur, beides hatte er auf der Fahrt hierher in einem Baumarkt gekauft.
Langsam kam das Boot zum Stillstand. Er ließ das Rohr ins Wasser gleiten und lotete die Tiefe aus. Sobald die Schnur die Spannung verloren hatte und das Rohr demnach auf dem Grund lag, knüpfte er einen Markierungsknoten und holte es ein. Vom Knoten weg zog er die Schnur Meter für Meter durch beide Hände. Er schätzte die Tiefe auf gut fünfzehn Meter – das musste reichen.
Forselius hatte in den vergangenen Stunden geleugnet, geschrien, gefleht, gewinselt. Er hatte es ignoriert und ihn keines Blickes gewürdigt, ihm nicht in die Augen geschaut, er war es nicht wert gewesen. Nur über ihn hinweg, an ihm vorbei oder durch ihn hindurch hatte er gesehen. Mit der Fußspitze stieß er gegen den Kopf, der langsam zur Seite kippte. Nun sah er ihm zum ersten Mal direkt in die Augen. Er blickte in erstarrtes Weiß, die Pupillen waren fast gänzlich hinter den Lidern verschwunden. Konnte es sein, dass Forselius grinste und ihn noch im Tod verhöhnte? Oder fletschte er einfach nur die Zähne? Es waren Verachtung und Selbstgefälligkeit, die er zu sehen glaubte. Noch im Tod zeigte ihm dieser Mann sein wahres Gesicht.
Er griff dem Toten unter die Achseln, zog ihn langsam und vorsichtig auf die Bootskante, darauf bedacht, dass das Boot nicht krängte und voll Wasser lief. Stück für Stück schob er so den Körper über Bord und ließ ihn ins Wasser gleiten, spurlos verschwinden, für immer. Das Metallrohr mit der Schnur versenkte er ebenso.
Danach wusch er seine Hände im See, als wolle er sich von der Berührung mit dem Toten reinwaschen. An seiner Jacke rieb er sie anschließend trocken, nahm die Ruder auf und steuerte auf das dicht bewaldete, unbewohnte Ufer zu, wo Weidengestrüpp zwischen zwei Schilfgürteln bis ins Wasser wucherte. An einem großen, flachen Felsen legte er an, schulterte den Rucksack, warf die Reisetasche ans Ufer und klemmte sich den Koffer unter den rechten Arm. Während er sich schließlich mit der linken Hand an einem Busch festhielt, stieg er vorsichtig aus dem Boot und gab ihm mit dem Fuß einen Stoß. Ohne sich noch einmal umzudrehen, verschwand er zwischen dem Weidengestrüpp im Wald.
Eine leichte, ablandige Brise war aufgekommen. Das Boot, das vorn an beiden Seitenplanken den Namen »Kissa« trug, schaukelte sanft im Rhythmus der Wellen und trieb langsam auf den See hinaus. Die Ruder hingen über Bord und klopften mit leisen, dumpfen Schlägen an den Rumpf.
Auf der anderen Seite des Sees legte sich ein orangeroter Streifen hinter die Wipfel der hochgewachsenen Kiefern und Fichten. Es war nicht mehr lange bis Mittsommer am Päjännesee in Mittelfinnland. Der Tag wollte nicht gehen und die Nacht nicht kommen.
2
Jorma Peltonen, Mathematiklehrer aus Jyväskylä, stand auf dem Steg vor seinem Sommerhaus und ließ den Blick über die Bucht schweifen. Er war mit seiner Familie aus der nahen Stadt gekommen, um das Wochenende im Blockhaus am Päjännesee zu verbringen. Er war in diesem Jahr erst einmal da gewesen, das war Ende April, um nach dem Rechten zu sehen und das Boot auszuwintern. Mittlerweile war es Ende Mai, in gut drei Wochen würde das Mittsommernachtsfest stattfinden. Wie jedes Jahr hatten sie Freunde zur Feier eingeladen, da gab es im und um das Haus herum noch einiges zu tun.
Es war eine Stunde vor Mitternacht, die Kinder lagen bereits in ihrer Kammer in den Stockbetten, und Liisa, seine Frau, bereitete ein kleines Nachtmahl für sie beide vor.
Obwohl er große Lust dazu verspürte, war keine Zeit für einen Saunagang. Er genoss nur noch kurz die schönsten Augenblicke, die der See an einem späten Frühsommerabend reichlich bot. Die Schnaken waren glücklicherweise noch nicht aktiv, der Winter war lang und kalt gewesen und das Frühjahr trocken. Der See hatte einen niedrigeren Wasserstand als in den Jahren davor.
Die vergangenen zwei Tage hatte es geregnet, nun war über Mittsommer hinaus schönes Wetter angekündigt worden. Im Nordwesten hatte sich die Sonne am Horizont auf ihre kurze Nachtruhe eingerichtet. Sie schickte ihre letzten Strahlen in die Bucht und färbte den Wald rotgolden, darin leuchteten die Birken wie Säulen aus weißem Marmor.
Das Wasser war ruhig, spiegelglatt und dunkel. Man konnte am Ende des Steges nicht mehr auf den Grund sehen. Ein paar Seerosen wuchsen vor der Badeleiter der Wasseroberfläche entgegen. Er würde sie entfernen müssen, sie würden beim Schwimmen stören.
Hier und da raschelte und platschte es im Schilf, ein Hecht war auf spätem Raubzug. Weit draußen auf einer kleinen Felseninsel mitten im See stritt eine Möwenkolonie um die besten Brutplätze. Ihr zänkisches Geschrei hallte über den See.
Es war kühler, als er dachte, und es war Zeit zum Essen. Das große Fenster in der Wohnstube bot einen ebenso schönen Blick auf den See.
Schnell wollte er noch am Wasserthermometer, das an einem Pfahl befestigt war, die Temperatur kontrollieren. Da bemerkte er es: Das Boot war weg.
***
Jorma Peltonen hatte sich das Wochenende anders vorgestellt. Er war nach dem Frühstück nach Jyväskylä zurückgefahren und saß nun im Polizeirevier in der Urhonkatu. Kommissar Koivuranta hatte protokolliert, dass Peltonens Boot vom Steg des Sommerhauses in der Ristinselkäbucht am Päjännesee abhandengekommen war. Ebenso stand im Protokoll, dass Jorma Peltonen glaubhaft versicherte, das Boot nach seinem letzten Besuch im Sommerhaus am siebzehnten April, als er den Außenborder nach einem langen Winter startklar gemacht und eine kleine Runde auf dem See gedreht hatte, an Land gezogen und mit einer Kette und einem Vorhängeschloss am Aufgang zum Steg angekettet zu haben. Nicht ohne danach den teuren Außenbordmotor abzumontieren und mit nach Hause zu nehmen. Das machte er schon seit Jahren so, wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht ins Sommerhaus kamen.
Einbrüche in Sommerhäuser und gestohlene Bootsmotoren gehörten zur Routine finnischer Polizeiwachen von Helsinki bis Lappland. Beide, Kommissar Koivuranta und Jorma Peltonen, fanden es allerdings ungewöhnlich, dass ein Boot ohne Motor abhandengekommen war. So, wie es offensichtlich gesichert gewesen war, konnte es sich nicht selbst losgerissen haben und aus der Bucht auf den offenen See abgetrieben worden sein. Die Kette musste folglich mit einem Bolzenschneider geknackt und das Boot mit einem Trailer abtransportiert worden sein.
Ein ungewöhnlicher Aufwand für ein Boot, von dessen Sorte es auf den finnischen Seen Tausende gab, und davon mit Sicherheit viele, die mit geringerem Aufwand zu stehlen gewesen waren als Peltonens Boot weit ab von der Landstraße in der Ristinselkäbucht. Zumal er an beiden Seiten am Kiel auch noch den Kosenamen seiner kleinen Tochter aufgemalt hatte.
Da Jorma Peltonen in den Augen des Kommissars eine absolut integre Person war, wollte er an einen Versicherungsbetrug gar nicht denken.
Koivuranta empfahl Jorma Peltonen, in den größeren Ort- schaften rund um den Ristinselkä, in Muurame und Säynytsalo sowie in den Dorfkaufläden der kleinen Kirchdörfer, wo viele Seeanwohner einkaufen gingen, eine Verlustanzeige aufzuhängen. Vielleicht war das Boot doch irgendwo angetrieben oder aufgefunden worden.
3
Die Promenadencafés waren an diesem späten Junivormittag schon gut besucht. Es kündigte sich ein traumhaft sonniges Wochenende an, das Lust auf einen langen und schönen Sommer machte.
Genau von diesem Gefühl ließ sich Carl Sopran treiben, als er die Uferpromenade in Friedrichshafen am Bodensee entlangschlenderte. Vorbei an einem griechischen Restaurant, wo in der Küche vermutlich bereits die ersten Souvlaki-Spieße und Lammkoteletts auf dem Grill lagen. Es duftete verlockend bis nach draußen.
Sopran steuerte auf einen leeren Tisch in einem Eiscafé zu, rückte sich einen der drei Korbstühle so zurecht, dass er freien Blick auf den See hatte, aber auch das Publikum auf der Promenade beobachten konnte. Dann holte er sein Handy aus seinem Leinensakko, legte es auf den Tisch, hängte das Sakko über die Stuhllehne und setzte sich.
Kaum hatte er sich niedergelassen, die Beine ausgestreckt und seine Sinne auf Entspannung programmiert, trafen ihn die ersten Akkorde einer Polka wie ein Keulenschlag. Den Akkordeonspieler, der sich ein paar Meter weiter auf der Promenadenmauer niedergelassen hatte, hatte er nicht bemerkt. Das war das Letzte, was er ertragen konnte. Also, was tun? Aufstehen und ein neues Café suchen?
Der Straßenmusikant drückte und zerrte an seinem Instrument und blickte erwartungsvoll in die Runde. Es war ein- getreten, was Sopran befürchtet hatte: Links und rechts sah er wippende Füße und im Takt nickende Köpfe.
Er spürte es förmlich körperlich, wie seine Stimmungslage von Entspannung auf Aggression umschwenkte.
Er war sich sicher, auch wenn er ein paar Häuser weiterzog, den Kerl würde er nicht los, die Seepromenade war heute seine Bühne und der Hut am Vormittag vermutlich noch leer.
Nachdem er sich bei der Polka so heftig ins Zeug gelegt hatte, ließ der Musikant es bei einem elegischen Stück, das sich irgendwie russisch anhörte, ruhiger angehen.
Sopran wechselte einen Blick mit einem jungen Mann, der drei Tische weiter vor seinem Laptop saß und auch reichlich genervt wirkte. Da schoss Sopran ein Gedanke durch den Kopf – er würde sie beide erlösen.
Er wartete, bis der Musikant das Stück beendet hatte, stand auf und trat auf ihn zu.
Er könnte aus Rumänien kommen, dachte er, als er sich ihm genähert hatte. Alter nicht bestimmbar, irgendwo zwischen fünfzig und siebzig, Stoppelbart, Basketballmütze mit adidas-Logo, schwarzes T-Shirt, Baumwoll-Trainingshose und die Füße in Sandalen ohne Socken, aber nicht ungepflegt.
Es tut mir ja leid, aber ich halte das einfach nicht aus, rechtfertigte sich Sopran vor sich selbst. Er konnte es nicht ertragen, wenn er mit Musik terrorisiert wurde, die er nicht hören wollte.
In der Brusttasche seines Hemdes hatte er einen Zehn-Euro-Schein stecken, den hielt er dem Musikanten hin. »Den bekommen Sie, wenn Sie ein paar hundert Meter weitergehen.«
Der Musikant fixierte ihn, nicht erstaunt, nicht gekränkt, eher gleichgültig. Er nahm den Schein, steckte ihn in seine Hosentasche, packte seine Harmonika in den Koffer, hievte den Koffer auf den Gepäckträger eines alten, klapprigen Fahrrades, befestigte ihn mit einem Spanngurt und schob sein Rad die Promenade entlang, bis er sich zwischen den Spaziergängern verlor.
Sopran ging an seinen Tisch zurück und setzte sich mit Blick auf den See. Er nahm das Handy, das noch dort lag, schaltete es aus und ließ es in die rechte Sakkotasche gleiten. Er war hierhergekommen, um seine Ruhe zu haben, zu entspannen und dennoch unter Leuten zu sein. Das war aber nun vorbei, er war aufgewühlt und seine Gedanken fuhren Geisterbahn.
Sopran sah sich auf dem Boden liegen. Der Vermummte hatte ihm die Handschellen von den am Rücken gefesselten Händen genommen, die Kopfhörer abgesetzt, den MP3-Player abgenommen und eine Plastikflasche vor ihm abgestellt. »Sparkling Water« konnte er mit Mühe auf dem Etikett entziffern, nur ein schmaler Lichtstrahl durchschnitt den Verschlag wie ein Laser. Er kam durch einen kleinen Spalt zwischen den Brettern, mit denen das Fenster ohne Glas von außen vernagelt sein musste. Sein steifer Rücken schmerzte vom stundenlangen Liegen auf einer dünnen Matratze, wo er mit jeder Körperbewegung den harten Boden spürte. Er richtete sich auf, tastete im Knien nach der Flasche. Der Lichtstrahl zielte auf seine Hände, die so sehr zitterten, dass er die Flasche kaum öffnen konnte. Der Verschluss fiel ihm aus der linken Hand, er hörte ihn auf den Boden fallen und davonrollen.
Mit beiden Händen versuchte er, die Flasche zur Nase zu führen, um zu riechen, was sie ihm zum Trinken vorgesetzt hatten. Es war Wasser, aber es roch fahl und abgestanden.
»Hallo … möchten Sie etwas bestellen?«
Sopran zuckte zusammen, hob ruckartig den Kopf und blickte einer jungen Frau direkt in ihre blauen Augen, die sich nicht mit den dunklen Lidschatten, dem exakt aufgetragenen, schwarzen Lippenstift und den tiefschwarz gefärbten Haaren, die streng zu einem Knoten mit schwarzem Band nach hinten gekämmt waren, vertrugen.
Sopran nahm seine Sonnenbrille ab, rieb sich die Augen, massierte sich den Nacken und setzte sie wieder auf. Die junge Frau warf ihm einen ratlosen oder auch abfälligen Blick zu, ging zum Nebentisch, räumte zwei Kaffeetassen ab und verschwand damit im Café.
Die Sonne schien ihm seitlich ins Gesicht, er wechselte auf den anderen Stuhl, der ihm Schatten unter dem Sonnenschirm bot. Er verspürte Durst und griff zur Getränkekarte, die auf dem Tisch lag, die junge Schwarzhaarige musste sie ihm hingelegt haben.
Obwohl er wusste, was er wollte, blätterte er in der Karte vor und zurück, um sich abzulenken. Nach und nach bekam er Ordnung in das Chaos, das sich in seinem Kopf breitgemacht hatte. Er war hier, hier war er zu Hause. Hier versuchte er, sesshaft zu werden, und es war nicht der schlechteste Platz auf dieser Welt.
Da war sie wieder. Er sah auf einen wippenden rechten Fuß in schwarzen Strümpfen und halbhohen schwarzen Stiefeletten. Er blickte nach oben, ihre Blicke trafen sich, sie sah ihn fragend an.
»Ein Mineralwasser mit Zitrone, aber die Zitrone auf den Rand gesteckt, bitte.«
Vermutlich dachte die Bedienung »Sonst noch was?«. Zumindest ließ ihr Gesichtsausdruck darauf schließen. Sie wandte sich ab und nahm am Nebentisch eine weitere Bestellung auf. Er sah auf den See hinaus. Eine stattliche Yacht hatte gerade den Hafen des Württembergischen Yachtclubs verlassen und tuckerte an der Promenade vorbei. Die Crew machte keine Anstalten, die Segel zu setzen, es war auch sinnlos, es war Flaute, das wusste er auch als Nichtsegler. Es war frühsommerliches Badewetter, kein Segelwetter.
Von Süden, aus dem Schweizer Romanshorn kommend, näherte sich die Autofähre dem Stadthafen. Die andere Seite des Sees kannte er noch gar nicht. Aber auch sonst hatte er noch nicht viel vom Bodensee gesehen, seit er vor zwei Jahren mit Marietta aus München in die Gemeinde bei Ravensburg gezogen war. Es kam ihm wie eine Episode vor, die ein Ende sucht, es aber nicht findet.
Marietta hatte sich auf ihn eingelassen, obwohl ihr klar gewesen sein musste, dass es eine schwierige Beziehung werden würde. Schließlich hatte ihre befreundete Kollegin ihn fast ein halbes Jahr therapiert, als sie ihn im Dezember 2014 aus Afghanistan zurück nach München geflogen und zuerst in die Innere Abteilung des Krankenhauses gebracht hatten, in dem Marietta arbeitete. Dort wurde seine Nierenquetschung behandelt, die sie ihm während seiner zweiwöchigen Gefangenschaft zugefügt hatten.
Dort hatte er auch Dr. Marietta Grünbaum kennengelernt. Danach war er in eine psychiatrische Klinik gekommen, zur Beobachtung, wie es zuerst geheißen hatte. Es wurden vier Wochen. Man diagnostizierte eine posttraumatische Belastungsstörung. Anschließend konsultierte er auf Anraten von Marietta noch bis Mai 2015 einmal wöchentlich ambulant die befreundete Psychotherapeutin. Mit deren Hilfe hatte er gelernt, das Ganze wie die Folgen eines Berufsunfalls zu sehen. Wie ein Zimmermann, der vom Dach gefallen war, sich die Knochen gebrochen hatte und lernen musste zu akzeptieren, dass er seinen Beruf nicht mehr ausüben konnte und umschulen musste.
Bereits ein Jahr später war Marietta eine lukrative Stelle an der Oberschwabenklinik in Ravensburg mit einem Lehrauftrag an der Universität Ulm angeboten worden. Sopran ging mit, er hätte nicht gewusst, wo er sonst hinsollte.
Nun wohnten und lebten sie hier. Vielleicht musste es so kommen, damit er zum ersten Mal seit fünfzehn Jahren für einen längeren Zeitraum sesshaft wurde.
Carl Sopran war ein guter investigativer Journalist gewesen, ein verdammt guter sogar, aber ein Einzelgänger mit exzellenten Kontakten weltweit, ein Spürhund mit Stift, Kamera und Notebook. Seine Kontakte und Quellen waren legendär, je nach Bedarf offiziell, inoffiziell oder auch konspirativ, wie es die jeweilige Recherche erforderte.
Er hatte sich seit mehr als zehn Jahren an keine Redaktion mehr gebunden. Seine Recherchen und Reportagen waren begehrt. Er konnte sich aussuchen, für wen er im Auftrag recherchierte oder wen er mit eigenen Reportagen belieferte: die großen Magazine, die überregionale deutsche und auch internationale Tagespresse. Bei allen stand er immer ganz oben auf der Liste, wenn es galt, für heikle Recherchen und Reportagen nicht auf eigenes Personal zurückgreifen zu müssen.
Er hätte auch einen passablen Geheimdienstagenten abgegeben. Und tatsächlich hatten diverse Geheimdienste nicht nur einmal versucht, ihn anzuwerben oder Informationen abzuschöpfen. Er hatte immer widerstanden. Dieses eine Mal hätte ihn seine Konsequenz beinahe Kopf und Kragen gekostet.
Das Mineralwasser stand auf dem Tisch, natürlich schwamm die Zitronenscheibe oben auf. Er fingerte sie aus dem Glas, nahm sie in den Mund, sog sie aus und ließ sie in den Aschenbecher fallen. Anschließend nahm er das Glas, trank es mit großen Schlucken halb leer und stellte es ab.
Bei einem kurzen Blick auf seine Armbanduhr stellte er fest, dass er erst seit knapp zehn Minuten hier saß. Es kam ihm länger vor, und er hatte auch plötzlich keine Lust mehr, er hatte ihn sich anders vorgestellt, seinen vormittäglichen Ausflug an den See. Wie, wusste er auch nicht so recht, so aber auf keinen Fall. Er trank das Glas leer, grub drei Euro zwischen einem Papiertaschentuch und der Parkkarte aus seiner Hosentasche, legte die Münzen auf den Tisch. Mit dem Sakko über der Schulter verließ er das Café Richtung Parkgarage.
Wenige Minuten später steuerte er Mariettas schwarzes Golf-Cabrio aus dem untersten Parkdeck, stoppte nach der Schranke noch einmal, ließ das automatische Verdeck nach hinten klappen und reihte sich in den Verkehr stadtauswärts Richtung Norden ein.
Marietta musste schon in Frankfurt sein, sie hatte den ersten Flug ab Friedrichshafen mit Lufthansa genommen, am Vormittag ging ihr Flug nach Chicago, zu einem Ärztekongress. Er war mit der Bahn von Ravensburg zum Flughafen gefahren und hatte dort ihren Golf abgeholt, die Parkkarte für die Ausfahrt hatte sie wie abgesprochen am Ticketschalter hinterlegt. Auf Höhe des Bodensee Airports schwebte gerade eine Maschine zur Landung ein.
Wieder mal abheben wäre auch nicht schlecht, dachte Sopran. Zum Beispiel nach LA und den Highway 1 hoch bis San Francisco. Schon ewig hatte er auf keiner Harley mehr gesessen. Aber Marietta hatte für Motorräder nichts übrig und für die USA eigentlich auch nicht. Pikanterweise war sie gerade auf dem Weg dorthin.
Unterwegs hielt er noch kurz an einem Obststand an der Straße und holte sich eine kleine Schale Kirschen. Er stellte sie neben sich auf den Beifahrersitz und naschte während des Fahrens davon, die Kerne spuckte er gekonnt übers heruntergekurbelte Seitenfenster hinweg.
Als er wenige Minuten später den Blinker setzte, um die Schnellstraße an der Ausfahrt Ravensburg Nord zu verlassen, war die Schale beinahe leer gegessen.
Kurze Zeit später parkte er den Golf unter dem Carport der Doppelhaushälfte, die er mit Marietta zusammen gemietet hatte. Es gefiel ihm hier. Es war gar nicht so provinziell, wie er gedacht hatte. Die Stadt war nah und hatte Flair, viele nette Kneipen und Restaurants. Und der Sommer kam ja erst.
Er schloss die Haustür auf, holte die Post aus dem Brief-kasten und hing sein Sakko an die Garderobe. In der Küche öffnete er die Briefe. Der erste beinhaltete die Stromabrechnung, im zweiten wurde ihm vorgeschlagen, seine Krankenversicherung zu optimieren, und der dritte Brief kam endlich vom Verlag. Er hatte ein Buch, das zum Thema »Afghanistan und seine dauerhafte Befriedung« erscheinen sollte, lektoriert. Den Autor kannte er gut, er war als langjähriger Korrespondent der ARD in Asien und Nahost tätig.
Verlag und Autor seien mit seiner Arbeit sehr zufrieden, schrieb man. Sein Honorar würde ihm in Kürze überwiesen.
Er legte die Briefe auf den Küchentisch, auf dem noch das Frühstücksgeschirr stand, und ging hoch in den ersten Stock, um sein Notebook aus dem Arbeitszimmer zu holen. Wieder in der Küche angekommen, belegte er eine Scheibe Brot mit Käse und Salami, klemmte sich eine Flasche Mineralwasser aus dem Kühlschrank unter den Arm, griff sich das Notebook und setzte sich damit auf die Terrasse.
Es war früher Nachmittag und die Sonne stand hoch am Himmel, aber die ausgerollte Markise spendete Schatten. Er lehnte sich im Korbsessel zurück, legte die Füße auf den Tisch, eine Angewohnheit, die Marietta gar nicht mochte, und biss vom Brot ab. Das Mineralwasser trank er in langen Zügen aus der Flasche.
Einerseits genoss er dieses unaufgeregte Leben, andererseits war es Zeit, Fahrt aufzunehmen. In all den Jahren, in denen er weltweit für seine Recherchen und Reportagen unterwegs gewesen war, hatte er ordentlich verdient und einiges von diesem Geld auch sinnvoll angelegt. Er musste Marietta nicht auf der Tasche liegen, noch nicht. Aber seine Finanzressourcen waren auch nicht unerschöpflich, außerdem hatte er wieder Lust, »draußen« zu arbeiten. Ein Buch zu lektorieren oder hier und da einen Artikel für eine Tageszeitung zu schreiben, alles schön und gut, aber es wurde ihm allmählich doch langweilig. Mariettas Meinung dazu kannte er, sie hatte ihm noch ein Jahr Ruhe verordnet.
Er blickte auf das angebissene Brot in seiner Hand. Vielleicht sollte er für eine dieser Esszeitschriften schreiben, da kam man auch herum und hatte immer etwas Ordentliches auf dem Teller und im Glas sowieso.
Er nahm noch einen Schluck aus der Wasserflasche. Eine Woche durch das Piemont reisen – Marietta würde es gefallen, aber für ihn wäre es zu unspektakulär. Wenn, dann schon die harte Tour. Nach Schottland zum Beispiel. In den Destillen von Talisker, Lagavulin und Oban rauchige Single Malts verkosten und dann mal Haggis probieren. Charlie McLeod, ein Reporterraubein aus Glasgow, mit dem er Ende der Neunziger die Routen osteuropäischer Autoschieber quer durch Europa recherchiert hatte, hatte immer davon geschwärmt. Wenn er sich richtig erinnerte, war Haggis so etwas Ähnliches wie gefüllter Schafsmagen.
Er nahm die Füße vom Tisch, zog das Notebook heran, klappte es auf und setzte sich so zurecht, dass der Bildschirm nicht spiegelte. Während Windows langsam hochfuhr, aß er das restliche Brot, das ohne Teller auf dem Tisch lag, und trank die Wasserflasche leer.
Er öffnete die Mailbox und den Posteingangsordner. Acht neue Mails waren eingegangen. Zuerst löschte er drei, die als Spam gekennzeichnet waren, sowie eine weitere Werbemail. Die nächste war vom selben Verlag, von dem er den Brief bekommen hatte. Die Buchhaltung wollte die Honorarabrechnung fertigmachen und fragte, ob noch Spesen abzurechnen seien. Da gab es vermutlich interne Abstimmungsprobleme.
Dann fiel sein Blick auf eine Mail, deren Absender und Betreff ihn irritierten und neugierig machten: »asianajotoimisto-hk-oy«. In der Betreffzeile stand auf Deutsch: »Bitte Kontaktaufnahme«.
Den Absender konnte Sopran sprachlich nicht einordnen. Er ließ die Mail vorsichtshalber noch geschlossen, öffnete parallel den Internetbrowser und gab »asianajotoimisto-hk-oy« in die Suchzeile ein.
Mehrere Treffer wurden ihm angeboten, auch einer auf Englisch: Attorneys at Law Hellman & Koskinen Ltd, Aleksanterinkatu 62, Helsinki.
Er öffnete die Website. Eine Anwaltskanzlei aus Finnland.
Was wollten die von ihm?
Gespannt wagte er es, die Mail zu öffnen, die ebenfalls in deutscher Sprache verfasst war:
Sehr geehrter Herr Sopran,
wir schreiben Ihnen im Auftrag eines Mandanten, der uns gebeten hat, in einer privaten Angelegenheit mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Alles Weitere möchten wir gern persönlich mit Ihnen besprechen. Bitte schicken Sie uns eine kurze Antwortmail, unter welcher Telefonnummer wir Sie wann am besten erreichen können. Wir werden uns dann erlauben, Sie anzurufen.
Mit freundlichen Grüßen Christina Möller-Hellman Hellman & Koskinen Oy
Auf der Website der Kanzlei klickte er sich durch die Menüleiste. Die Inhalte präsentierten sich auf Finnisch, Englisch und Deutsch. Drei Anwälte stellten sich auf der Startseite vor, von allen dreien gab es Fotos.
Christina Möller-Hellman war offensichtlich Deutsche und Anwältin für internationales Familien- und Erbrecht. Gustav Hellman, vermutlich ihr Ehemann, wurde als Fachanwalt für Wirtschafts- und Handelsrecht und Teuvo Koskinen für Wettbewerbs- und Vertragsrecht vorgestellt.
Christina Möller-Hellman schätzte er auf Mitte vierzig. Sie hatte dunkle, nach hinten gesteckte Haare, eine modern geschwungene Designerbrille gab ihrem ovalen Gesicht Kontur. Sie hatte sich am Schreibtisch ablichten lassen.
Gustav Hellman stand vor einem Bücherregal und hatte ein aufgeschlagenes Buch, vermutlich einen Gesetzestext, in der Hand. Sein Körperbau war kompakt, aber er war nicht korpulent. Irgendwie wirkte Hellman gemütlich. Sein Alter war schwer zu schätzen, die wenigen Haare, die er vermutlich noch hatte, waren zu einem Kahlkopf geschoren. Er lächelte verschmitzt aus seinem runden Gesicht.
Von ihr würde ich mich vertreten lassen, und mit ihm würde ich lieber ein Bier trinken, dachte Sopran.
Der dritte im Bunde, Teuvo Koskinen, war der Typ Juniorpartner. Die blonden, halblangen Haare hatte er deutlich mit Gel nach hinten gekämmt, seinem schmallippigen, breiten Mund hatte er beim Fotografieren offensichtlich kein Lächeln abnötigen können.
Warum hatte eine Anwaltskanzlei in Finnland den Auftrag, mit ihm Kontakt aufzunehmen? Und wer steckte dahinter? Er hatte noch nie etwas mit Finnland zu tun gehabt, es war ihm völlig schleierhaft, was das zu bedeuten hatte.
Langsam, aber stetig beschlich ihn ein Gefühl, das er nur zu gut kannte. Sie hatte ihn wieder, diese Unruhe, die ihn immer in Beschlag nahm, wenn er vor einer neuen Recherche stand. Er spürte es körperlich, wie sie in ihm hochkroch, vom Magen bis in den Kopf, wo sie ein regelrechtes Gedankengewitter erzeugte.
Überraschende E-Mail. Rechtsanwaltskanzlei. Finnland.
Noch unbekannter Auftraggeber. Marietta ist nicht da.
Ich muss raus.
Ich bin noch nicht so weit. Herrgott, ich will aber.
Vielleicht ist es etwas ganz Banales, völlig harmlos.
Nein, da ist etwas, da kommt etwas, ich spüre es, ich rieche
es.
Was Sopran roch, war das Pils, das er unbewusst und automatisch aus dem Kühlschrank geholt und geöffnet hatte. Die Aufregung hatte ihn in die Küche getrieben.
Nach ein paar langen Zügen aus der Flasche ging mit ihr in der Hand zurück auf die Terrasse. Sein Blick schweifte über die Dächer der Hangsiedlung unter ihm. Hinter den Hügeln auf der anderen Talseite waren schemenhaft die Berge des Bregenzer Waldes und weiter im Osten die Allgäuer Alpen auszumachen. Aber dafür hatte er keinen Sinn mehr. Wie ein Blitz war die E-Mail in die Beschaulichkeit seiner Rekonvaleszenz gefahren.
Er trank den Rest der Flasche in einem Zug aus und setzte sich an den Terrassentisch, die Neugier trieb ihn zurück an sein Notebook. Der Bildschirm hatte in den Ruhemodus geschaltet, er berührte die Maus und die Webseite der Kanzlei erschien wieder. Er öffnete in einem weiteren Fenster noch einmal die Mail. Es hatte sich nichts geändert, er wurde nach wie vor gebeten, Kontakt mit Hellman & Koskinen in Helsinki aufzunehmen. Unentschlossen starrte er auf den Bildschirm. Was löste er aus, wenn er antwortete? Vorläufig noch gar nichts. Er konnte sich ja anhören, was die Herrschaften von ihm wollten.
Er tippte eine kurze Nachricht, dass er jederzeit erreichbar sei, hinterließ seine Telefonnummern vom Handy und Festnetz und schickte die Antwort ab. Es war Donnerstagnachmittag, mit einem Anruf aus Finnland war noch vor dem Wochenende zu rechnen, das ahnte er.
Der Kühlschrank hatte ihn schon vorhin, als er nach Hause gekommen war, mit relativer Leere begrüßt, und das Pils, das er getrunken hatte, war das letzte gewesen. Es war Zeit, zum Einkaufen zu fahren.
***
Sopran zog im Supermarkt gerade ein Sixpack Pils aus dem Regal, als sein Handy klingelte. Er stellte das Bier in den Einkaufswagen und holte das Telefon aus der Gesäßtasche. Das Display zeigte eine Nummer mit einer langen, unbekannten Vorwahl an. Das war der Anruf, es war Donnerstagnachmittag kurz vor fünf.
»Sopran«, meldete er sich.
»Guten Tag, Herr Sopran, Christina Hellman am Apparat, ich vermute, Sie haben meinen Anruf schon erwartet.« Sie sprach akzentfreies Hochdeutsch. Ihre Stimme war durchaus angenehm. »Ich hoffe, wir haben Sie mit unserer Mail nicht allzu sehr beunruhigt. Können wir in Ruhe telefonieren? Ich habe Sie unter der anderen Nummer zu Hause nicht erreicht.«
»Das ist gerade schlecht«, antwortete Sopran, »ich bin beim Einkaufen. Spätestens in einer Stunde bin ich aber zu Hause, dann geht es besser.«
Christina Hellman versprach, in einer Stunde wieder anzurufen, und verabschiedete sich mit einem fast erwartungsvoll klingenden »Also, bis dann!«. So, als würden sie sich schon lange kennen.
Als er das Handy gerade in die Tasche stecken wollte, bemerkte er, dass die Mailboxanzeige leuchtete. Das konnte nur ein Anruf von Marietta sein.
Und so war es. Er hörte ihre Nachricht kurz ab, ging online und tippte eine kurze WhatsApp-Antwort: »Hallo Schatz, habe deinen Anruf verpasst, melde dich, wenn du angekommen bist. Gruß und Kuss, Carl.«
Dann ergänzte er noch die Zeitanzeige auf seinem Handy mit der Ortszeit von Chicago, dort war es kurz nach zehn Uhr vormittags, sieben Stunden zurück. Wenn Marietta mittags landete, war es zu Hause ungefähr acht Uhr abends.
Er stand vor dem Regal mit den verschiedenen Spätzle-sorten. Da gab es normale Spätzle, Knöpfle, Schupfnudeln und eine enorme Auswahl von Maultaschen mit den verschiedensten Füllungen.
Willkommen im kulinarischen Oberschwaben, dache er.
Auch das gab es in Zukunft noch zu erkunden.
Sopran schob den Einkaufswagen im Eiltempo durch den Supermarkt. Von der Wursttheke holte er sich noch schnell ein Stück Salami Veronese mit Knoblauch, die gab es nur hier, ebenso offenen Grana Padano und Oliven. Tomaten und Rotwein hatte er noch zu Hause. Das musste für das Abendessen reichen, zum Einkaufen für das Wochenende hatte er morgen noch Zeit genug.
Er ging an eine Kasse und legte seine Einkäufe auf das Band. Beim Bezahlen stellte er fest, dass er noch Brot brauchte. In der Bäckerei am Ausgang erstand er ein kleines Ciabatta-Brot und eilte danach hinaus zum Parkplatz.
***
Eine halbe Stunde, nachdem Sopran den Anruf im Supermarkt erhalten hatte, stellte er den Golf in seinem Carport ab. Er trug die Einkäufe in die Küche, das Sixpack und den Käse brachte er in den Kühlschrank, die Salami und das Brot ließ er auf der Anrichte liegen. Dort hing auch sein Notebook zum Aufladen des Akkus an der Steckdose.
Er zog den Stecker, entfernte das Ladekabel und legte es auf den Küchentisch.
Mit dem Notebook ging er ins Wohnzimmer, öffnete die Terrassentür und stellte den PC auf dem Esstisch ab. Während Windows hochfuhr, holte er aus seinem Arbeitszimmer im Obergeschoss ein leeres Blatt Papier aus dem Drucker sowie aus der linken Schreibtischschublade sein altes Diktiergerät für den Fall, dass der Anruf auf das Handy kam und er das integrierte Diktiergerät nicht nutzen konnte. Zuletzt griff er nach einem Kugelschreiber.
Zurück im Wohnzimmer, nahm er das schnurlose Telefon aus der Ladeschale im Bücherregal, legte alles griffbereit auf dem Esstisch ab, holte die Mail aus Finnland wieder auf den Bildschirm, lehnte sich in die geöffnete Terrassentür und wartete auf den Anruf.
Es war kurz nach sieben, als das Festnetztelefon klingelte. Sopran eilte zum Esstisch, schaltete das Diktiergerät ein, nahm das Gespräch an und stellte das Telefon auf laut.
»Hallo, Herr Sopran, Christina Hellman, hier bin ich wieder. Ist es passend? Ich hoffe, wir haben Sie mit unserer Mail nicht beunruhigt.«
Genau das hatte sie schon vorhin beim ersten Anruf gesagt.
»Mich kann man nicht beunruhigen«, erwiderte Sopran selbstsicher.
»Oh, ja, ich dachte nur, dass Sie sich vielleicht Gedanken darüber gemacht haben, was wir von Ihnen wollen«, sagte Christina Hellmann zögernd. »Darf ich Ihnen das erklären? Es ist etwas kompliziert.«
Sopran spürte, wie sich sein Rücken spannte. Er nahm den Kugelschreiber in die Hand und begann unbewusst, kleine Fragezeichen auf das Papier zu malen.
»Hallo, Herr Sopran, sind Sie noch da?«
»Ja, ja, sagen Sie mir, was Sie von mir wollen. Aber zunächst hätte ich gern gewusst, wie Sie auf mich gekommen sind.« Das interessierte ihn am meisten.
Christina Hellman fragte ihn, ob er sich noch an Kari Luukkonen erinnere.
Und ob er das tat. Er wusste noch gut, wie er sich Kari vorgestellt hatte, als sie sich an einem eiskalten Januarabend 2005 an einer Moskauer Hotelbar kennengelernt hatten.