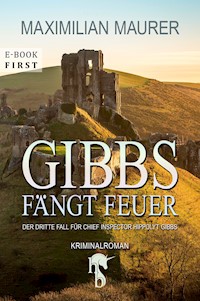4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks: e-book first
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Anfang der 1990er-Jahre in London. Im Old-London-Varieté-Theater wird „Mac the Knife“ vom Messer seiner Assistentin Veronique tödlich getroffen. Unvermögen oder Absicht? Chief Inspector Hippolyt Gibbs muss sich derweil um den Mord an einer Juweliersfrau und verschwundene Diamanten kümmern. Melanie, Gibbs’ ehemalige Assistentin und nun Ehefrau, wird mit dem Fall eines erstochenen Tresorknackers beauftragt. Da Gibbs mit seinem untrüglichen Spürsinn eine Verbindung der beiden Fälle wittert, freut er sich auf die lang vermisste, gemeinsame Ermittlungsarbeit. Superintendent Crawford erwartet schnelle Ergebnisse, denn der Juwelier, Mr Patton, ist ein guter Freund. Dann erfährt Gibbs, dass Mr Patton in der Nacht im Old-London war, als „Mac the Knife“ starb. Nichts passt zusammen bei diesen Ermittlungen. Doch Gibbs folgt wie immer hartnäckig den widersprüchlichen Spuren, bis zum Showdown …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Maximilian Maurer
Kommt ein Messer geflogen
Der vierte Fall für Chief Inspector Hippolyt Gibbs
Kriminalroman
Die wichtigsten Personen dieser Geschichte
Michael Langdon, genannt „Mac the Knife“, Messerwerfer, wirft nie daneben
Monica Langdon, genannt „Veronique“, Messerwerferin, wirft zweimal daneben
Harold Patton, Juwelier
Claire Patton, Goldschmiedin, Ehefrau von Harold Patton
Victor Spencer, Juwelier, handelt mit Kronjuwelen
Peter Smith, Claires Sohn, möchte die Natur retten
Chloe Lambeth, Hausdame oder so was, bei Pattons
Catherine Fowler, Raj Armitage, Pauline Dexter, Angestellte bei Pattons
Walter Price, führt Pattons Geschäfte in der Filiale Birmingham
Samuel Tate, einer, der sich mit Tresoren bestens auskennt
David Davies, Varieté-Direktor
Rosalind Summers, Marc Waring, Angestellte bei Spencer
Dr. Kendall, Dr. Bascomb, zwei Rechtsmediziner
Leslie Sounders, Chef der Spurensicherung
Charly Webster, Privatdetektiv mit seltsamer Frau und tollem Auto
DCI Hippolyt Gibbs, Chief Inspector bei Scotland Yard
DS Melanie Gibbs, ehemalige Assistentin und jetzige Ehefrau
DI Leo Rothman, Detective Inspector bei Scotland Yard
SI John Crawford, Superintendent bei Scotland Yard
Xanthippe Dalglish, hoffnungsvoller Nachwuchs
Die Handlung spielt Anfang der 1990er-Jahre in London.
Eins
„Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, die Direktion des Old-London-Varieté-Theaters hat weder Kosten noch Mühen gescheut, um Ihnen den Höhepunkt des heutigen Abends präsentieren zu können. Sie werden staunen und Sie werden begeistert sein. Warten Sie es ab. Gleich geht es los!“
Der kleine, rotgesichtige Conférencier in seinem speckig gewordenen Smoking mit der breiten türkisfarbenen Schärpe, den Zylinder etwas schräg auf dem Kopf, legte eine kurze Pause ein, um die Spannung zu steigern und um Platz für die Werbung zu machen.
Eine Art Nummerngirl im Badeanzug, durchaus hübsch, mit langen schlanken Beinen in hochhackigen Stiefeln und einem weißen Kragen um den schmalen Hals, trug trippelnden Schritts eine Werbetafel quer über die Bühne. In der Mitte machte sie halt, einen ordentlichen Knicks und lief dann weiter. Auf der Tafel war zu lesen: „Und nach dem Theater zu Burger Queen, gleich um die Ecke. Jetzt neu: der große Super-Bacon-Queeny-Burger“.
Die wenigen Zuschauer im Saal achteten kaum auf die Werbeeinlage, obwohl sich die junge Dame redlich bemühte, die Aufmerksamkeit der Leute auf den großen Super-Bacon-Queeny-Burger zu lenken. Vielleicht tröstete sie es ein wenig, dass auch vom Conférencier, der jetzt wieder in die Mitte der Bühne trat, kaum jemand Notiz nahm.
Bestimmt hatte er, wie das Theater auch, schon bessere Tage gesehen. Aber es war nun einmal sein Job, auch wenn er ihn manchmal zum Kotzen fand, Abend für Abend so zu tun, als hätte er wirkliche Sensationen anzukündigen. Und für wen das Ganze? Für eine Horde gelangweilter Alkoholiker in den Mittvierzigern, die ihre frustrierten Ehefrauen ausführten, damit sie wenigstens einmal im Jahr ihre Klunker herzeigen konnten.
Die Jugend ließ sich hier so wenig blicken wie das Bildungsbürgertum, das ein paar Meilen weiter in der Albert Hall der großen Kunst lauschte. Fast trotzig fuhr er fort:
„Begrüßen Sie mit mir einen der berühmtesten Vertreter seiner Zunft, einen Künstler, den wir extra aus dem fernen Australien haben einfliegen lassen. Er wird mit seiner nicht ganz ungefährlichen Darbietung auch Sie zu Begeisterungsstürmen hinreißen, davon bin ich überzeugt.“
Ja, man musste ihm zugutehalten, er verstand etwas von seinem Job. Er legte eine weitere kurze Pause ein, um seine Worte wirken zu lassen. Diesmal kam kein Nummerngirl. Dann streckte er wie Mick Jagger seinen rechten Arm mit der geballten Faust in die Luft, schob sich das Mikro fast in den Mund und brüllte:
„Hier ist er: ‚Mac the Knife‘, der König der Messerwerfer, begleitet von seiner überaus charmanten Assistentin Veronique.“
Der Beifall war spärlich, irgendjemand pfiff. Ob vor Begeisterung oder vor Enttäuschung, war nicht auszumachen.
Die Besucher der Vorstellung, es mögen fünfzig gewesen sein, gruppierten sich um mehrere runde Tischchen, deren bunt bedruckte Resopaloberflächen im Laufe der Jahre vom vielen Abwischen schon ganz verblasst waren. Die Tische standen in zwei Halbkreisen vor der Bühne. Darauf billige Getränke, ein Aschenbecher und für die Romantik ein Teelicht in einem Halter aus Marmor. Die Männer bevorzugten Bier oder Whiskey, die Frauen nippten von Zeit zu Zeit an ihren Cocktails. Vereinzelt sah man auch eine Flasche Wein.
Die Zuschauer hatten zuvor schon einen mittelmäßigen Zauberer, eine langweilige Hundedressur, einen Clown, bei dem einem das Lachen im Halse stecken blieb, und eine Gruppe leicht bekleideter, aber nicht mehr ganz taufrischer Tänzerinnen über sich ergehen lassen, die einen Cancan präsentierten, der dem berühmten Jacques Offenbach die Tränen in die Augen getrieben hätte. Was sollte da schon noch kommen?
In der Mitte der Bühne flammte ein heller Spot auf und malte einen weißen Lichtkreis auf den Bretterboden. Das rötliche Licht im Zuschauerraum wurde heruntergedimmt und breitete eine gnädige Dämmerung über das in die Jahre gekommene Mobiliar aus. Der schale Mief aus Tabakqualm, Alkohol und billigem Parfüm schien jetzt noch deutlicher wahrnehmbar.
Trotzdem wäre es falsch, die Bedeutung von Etablissements wie dem Old-London-Varieté-Theater zu unterschätzen. Damals, in der Zeit vor dem Fernsehen, traf sich an solchen Orten, wie auch in den anderen großen Städten, die Welt der Reichen und Schönen. Wein und Champagner flossen in Strömen und auf der Bühne traten nur die besten ihres Metiers auf. Heute können die kleinen Theater mit der Konkurrenz der Mattscheibe nicht mehr mithalten. Zu hoch sind die Gagen, die dort bezahlt werden, zu groß die Ansprüche des verwöhnten Fernsehpublikums.
Doch die alten Theater mit ihren Live-Darbietungen sind noch nicht tot. Mit ihrem morbiden Charme dienen sie als Plattform für junge Nachwuchstalente. Und auch für Künstler, die nicht mehr im vollen Rampenlicht ihrer Karriere stehen, haben sie noch immer ihre Berechtigung.
So wie für den Mann, der jetzt im Lichtkegel des Scheinwerfers auf der Bühne stand und die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich zog. Natürlich kam er nicht aus Australien und schon gar nicht wurde er extra für seinen Auftritt eingeflogen. Er war vielmehr ein waschechter Londoner aus der Eastside, der mit wirklichem Namen Michael Langdon hieß. Seine Assistentin Veronique, die im wirklichen Leben auf den Namen Monica hörte, war auch keine Französin, sondern seine Ehefrau und die Mutter seiner beiden Kinder, die längst ihre eigenen Wege gingen.
Die Zeiten, als sich die großen Bühnen um „Mac the Knife“ rissen, waren lange vorbei. Aber was machte das schon aus. Sein Kostüm mit den kostbaren Stiefeln aus feinem Echsenleder, der schwarzen Weste mit den langen Fransen an Brust und Armen und der Bolo Tie, die von einer Spange aus echtem Sterlingsilber gehalten wurde, erinnerte ein wenig an die Westernhelden der 50er-Jahre. Noch immer legte er großen Wert auf jedes Detail seines Outfits. Ein Vierteljahrhundert Bühnenerfahrung hatte ihn gelehrt, wie wichtig der äußere Eindruck für das Publikum ist.
Ein Orchester konnte man sich in diesem Theater schon lange nicht mehr leisten, die musikalische Untermalung kam vom Band und der Mann, der es bediente, war auch für den Vorhang zuständig und putzte spät abends noch das Theater. Während „Mac the Knife“ den hellgrauen Stetson abnahm und ihn zum Rhythmus der Musik grüßend in Richtung Publikum schwenkte, trat seine Assistentin Veronique auf. Mit kleinen schnellen Schritten eilte sie, seitlich aus der Kulisse hervortretend, nach vorne an seine Seite und lächelte winkend und knicksend ins Publikum. Ihr Kostüm, das im Wesentlichen aus einem gelben, mit Pailletten und Straußenfedern dekorierten Badeanzug bestand, betonte ihre immer noch ansprechende Figur. Die schlanken Beine steckten in halbhohen, hochhackigen Stiefeln, die Hände in langen weißen Handschuhen. Auf den blonden, nach Art der 60er-Jahre toupierten Haaren saß ein winziger schwarzer Cowboy-Hut mit einem roten Band und einem goldfarbenen Sheriffstern.
Bühnenarbeiter rollten ein hölzernes Podest herein und richteten es anhand von Markierungen auf dem Bühnenboden aus. Das Licht auf der Bühne konzentrierte sich jetzt ganz auf den Messerwerfer und das rund sechs Yard entfernte Gestell aus Aluminiumprofilen, an dessen Vorderseite eine kreisrunde, mannshohe Zielscheibe aus Holz angebracht war. Sie war mit einer dicken Korkschicht beklebt. Das schwarze Feld in der Mitte der weißen Scheibe maß ungefähr zwei Fuß im Durchmesser. Darum herum verliefen mehrere konzentrische Ringe. Ein Fadenkreuz teilte die Scheibe in vier Sektoren. In jedem Sektor gab es eine Halterung mit dicken Lederriemen, an denen man Handgelenke oder Fußknöchel festschnallen konnte.
Veronique hatte unterdessen ein verchromtes Rolltischchen aus dem im Halbdunkel liegenden hinteren Teil der Bühne herbeigezaubert. Auf einem grünen Samtkissen lagen acht blitzende Messer, daneben ein Stapel überdimensionierter Spielkarten. Sie nahm die Karten und zeigte sie aufgefächert dem Publikum. Während sie mit wiegenden Hüften zum Podest schritt, um sie dort an verschiedenen Stellen zu befestigen, griff sich „Mac the Knife“ drei seiner im Licht glänzenden Messer und jonglierte sehr geschickt damit. Als Veronique die letzte ihrer Karten platziert hatte, im Zentrum konnte man das Herz-Ass sehen, ging sie zu ihrem Meister zurück und reichte ihm die restlichen fünf Messer. Die Musik brach ab und brachte damit das Publikum dazu, den Vorgängen auf der Bühne etwas mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Der Messerwerfer stellte sich in Positur und nahm eines der Messer in die rechte Hand, die er für einen kurzen Moment über den Kopf hob und schon sauste der blanke Stahl surrend gegen die Zielscheibe und blieb in einer der Karten stecken. In schneller Abfolge folgten die restlichen Messer. Das letzte bohrte sich leise zitternd mitten in das Herz-Ass. Der Beifall war spärlich. „Mac the Knife“ verbeugte sich trotzdem dankbar lächelnd, während Veronique die Messer zurückholte und mit einem grünen Tuch blank wischte. Wie üblich, steigerte sich der Schwierigkeitsgrad der Darbietung mit der Fortdauer des Geschehens. Da drehte sich plötzlich die Scheibe. Doch die Messer fanden trotzdem ihr Ziel. Anschließend wurde Veronique an der Scheibe festgeschnallt und die Messer bohrten sich nur so um sie herum ins Holz. Der Beifall war jetzt stärker und die Zuschauer dachten, die Nummer wäre damit zu Ende. Aber sie täuschten sich.
Veronique spielte jetzt, recht gekonnt übrigens, die Rolle der unzufriedenen Assistentin und wollte unbedingt selbst auch ein Messer auf die Scheibe werfen. Sie bettelte den großen Meister geradezu an, er möge sie es doch auch einmal versuchen lassen. Aber der blieb hart. Niemals, so schien es, würde er seine geheiligten Messer einer Frau anvertrauen. Er winkte genervt ab. Doch Veronique ließ nicht locker. Endlich hatte der Meister ein Einsehen und reichte ihr ein altes verrostetes Messer, das er aus dem untersten Fach des Beistelltischchens hervorgeholt hatte. Gleichzeitig wandte er sich ab, als könne er die Blamage, die unweigerlich folgen musste, nicht mitansehen. Veronique stellte sich in Positur und zielte, indem sie den rechten Arm unsicher zitternd über dem Kopf schwang. Das Messer drehte sich ein paar Mal unkontrolliert um seine Achse, flog zwar in Richtung Zielscheibe, prallte dort aber mit dem Heft voraus ziemlich nah am Rand ab und fiel zu Boden. Mac schlug sich vor Freude auf die Schenkel und lachte sich halb tot über die Unfähigkeit seiner Assistentin. Die Zuschauer stimmten in das Gelächter ein. Veronique war sauer und schmollte. Sie stapfte, die weiß behandschuhten Hände in die Seiten gestemmt, nach vorne, holte das Messer zurück und wollte es gleich noch einmal versuchen. Aber der Messerwerfer winkte ab. Vielleicht hatte er Mitleid mit ihr, denn er überreichte ihr eines seiner Messer. Er führte Veronique zu einem Punkt, der näher an der Scheibe lag, und zeigte ihr, wie sie das Messer zu halten hatte. Die Assistentin nickte mit dem Kopf, als habe sie es jetzt verstanden. Als sie werfen wollte, hielt Mac sie jedoch zurück. Dem Wägelchen, auf dem die Ausrüstung lag, entnahm er eine extragroße Karte, ein Herz-Ass, fast so groß wie das schwarze Feld im Zentrum der Scheibe. Er brachte die Karte nach vorn zur Scheibe, immer wieder ängstlich um sich blickend, als fürchtete er, dass ihm seine übereifrige Assistentin im nächsten Moment das Messer in den Rücken jagen könnte. Als er die kaum zu verfehlende Riesenkarte in der Mitte der Scheibe platziert hatte, trat er zur Seite und gab Veronique ein Zeichen. Nun sollte sie versuchen, die Karte zu treffen. Doch Veronique zierte sich. Sie rief dem Inspizienten zu, er wolle doch bitte für einen Trommelwirbel sorgen. Als dieser einsetzte, konzentrierte sie sich und warf, wie Mac es ihr gezeigt hatte. Zitternd blieb das Messer in der Scheibe stecken. Aber nicht irgendwo, sondern genau im Zentrum der Spielkarte.
Jetzt applaudierten die Zuschauer und lachten, aber diesmal war es ein Lachen voller Bewunderung. Veronique, von diesem Beifall ermutigt, nahm resolut ihren Herrn und Meister an der Hand, führte ihn zur Scheibe und wollte ihn an Händen und Beinen festschnallen. Doch Mac schien zu ahnen, was sie mit ihm vorhatte.
„No! No! No!“, rief er angstvoll und wollte sich davonstehlen. Aber seine Assistentin war jetzt nicht mehr zu bremsen. Sie zerrte ihn zurück und lachte ihn aus. Dann rief sie:
„Feigling! Feigling!“
Und das Publikum fiel wie aufs Stichwort ein: „Feigling! Feigling!“
Endlich stand „Mac the Knife“, alias Michael Langdon, jammernd und flehend an der Scheibe, Hände und Füße festgeschnallt. Doch Veronique kannte kein Mitleid. Immerhin gab sie ihm noch ein Küsschen, bevor sie ihn allein ließ. Sie nahm vier der Messer auf und machte sich wurfbereit. Aber wieder zögerte sie. Irgendetwas gefiel ihr noch nicht. Natürlich, die Scheibe musste sich ja drehen. Wieder gab sie dem Inspizienten eine Anweisung und die Scheibe begann sich langsam zu drehen. Mac war jetzt ganz still geworden. Es schien, als hätte er sich still in sein Schicksal ergeben. Aber als Veronique sich auch noch ein schwarzes Tuch vor die Augen band, da wurde es „Mac the Knife“ zu viel.
„Nein! Halt! Stopp!“, jammerte er unter dem Gelächter des Publikums. Jetzt gehörte den beiden Künstlern die volle Aufmerksamkeit der Zuschauer. Manche reckten die Hälse, andere waren sogar aufgestanden, um besser sehen zu können. Das ständige Gemurmel der Unterhaltungen war einer erwartungsvollen Stille gewichen. Fast hätte man eine Stecknadel fallen hören können. Eine Fanfare ertönte und wieder setzte Trommelwirbel ein. Zwei helle Spots flammten auf. Einer direkt auf die sich drehende Scheibe gerichtet, ein anderer auf Veronique, die konzentriert in Position stand. Langsam drehte sich die Scheibe mit dem festgeschnallten Messerwerfer. Als sein Kopf zum zweiten Mal den obersten Punkt erreichte, flog das Messer.
Ein Schwall hellroten Blutes spritzte aus dem Hals des sterbenden Mannes und färbte den Kork der sich unerbittlich weiter drehenden Scheibe. Sekunden später brach Veronique mit einem Schrei des Entsetzens bewusstlos zusammen. Jemand schrie: „Vorhang!“
Zwei
Knapp zwei Stunden, bevor „Mac the Knife“ sein Leben unter dramatischen Umständen, festgebunden an einer Zielscheibe im Old-London-Varieté-Theater, aushauchte, fuhr ein dunkel gekleideter Mann auf einem Fahrrad am Museum von Madam Tussauds vorbei in Richtung Mayfair. Hätte er geahnt, dass die Parze Morta bereits an seinem Lebensfaden herumschnipselte, hätte er sein verwerfliches Vorhaben bestimmt aufgegeben. So fuhr er nichts ahnend weiter bis zur Grosvenor Street. Dort bog er in eine enge, fast menschenleere Seitenstraße ab, die keinen Ausgang hatte. Im Eckhaus hatte ein Juwelier sein Geschäft. An der gegenüberliegenden Ecke ein Modegeschäft mit Angeboten für die extrastarke Dame. Hinter den hell erleuchteten vergitterten Schaufenstern des Juwelierladens lagen ein paar wenige, doch sehr wertvolle Schmuckstücke und mehrere kostbare Uhren.
Doch der Mann interessierte sich nicht dafür. Er hielt vor dem Nachbargebäude, lehnte sein Rad an die Hausmauer und nahm einen kleinen Rucksack vom Gepäckträger, den er sich auf den Rücken schnallte. Wer ihn jetzt gesehen hätte, der hätte sich vermutlich gewundert, dass er trotz der immer noch angenehmen Temperaturen eine Pudelmütze trug, die so schwarz war wie der Rest seiner Kleidung. Mit einem kurzen prüfenden Blick nach rechts und links verschwand er in der Einfahrt des Hauses, um kurz darauf im Hinterhof des Gebäudes wieder aufzutauchen. Offensichtlich kannte er sich hier aus. Er wartete einen Moment, bis das Licht verlosch, das vom Bewegungsmelder in der Durchfahrt eingeschaltet worden war, dann kletterte er lautlos über ein paar Aschentonnen auf die Mauer, die das Haus von dem mit dem Juweliergeschäft trennte, und ließ sich auf der anderen Seite sanft hinabgleiten. Er holte eine kleine Blechdose aus seiner Hosentasche und schwärzte mit dem Inhalt sein Gesicht.
Seine Augen hatten sich inzwischen an die Dunkelheit gewöhnt. Im fahlen Licht des Londoner Nachthimmels sah er sich um. Alles war so, wie man es ihm beschrieben hatte. Die rückseitigen Fenster des Juweliergeschäfts waren vergittert und hatten Milchglasscheiben, die den Blick ins Innere verwehrten. Eine verschlossene Holztür mit einem Glas-Geviert im oberen Teil führte in ein Treppenhaus. Sie stellte die einzige Verbindung zur Straße her. Eine Hofeinfahrt wie im Nachbarhaus, durch die er gekommen war, gab es hier nicht.
Der dunkel gekleidete Mann schaute an der Rückseite des Gebäudes nach oben. Alle Wohnungen lagen im Dunkeln. Nur im dritten Stock des Nachbarhauses brannte Licht und leise Radiomusik wehte aus einem geöffneten Oberlicht. Er interessierte sich vor allem für die erste Etage, durch deren Fenster kein Lichtschein nach außen drang. Sein besonderes Augenmerk galt einem schmalen Fenster direkt über einem knapp einen Meter vorspringenden Anbau des Erdgeschosses. Er studierte aufmerksam die Fassade und begann dann schnell und geräuschlos seinen Weg nach oben. Seinen athletischen Bewegungen sah man an, dass er das nicht zum ersten Mal tat. Er wusste genau, wo er sich festhalten konnte und wo er einen sicheren Tritt fand. Wenige Sekunden später stand er auf dem Anbau vor dem schmalen Fenster, das er von unten beobachtet hatte. Mit einem speziellen Werkzeug aus seinem Rucksack hebelte er das Fenster auf und schob es vorsichtig nach oben. Er lauschte intensiv in die Wohnung hinein, bevor er über das Fensterbrett in den Raum einstieg. Kein Laut war zu hören. Die erste Hürde war geschafft.
Er befand sich in einem Badezimmer mit Toilette. Sorgfältig schloss er das Fenster und verließ das Bad. Er gelangte in einen Flur mit drei Türen. Im Schein seiner Minitaschenlampe konnte er rechter Hand eine weiß lackierte Tür erkennen. Das musste der Ausgang ins Treppenhaus sein. Er ging zur Tür. Sie war geschlossen, aber nicht abgesperrt. Er öffnete sie vorsichtig und spähte in das Treppenhaus hinaus. Kein Laut war zu hören, kein Licht. Alles lag dunkel und friedlich vor ihm. Er schloss die Tür wieder. Hier würde er später die Wohnung verlassen. Das war einfacher, als wenn er über die Hauswand zurück musste.
Er öffnete die Tür, die dem Bad gegenüberlag. Auch hier alles dunkel. Er war allein und konnte die Stille fast körperlich spüren. Dieser Raum war riesig und schien die Werkstatt für die Juweliere zu sein. Er sah sich kurz um, einen Tresor entdeckte er nirgends.
Er machte kehrt und ging nun nach rechts, wo er das Büro mit dem Tresor vermutete. Er öffnete auch diese Tür einen Spalt, um hineinzulauschen. Nichts, kein Licht, kein Geräusch. Er war allein in der Wohnung. Genau so, wie man es ihm angekündigt hatte. Jetzt dürfte alles nur noch ein Kinderspiel sein. Er stieß die Tür weiter auf und ließ das Licht der Taschenlampe einmal kurz durch den Raum kreisen. Das einzige Fenster führte auf den Hof hinaus, von dem aus er eingestiegen war. Davor stand ein Schreibtisch mit einem voluminösen hölzernen Drehstuhl, neben dem im Licht seiner Lampe kurz der Messingbügel einer Damenhandtasche aufblitzte. Seine über die Jahre geschärften Sinne ließen ihn für einen Moment innehalten. Wo eine Handtasche ist, ist meist die dazugehörige Dame nicht weit. Doch er ignorierte, was er gesehen hatte. Sein Instinkt hatte ihm signalisiert, dass die Wohnung leer war. Auf dem Schreibtisch bemerkte er verschiedene Papiere und einen dieser modernen Taschenrechner. Es machte auf ihn den Eindruck, als hätte jemand überstürzt alles liegen und stehen lassen, um sich in den Feierabend zu verabschieden. Aber darüber brauchte er sich jetzt keine Gedanken zu machen. Sein Ziel galt dem Tresor, der gegenüber dem Schreibtisch an der Wand stand. Ein schweres, altmodisches, aber dennoch solides Stück. Jetzt galt es, keine Zeit zu verlieren. Er war lange genug im Geschäft und dieses Modell und all seine Geheimnisse kannte er besser als jedes andere. Fast schämte er sich, dass es ihm so leicht gemacht wurde. Er stellte seinen Rucksack ab und entnahm ihm die Hilfsmittel, die er zum Öffnen brauchte. Mit dem Stethoskop am Ohr drehte er die Sicherungsknöpfe mit geübter Hand erst nach links, dann nach rechts, dann die gleiche Prozedur mit dem anderen Einstellrad. Erst vor, dann wieder zurück und immer weiter. So lange, bis er sicher war, dass er das vernickelte Drehkreuz in der Mitte der Tür bewegen konnte. Er liebte das Geräusch, wenn die schwere Tür aufschwang und mit sanftem Fauchen die Luft durch den Türspalt gesaugt wurde.
Es dauerte nur einen Wimpernschlag, bis er begriff, dass man ihn hereingelegt hatte. Der Tresor war leer, absolut leer. Nichts! Nicht die versprochenen Diamanten, aber auch sonst keine Wertsachen, keine Papiere, einfach gar nichts. Nur ein wenig Staub in den Ecken. Er leuchtete mit der Taschenlampe in jedes Fach. Seine inneren Alarmglocken schrillten. Was hatte das zu bedeuten? Enttäuscht verschloss er den Tresor wieder. So konnte man ihm wenigstens nicht nachweisen, dass er ihn geöffnet hatte. Und wenn nichts im Tresor war, konnte er auch nichts stehlen. Also könnte man ihm höchstens den Einbruch zur Last legen. Handelte es sich möglicherweise um einen Versicherungsbetrug, bei dem er, ohne es zu wissen, mithelfen sollte? Oder hatte sein Informant einen Fehler gemacht und es gab irgendwo noch einen zweiten Tresor? Er beschloss, das Zimmer gegenüber dem Bad noch einmal genauer unter die Lupe nehmen.
Er packte seine Utensilien ein und verließ das Büro. Vorsichtig öffnete er die Tür zur Werkstatt, die sich über die gesamte Vorderfront des Hauses erstreckte. Seine Taschenlampe brauchte er hier nicht. Von der Straßenbeleuchtung und der Neonreklame des Modehauses fiel genug Licht in den Raum. Er erkannte im Halbdunkel einige Arbeitstische mit den üblichen Werkzeugen von Juwelieren. Feilen, Zangen, Hämmerchen lagen bereit, alles sorgfältig aufgeräumt. Übermorgen war Montag, da würden hier wieder Angestellte sitzen, Schmuckstücke entwerfen und Reparaturen vornehmen. Ein Tisch mit einem Schmelzofen, der darauf wartete, nicht mehr Gefälliges in neuen Rohstoff zu verwandeln, aber von einem Tresor keine Spur. Auch kein Wandsafe, nur ein paar Materialschränke und eine Kaffeemaschine unter einem der Fenster auf einem leise surrenden Kühlschrank. Er ging um einen der Arbeitstische herum und wäre beinahe gestolpert. Auf dem Boden vor ihm lag im Halbschatten des Arbeitstisches etwas Längliches, ein Bündel. Er knipste kurz seine Lampe an und erschrak. Bei dem Bündel, über das er beinahe gestolpert wäre, handelte es sich um eine Frau. Eine sehr tote Frau, wie der Einbrecher an der klaffenden Kopfwunde und der ziemlichen Blutlache sehen konnte. Neben ihrem Kopf glänzte das harte Metall der Mordwaffe. Ein typisches Einbrecherwerkzeug, wie er selbst auch eines benutzte, um Fenster oder Schränke aufzuhebeln. Nur dass sein Exemplar kleiner und handlicher war. Er fluchte leise. Er dachte an die Handtasche. Jetzt hatte er kapiert. Es ging mitnichten um einen Versicherungsbetrug. Es ging um Mord. Und den wollte man anscheinend ihm in die Schuhe schieben. Wenn jetzt die Bullen auftauchten und ihn neben einer Leiche fanden, die mit einem Einbrecherwerkzeug erschlagen worden war, dann war er geliefert.
Er musste weg. Und zwar auf der Stelle. Er packte seine Sachen, stürmte aus dem Zimmer, verließ die Wohnung durch die Tür zum Treppenhaus und hastete die Stufen hinunter. Im Laufen riss er sich die Pudelmütze herunter und versuchte damit die Schminke von seinem Gesicht zu wischen. Als er die Tür zur Straße erreichte, hielt er einen Augenblick inne. Er atmete tief durch und versuchte seine Gedanken zu ordnen. Würden sie ihn vor dem Haus erwarten? Nein! Wenn ihn die Polizei hätte festnageln wollen, dann hätten sie das oben direkt neben der Leiche getan. Scheinbar ruhig öffnete er die Haustür, vorsichtig um sich blickend, ob aus dem Dunklen nicht doch jemand hervortrat und ihm die Hand auf die Schulter legte. Doch die Seitenstraße lag völlig ruhig da, sein Fahrrad stand noch dort, wo er es abgestellt hatte. Ein Liebespaar knutschte in einem Hauseingang. Langsam und so unauffällig wie möglich ging er zu seinem Rad, schnallte den Rucksack auf dem Gepäckträger fest und schob es vor bis zur belebten Grosvenor Street. Aufmerksam spähte er nach links und rechts. Nichts war zu sehen, was ihn hätte beunruhigen müssen. Die wenigen Menschen, die an ihm vorbeigingen, nahmen kaum Notiz von ihm. Also stieg er auf sein Rad und fuhr unbehelligt davon. Nachdem er sich einige Meilen vom Tatort entfernt hatte, atmete er auf. Jetzt fühlte er sich bedeutend sicherer. Die Bullen schienen nicht an ihm interessiert zu sein.
Was war da schiefgelaufen? Und wie sollte es jetzt weitergehen? Der Plan, den er mit seinem Informanten ausgeheckt hatte, sah vor, dass er mit den Diamanten zu einem Parkplatz in der Nähe seiner Wohnung kommen sollte, wo sie die Beute aufteilen wollten. Aber er hatte keine Diamanten. Plötzlich bekam er es mit der Angst. Er kannte den Jähzorn seines Komplizen und er wusste genau, was der denken würde, wenn er ohne die Steine ankam. Wie sollte er beweisen, dass der Tresor leer war? Was sollte er tun? Angst kroch in ihm hoch und lähmte seine Gedanken. Er versuchte sich zu konzentrieren, aber es fiel ihm schwer.
Bis zum Treffen hatte er noch etwas Zeit. Er würde erst mal zu Hause vorbeischauen und sich das Gesicht waschen und mit einem Bier seine trockene Kehle anfeuchten. Dabei würde ihm bestimmt eine vernünftige Erklärung einfallen. Dann würde er zum Treffpunkt fahren und mit dem Typen reden. Er musste einfach glaubwürdig wirken. Wenn er ihm die Wahrheit sagte, würde er vielleicht begreifen, dass man sie beide hereingelegt hatte. Ja, da war doch auch noch die Leiche. Die würde seiner Geschichte Nachdruck verleihen. Plötzlich verspürte er richtig Durst. Er freute sich auf ein kühles Glas Stout. Es sollte sein letztes werden, denn er hatte nur noch wenig mehr als eine Stunde zu leben.
Drei
Es war ein bewölkter windiger Sonntagmorgen. Sonne und Regen konnten sich nicht so recht einigen, wer heute das Sagen haben sollte. Gibbs hatte schlecht geschlafen, was eindeutig daran lag, dass er am Abend zuvor zu intensiv der hervorragenden Kochkunst seiner Frau Melanie zugesprochen hatte.
Er saß an seinem altmodischen hölzernen Schreibtisch auf einem ebenso altmodischen hölzernen, ständig knarzenden Drehstuhl in seinem Büro im Yard. Die Beine hatte er auf die Schreibtischplatte gelegt. Seine hochgerutschten Hosenbeine gaben den Blick auf die geliebten rot-weiß gestreiften Ringelsocken frei, die ihm im Yard den Spitznamen „Inspector Ringelsocke“ eingebracht hatten. Irgendwie war er stolz auf diesen Namen, obwohl er vielleicht ein wenig despektierlich klang. Er ließ ihn menschlich erscheinen und hielt die Zahl seiner Neider gering. Und davon gab es im Yard einige. Seine Aufklärungsquote lag exakt bei einhundert Prozent und das war für so manchen Kollegen ein ziemlich schwer verdaulicher Brocken.
Auf der rechten Seite des Tischs ließ sich eine Holzablage unter der Arbeitsplatte herausziehen. Ein halb leerer Becher Kaffee und ein angebissenes Sandwich warteten dort auf weitere Verwendung. Das Sandwich hatte ihm seine Frau am Morgen noch zubereitet, bevor sie sich wieder hinlegte. Sie hatte dienstfrei. Genüsslich kauend las der Chief Inspector die zusammengefassten Berichte des Nachtdienstes. Es schien eine relativ ruhige Nacht gewesen zu sein. In Mayfair hatte man eine Juweliersfrau ermordet, ein polizeibekannter Tresorknacker wurde von einem Liebespärchen auf einem Parkplatz in Hackney erstochen aufgefunden, wobei der Streife am Tatort auffiel, dass der Tote „Arbeitskleidung“ trug und im Gesicht noch Reste von schwarzer Schminke zu finden waren. Dann gab es da noch eine Vergewaltigung in der Underground, ein paar Schlägereien, einen Familienstreit mit einem Schwerverletzten sowie einen bedauerlichen Unfall in einem Varieté-Theater, bei dem ein Messerwerfer ums Leben kam. Aber das waren Fälle, die für die Mordkommission uninteressant waren.
Er würde sich wohl oder übel um die tote Juweliersfrau kümmern müssen. Als er in der Registratur anrief und darum bat, man möge ihm die Unterlagen des Falles bringen lassen, erfuhr er, dass Superintendent Crawford diese bereits angefordert habe, was Gibbs einigermaßen in Erstaunen versetzte.
Wieso war der Super am heiligen Sonntag im Büro? Während er noch darüber nachdachte, schrillte sein Telefon. Es war Superintendent John Crawford, der ihn bat, er möge doch kurz bei ihm vorbeischauen. Es wäre wichtig. Einer derart dringenden Bitte konnte sich Gibbs natürlich nicht verschließen und er machte sich auf den Weg in die oberen Etagen des Yard, wo Superintendent John Crawford ein großzügiges Einzelbüro besaß.
Gibbs verzichtete auf den Fahrstuhl und nahm die Treppe in den achten Stock, um Kalorien abzubauen. Melanie war eine gute Köchin und sein Körper zeigte erste Spuren dieser Kochkunst. Hier oben im Allerheiligsten des Yard herrschte gedämpfte Ruhe dank dicker Teppichböden. Der lange Flur war mit alten Stichen, Stadtansichten von London, und immergrünen Pflanzen in kupfernen Kübeln dekoriert. Wer hier sein Einzelbüro hatte, konnte von sich sagen, dass er es geschafft hatte. Auch Gibbs könnte mittlerweile in einem solchen Büro sitzen, aber er hatte eine Beförderung stets abgelehnt. Er liebte seinen Beruf, der für ihn in erster Linie darin bestand, Verbrecher zu jagen und sie ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Auch wenn es mittlerweile als unmodern galt, so hatte Gibbs doch immer noch die idealistische Vorstellung, als Polizist müsse er das Gute gegen das Böse in der Welt verteidigen. Er wusste, dass er diesen nie endenden Kampf nicht gewinnen konnte. Aber es bereitete ihm noch immer eine tiefe innere Befriedigung, wenn er wieder mal einen der schlimmsten Bösewichte aus dem Verkehr gezogen hatte. Als Superintendent würde er die Ermittlungen nur noch aus der Ferne beobachten können und sich ansonsten mit der ihm so verhassten Bürokratie herumschlagen müssen.
Obwohl, in letzter Zeit dachte Gibbs immer häufiger daran, ob es nicht vielleicht doch an der Zeit wäre, sich ein ruhigeres Betätigungsfeld zu suchen. Nach seinem letzten Fall, bei dem seine frühere Assistentin und jetzige Ehefrau Melanie beinahe ums Leben gekommen wäre, hatte er oft über seine berufliche Zukunft nachgedacht. Wegen einer dummen Vorschrift, nach der Verheiratete nicht gemeinsam in einem Ermittlungsteam arbeiten dürfen, sah er seine Melanie heute seltener als vor der Hochzeit. Als Team waren sie Tag für Tag zusammen und hatten erfolgreich ihre Fälle gelöst, jetzt sah man sich bestenfalls abends oder am Wochenende, wenn die laufende Arbeit dies überhaupt zuließ.
Der Super hatte ihn schon erwartet, begrüßte ihn mit einem herzlichen Händedruck und bat ihn Platz zu nehmen.
„Schön, dass Sie so schnell kommen konnten, Gibbs. Wie geht es Ihnen und Ihrer Frau? Da habe ich doch gleich eine gute Nachricht für Sie. Wie ich höre, wird ganz oben überlegt, ob Ihre Frau vielleicht bald einen Inspectorposten erhalten soll. Man munkelt, die Chancen stünden sehr gut. Also an mir soll es bestimmt nicht scheitern.“
„Danke Sir!“, erwiderte Gibbs, dem das alles etwas peinlich war. „Ich nehme an, Sie wollen mich wegen der ermordeten Juweliersgattin sprechen?“
„So ist es, Gibbs, aber wie kommen Sie darauf?“
„Sie haben sich die Unterlagen des Falles kommen lassen.“
Beinahe hätte er hinzugefügt: „Und es muss einen triftigen Grund geben, wenn Sie am heiligen Sonntag im Büro erscheinen“. Doch er konnte sich gerade noch rechtzeitig bremsen.
„Gut kombiniert Gibbs.“ Der Super lächelte etwas säuerlich. „Wie sieht es derzeit mit Ihrer Auslastung aus.“
„Hält sich in Grenzen, Sir. Da ist noch der alte Fall in Dover. Doch solange wir das Opfer noch nicht identifiziert haben, können wir fast nicht tun.“
„Ah, das freut mich. Ich hätte da nämlich eine ganz große Bitte an Sie. Wie Sie schon vermuten, geht es mir tatsächlich um den Fall in Mayfair. Der Name des Opfers lautet Claire Patton. Harold Patton, das ist ihr Ehemann, ist ein langjähriger Freund von mir. Wir sind Mitglieder im gleichen Club und haben sogar zusammen die Schulbank gedrückt. Er rief mich gestern Nacht noch an und bat mich, alles zu tun, um den Mörder seiner Frau zu finden. Ich habe ihm versprochen, meinen besten Mann für diese Aufgabe abzustellen. Sie können sich vorstellen, was jetzt folgt. Ich bitte Sie, sich um diese Angelegenheit zu kümmern.“