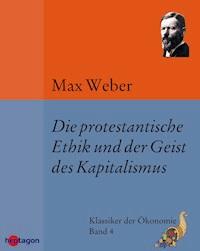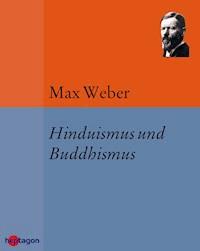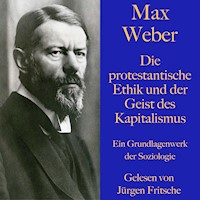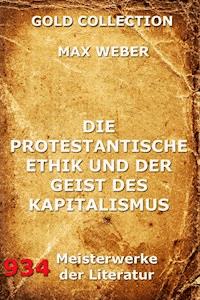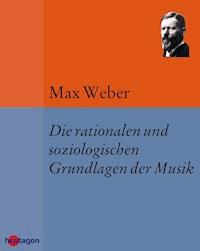Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: heptagon
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Nachdem Max Weber in seinem wirkungsgeschichtlichen Hauptwerk 'Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus' nachgewiesen hatte, dass der moderne Kapitalismus stärker im protestantischen als katholischen Glauben wurzelt, widmete er sich in seinen im Jahre 1916 erschienenen Artikeln der Frage, warum nicht in China zuerst ein moderner Kapitalismus entstanden ist. Das Werk wird bis heute sowohl im Westen als auch in China kontrovers diskutiert. Das vorliegende E-Book enthält die Seitenzählung des Werks aus der Gesamtausgabe und ist somit zum Zitieren in wissenschaftlichen Arbeiten geeignet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 459
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum Veröffentlicht im heptagon Verlag Berlin 2012 ISBN: 978-3-934616-53-0 www.heptagon.de Der Text ist ursprünglich erschienen auf der CD-ROM: »Max Weber: Das Werk, herausgegeben von Thomas Müller. Berlin 2000.« Die zu Grunde liegende Textausgabe ist erschienen als: »Konfuzianismus und Taoismus«, in: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, Bd. I. S. 276-536. Tübingen 1920. Die originalen Seitenzahlen der Printausgabe sind als pagelist hinterlegt, wir ermöglichen somit das Zitieren in wissenschaftlichen Arbeiten. Wenn Ihr Reader dieses Attribut unterstützt, können Sie also die Originalseitenzahlen im E-Book einblenden.
Es handelt sich um eine leicht umgearbeitete Fassung des gleichnamigen Aufsatzes, der als erster Teil unter »Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen« erstmalig veröffentlicht wurde, in: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. Band 41 (1916), S. 31-87 und S. 335-386. Stellen, die im Original in Anführungszeichen stehen, sind in dieser E-Book-Ausgabe kursiv gesetzt. Die Fußnoten Webers wurden übernommen.
Soziologische Grundlagen.
A: Stadt, Fürst und Gott.
Geldwesen.1
China war, in scharfem Gegensatz zu Japan, schon seit einer für uns vorhistorischen Zeit ein Land der großen ummauerten Städte. Nur Städte hatten einen kanonisierten Ortspatron mit Kult. Der Fürst war vornehmlich Stadtherr. Die Bezeichnung für Staat blieb in offiziellen Dokumenten auch der großen Teilstaaten: Eure Hauptstadt bzw. Meine bescheidene Stadt. Noch im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts wurde die endgültige Unterwerfung der Miao (1872) durch einen zwangsweisen Synoikismos, eine Zusammensiedlung in Städte, besiegelt, ganz wie im römischen Altertum bis gegen das 3. Jahrhundert. Im Effekt kam vor allem die Steuerpolitik der chinesischen Verwaltung auf eine sehr starke Begünstigung der Stadtinsassen auf Kosten des platten Landes hinaus.2 Ebenso war China von jeher die Stätte eines für die Bedarfsdeckung großer Gebiete unentbehrlichen Binnenhandels. Dennoch aber war, entsprechend der überragenden Bedeutung der agrarischen Produktion, bis in die Neuzeit hinein die Geldwirtschaft schwerlich je so entwickelt wie etwa im ptolemäischen Ägypten. Dafür ist schon – das allerdings teilweise nur als Verfallsprodukt zu verstehende – Geldsystem mit seinem fortwährend zeitlich und überdies von Ort zu Ort wechselnden Kursverhältnis des Kupferkurants zum Barrensilber – dessen Stempelung in den Händen der Gilden lag –, Beweis genug.3 Das chinesische Geldwesen4 bewahrt Züge äußerster Archaistik in Verbindung mit scheinbar modernen Bestandteilen. Das Zeichen für Reichtum bewahrt noch jetzt die alte Bedeutung Muschel (pei). Es scheint, daß noch 1578 Muschelgeldtribute aus Yünnan (einer Minenprovinz!) vorkamen. Für Münzen findet sich ein Zeichen, welches Schildkrötenschale bedeutet,5Pu pe: Seidengeld, soll unter den Tschou existiert haben und die Leistung von Seide als Steuer hat sich in den verschiedensten Jahrhunderten gefunden. Perlen, Edelsteine, Zinn werden daneben als alte Träger von Geldfunktion genannt und noch der Usurpator Wang Mang (seit 7 n. Chr.) versuchte – vergeblich – eine Geldskala herzustellen, in welcher neben Gold, Silber, Kupfer auch Schildkrötenschalen und Muscheln als Zahlmittel fungierten, während umgekehrt der rationalistische Einiger des Reiches, Schi Hoang Ti, nur runde Münzen, aber – nach einer freilich nicht sehr verläßlichen Angabe – außer Kupfer- auch Goldmünzen (Y und Tsien) hatte schlagen lassen, alle andern Tausch- und Zahlmittel aber – vergeblich – verboten hatte. Silber scheint als Münzmetall erst spät (unter Wu-ti, Ende 2. Jahrhunderts vor Chr.) überhaupt aufzutreten, als Steuer (der Südprovinzen) erst 1035. Zweifellos zunächst aus technischen Gründen. Das Gold war Waschgold, die Kupfergewinnung ursprünglich technisch relativ leicht, Silber dagegen nur durch eigentlichen Bergbau zu gewinnen. Sowohl die Bergbautechnik aber als die Münztechnik der Chinesen ist auf ganz primitiver Stufe stehen geblieben. Die angeblich seit dem 12., wahrscheinlich seit dem 9. Jahrhundert vor Chr. geschaffenen Münzen – erst seit etwa 200 vor Chr. mit Schriftzeichen versehen – wurden gegossen, nicht geprägt. Sie waren daher sehr leicht nachahmbar und an Gehalt sehr verschieden – noch weit verschiedener als, bis zum 17. Jahrhundert, die europäischen Münzen (fast 10% bei englischen Kronen). 18 Stücke der gleichen Emission des 11. Jahrhunderts schwankten nach Biots Wägung zwischen 2,70 und 4,08 g, 6 Stücke der Emission von 620 nach Chr. gar zwischen 2,50 und 4,39 g Kupfer. Schon deshalb allein waren sie kein eindeutig brauchbarer Standard für den Verkehr. Die Goldvorräte wurden wesentlich durch Tatarenbeutegold plötzlich vermehrt, um schnell wieder zu sinken. Gold und Silber wurden daher früh sehr selten, – das Silber, trotzdem die Bergwerke an sich, bei entsprechender Technik, abbauwürdig geblieben wären.6 Kupfer blieb das Kurantgeld des Alltagsverkehrs. Der weit größere Edelmetallumlauf des Okzidents war den Annalisten insbesondere der Han-Zeit sehr wohl bekannt. Die großen, aus den Naturaltributen gespeisten Seidenkarawanen (jährlich eine große Zahl) brachten zwar okzidentales Gold in das Land. (Römische Münzen werden gefunden.) Doch das hörte mit dem Ende des Römerreichs auf und erst die Zeit des Mongolenreichs brachte wieder Besserung.
Für die Zentralregierung kam bei ihren Beziehungen zum Geldwesen neben unmittelbarem Kriegsbedarf und andern rein fiskalischen Motiven auch die Preispolitik sehr stark beherrschend in Betracht. Inflationistische Neigungen – Freigabe der Prägung, um die Kupfergeldproduktion anzuregen – wechselten mit Maßregeln gegen die Wirkung der Inflation: Schließung eines Teils der Münzstätten.16 Vor allem aber war das Verbot und die Kontrolle des Außenhandels valutapolitisch mitbestimmt: teils durch Angst vor dem Abströmen des Geldes bei freier Einfuhr, teils durch die Sorge vor Überschwemmung mit fremdem Geld bei freier Ausfuhr17 von Waren. Ebenso war die Verfolgung der Buddhisten und Taoisten zwar zum sehr wesentlichen Teil religionspolitisch, daneben aber oft rein münzfiskalisch bedingt: die Buddhastatuen, Vasen, Paramente, überhaupt die durch die Klosterkunst angeregte künstlerische Verwendung des Geldstoffs wurde der Währung stets erneut gefährlich: die massenhaften Einschmelzungen führten zu scharfer Geldknappheit, Kupferthesaurierungen, Preissenkungen und im Gefolge davon zur Naturalwirtschaft.18 Systematische Plünderungen der Klöster durch den Fiskus, Tarifierungen der Kupferwaren19 und schließlich20 der Versuch, ein staatliches Monopol der Fabrikation von Bronze- und Kupferwaren durchzuführen, dem später ein Monopol der Fabrikation aller Metallwaren (um der privaten Münzverfälschungen Herr zu werden) folgte – was beides nicht dauernd durchführbar war. Das später zu besprechende, mit wechselnder Wirksamkeit eingeschärfte Verbot der Bodenakkumulation durch Beamte führte immer wieder zu sehr bedeutenden Anhäufungen von Kupfer in deren Händen und neben sehr hohen Geldbesitzsteuern häuften die preispolitischen und fiskalisch motivierten Geldbesitzmaxima21 sich in Zeiten der Geldknappheit. Der wiederholt versuchte Übergang zum Eisengeld, welches längere Zeit neben Kupfer als Münzmetall herging, führte zu keiner Verbesserung der Lage. Die unter Schi-tong (10. Jahrhundert) erwähnte amtliche Eingabe, welche Verzicht auf den Münzgewinn und Freigabe der Metallverwertung (um Monopolpreise der Metallprodukte und dadurch Anreiz zur industriellen Verwertung zu vermeiden) forderte, blieb unausgeführt.
Die Ming gingen zwar wieder zur geordneten Metallprägung über (wobei, charakteristisch für die Unstetheit der Preisrelation der Edelmetalle, Gold zu Silber wie 4:1 gerechnet worden sein soll), um jedoch sehr bald zunächst (1375) Gold und Silber, dann (1450) auch Kupfer als Geld zu verbieten, weil das daneben zugelassene Papiergeld sich entwertete. Die reine Papierwährung schien damit das endgültige Geldsystem zu werden. Indessen 1489 ist das letzte Jahr, aus welchem die Annalistik das Papiergeld erwähnt, und das 16. Jahrhundert sah Versuche forcierter Kupferprägung, die indessen gleichfalls mißlangen. Erträgliche Zustände schuf erst das Einströmen europäischen Silbers durch den im 16. Jahrhundert beginnenden direkten Verkehr. Ende des Jahrhunderts bürgerte sich die pensatorische Silberwährung (Barren-, in Wahrheit: Banko-Währung) für den Großverkehr ein, die Kupferprägung kam wieder in Gang und die Relation von Kupfer zu Silber veränderte sich zwar wieder sehr bedeutend zuungunsten des Kupfers,30 aber das Papiergeld (jeder Art) blieb seit dem Verbot der Ming von 1620, das die Mandschus aufrecht erhielten, vollständig unterdrückt und der seitdem langsam aber bedeutend gestiegene monetäre Metallvorrat drückte sich in der gesteigerten geldwirtschaftlichen Struktur der Staatsabrechnungen aus. Die Emission von Staatsnoten in der zweiten Taiping-Rebellion endete mit assignatenartiger Entwertung und Repudiation.
Immerhin bedeutete der Umlauf des Silbers in Barren starke Schwierigkeiten. Es mußte in jedem Fall gewogen werden und es galt als legitim, daß die Provinzialbankiers ihre größeren Kosten durch andre als die in den Hafenstädten üblichen Wagen einbrachten. Die Feinheit mußte durch Schmiede geprüft werden. Die Zentralregierung verlangte für die anteilsmäßig stark steigenden Silberzahlungen für jeden Barren Angabe des Herkunftorts und der Prüfungsstelle. Das in Schuhform gegossene Silber hatte in jeder Gegend anderes Schrot.
Es ist klar, daß diese Zustände zur Banko-Währung führen mußten. Die Gilden der Bankiers in den Großhandelsorten, deren Wechsel überall honoriert wurden, nahmen die Gründung von solchen in die Hand und erzwangen die Zahlbarkeit aller Handelsschulden in Banko-Währung. Zwar hat es auch im 19. Jahrhundert an Empfehlungen der Wiedereinführung des staatlichen Papiergeldes nicht gefehlt (Denkschrift von 1831).31 Und die Argumente blieben ganz die alten, wie schon Anfang des 17. Jahrhunderts und im Mittelalter: die industrielle Verwendung von Kupfer gefährde den monetären Umlauf und damit die Preispolitik und überdies liefere die Banko-Währung die Verfügung über das Geld den Händlern aus. Aber es ist damals nicht dazu gekommen. Die Gehälter der Beamten – der mächtigsten Interessenten – waren wesentlich in Silber zahlbar. Breite Schichten von ihnen waren mit den Interessen des Handels an der Nichtintervention der Pekinger Regierung in die Währung solidarisch, weil in ihren Einkommenschancen auf den Handel angewiesen. Jedenfalls aber waren alle Provinzialbeamten einmütig gegen jede Stärkung der Finanzmacht und vor allem: der Finanzkontrolle der Zentralregierung interessiert, wie wir noch sehen werden.
Die Masse der kleinbürgerlichen und kleinbäuerlichen Bevölkerung aber war trotz der stark – aber in den letzten Jahrhunderten im ganzen kontinuierlich und langsam – sinkenden Kaufkraft des Kupfers, zum Teil: wegen dieses Vorgangs, an der Änderung des bestehenden Zustandes nicht oder wenig interessiert. – Die banktechnischen Einzelheiten des chinesischen Zahlungs- und Kreditverkehrs mögen hier außer Betracht bleiben. Es sei nur noch bemerkt: daß der Taël, die pensatorische Rechnungseinheit, in drei hauptsächlichen und einigen nebensächlichen Formen vorkam und die mit einem Bankierstempel versehenen, in Schuhform gegossenen Barren höchst unverläßliches Schrot hatten. Irgend eine oktroyierte Tarifierung der Kupfermünzen bestand jetzt schon lange nicht mehr. Im Innern war die Kupferwährung die einzige effektive. Dagegen war der Silbervorrat und war namentlich das Tempo seines Wachsens seit 1516 ein außerordentlich bedeutendes.
Wir stehen nun vor den beiden eigentümlichen Tatsachen: 1. daß die sehr starke Vermehrung des Edelmetallbesitzes zwar unverkennbar eine gewisse Verstärkung der Entwicklung zur Geldwirtschaft herbeigeführt hat, insbesondere in den Finanzen, – daß sie aber nicht mit einer Durchbrechung, sondern mit einer unverkennbaren Steigerung des Traditionalismus Hand in Hand ging, kapitalistische Erscheinungen aber, soviel ersichtlich, in keinem irgendwie greifbaren Maß herbeigeführt hat. Ferner: 2. daß eine kolossale Vermehrung der Bevölkerung (über deren Umfang noch zu sprechen sein wird) eingetreten ist, ebenfalls ohne daß dafür eine kapitalistische Formung der Wirtschaft den Anreiz gegeben oder aber ihrerseits durch sie Impulse erhalten hätte, vielmehr gleichfalls verknüpft mit (mindestens!) stationärer Form der Wirtschaft. Das bedarf der Erklärung.
Städte und Gilden.
Im Okzident waren in der Antike und im Mittelalter die Städte, im Mittelalter die Kurie und der entstehende Staat Träger der Finanzrationalisierung, der Geldwirtschaft und des politisch orientierten Kapitalismus. Von den Klöstern Chinas sahen wir, daß sie geradezu als Schädlinge für die Erhaltung der Metallwährung gefürchtet wurden. Städte, die wie Florenz eine Standardmünze geschaffen und der staatlichen Münzpolitik die Wege gewiesen hätten, gab es in China nicht. Und der Staat scheiterte nicht nur, sahen wir, mit seiner Währungspolitik, sondern: auch mit dem Versuch der Durchführung der Geldwirtschaft.
Bezeichnend waren die bis in die neueste Zeit typischen Bemessungen der Tempel- und vieler sonstiger Pfründen32 als (vorwiegend) Naturaldeputate. So war denn auch die chinesische Stadt trotz aller Analogien in entscheidenden Punkten etwas anderes als die des Okzidents. Das chinesische Zeichen für Stadt bedeutet: Festung. Dies galt nun auch für die Antike und das Mittelalter des Okzidents. In China war die Stadt im Altertum Fürstenresidenz33 und blieb durchweg bis in die Neuzeit in erster Linie Residenz der Vizekönige und sonstigen großen Amtsträger: ein Ort, in dem, wie in den Städten der Antike und etwa in dem Moskau der Leibeigenschaftszeit, vor allen Dingen Renten, teils Grundrenten, teils Amtspfründen und andere direkt oder indirekt politisch bedingte Einkünfte, verausgabt wurden. Daneben waren die Städte natürlich, wie überall, Sitze der Kaufmannschaft und – jedoch in merklich geringerer Exklusivität wie im okzidentalen Mittelalter – des Gewerbes. Marktrecht bestand auch in den Dörfern unter dem Schutz des Dorftempels. Ein durch staatliches Privileg garantiertes städtisches Marktmonopol fehlte.34
Der Grundgegensatz der chinesischen, wie aller orientalischen, Städtebildung gegen den Okzident war aber das Fehlen des politischen Sondercharakters der Stadt. Sie war keine Polis im antiken Sinne und kannte kein Stadtrecht wie das Mittelalter. Denn sie war keine Gemeinde mit eigenen politischen Sonderrechten. Es hat kein Bürgertum im Sinne eines sich selbst equipierenden stadtsässigen Militärstandes gegeben, wie in der okzidentalen Antike. Und es sind nie militärische Eidgenossenschaften wie die Compagna Communis in Genua oder andere conjurationes, mit feudalen Stadtherren um Autonomie bald kämpfende, bald wieder paktierende, auf die eigene autonome Wehrkraft des Stadtbezirkes gestützte Mächte: Konsuln, Räte, politische Gilden- und Zunftverbände nach Art der Mercadanza entstanden.35 Revolten der Stadtinsassen gegen die Beamten, welche diese zur Flucht in die Zitadelle zwangen, sind zwar jederzeit an der Tagesordnung gewesen. Immer aber mit dem Ziel der Beseitigung eines konkreten Beamten oder einer konkreten Anordnung, vor allem einer neuen Steuerauflage, nie zur Erringung einer auch nur relativen, fest verbrieften, politischen Stadtfreiheit. Eine solche war in der okzidentalen Form schon deshalb schwer möglich, weil niemals die Bande der Sippe abgestreift wurden. Der zugewanderte Stadtinsasse (vor allem: der begüterte) behielt seine Beziehung zum Stammsitz mit dem Ahnenlande und mit dem Ahnenheiligtum seiner Sippe, also: alle rituell und persönlich wichtigen Beziehungen, in dem Dorf, von wo er stammte. Ähnlich etwa wie der Angehörige des russischen Bauernstandes, auch wenn er als Fabrikarbeiter, Geselle, Händler, Fabrikant, Literat in der Stadt die Stätte seiner dauernden Tätigkeit gefunden hatte, innerhalb seines Mir draußen sein Indigenat (mit den in Rußland daran hängenden Rechten und Pflichten) behielt. Der Ζευς ερκειος des attischen Bürgers und seit Kleisthenes sein Demos oder das Hantgemal des Sachsen waren im Okzident Rudimente ähnlicher Zustände.36 Aber dort war die Stadt eine Gemeinde, in der Antike zugleich Kultverband, im Mittelalter Schwurbruderschaft. Davon finden sich in China nur Vorstadien, aber keine Verwirklichung. Der chinesische Stadtgott war nur örtlicher Schutzgeist, nicht aber: ein Verbandsgott, in aller Regel vielmehr: ein kanonisierter Stadtmandarin.37
Es fehlte – daran liegt dies – völlig der politische Schwurverband von wehrhaften Stadtinsassen. Es gab in China bis in die Gegenwart Gilden, Hansen, Zünfte, in einigen Fällen auch eine Stadtgilde, äußerlich ähnlich der englischen Gilda mercatoria. Wir werden sehen, daß die kaiserlichen Beamten mit den verschiedenen Verbänden der Stadtinsassen sehr stark zu rechnen hatten, daß, praktisch angesehen, diese Verbände in überaus weitgehendem Maß, weit intensiver als die kaiserliche Verwaltung, und in vieler Hinsicht auch weit fester als die durchschnittlichen Verbände des Okzidents, die Regulierung des ökonomischen Lebens der Stadt in der Hand hielten. In mancher Hinsicht erinnerte der Zustand chinesischer Städte scheinbar an den der englischen teils in der Zeit der firma burgi teils der Tudorzeit. Nur schon rein äußerlich mit dem nicht gleichgültigen Unterschied: daß auch damals zu einer englischen Stadt stets die Charter gehörte, welche die Freiheiten verbriefte. Dergleichen aber existierte in China nicht.38 Im schroffsten Gegensatz zum Okzident, aber in Übereinstimmung mit den indischen Verhältnissen, hatten vielmehr die Städte, als kaiserliche Festungen, im Effekt wesentlich weniger rechtlich garantierte Selbstverwaltung39 als die Dörfer: die Stadt bestand formell aus Dorfbezirken unter je einem besonderen tipao (Ältesten) und gehörte oft mehreren unteren (hsien), in manchen Fällen sogar mehreren oberen (fu) Verwaltungsbezirken mit gänzlich gesonderter staatlicher Verwaltung an40 – sehr zum Vorteil von Spitzbuben. Es fehlte den Städten schon rein formell die Möglichkeit, Verträge – privatrechtlicher oder politischer Art – zu schließen, Prozesse zu führen, überhaupt korporativ aufzutreten, wie sie die Dörfer – wir werden sehen durch welches Mittel – besaßen. Die auch in Indien (wie in der ganzen Welt) gelegentlich vorkommende faktische Beherrschung einer Stadt durch eine machtvolle Kaufgilde bedeutete dafür keinen Ersatz.
Der Grund liegt in der verschiedenen Herkunft der Städte hier und dort. Die Polis der Antike war – wie stark grundherrlich sie auch unterbaut sein mochte – zuerst als Seehandelsstadt entstanden; China aber war vorwiegend ein Binnengebiet. Soweit auch, rein nautisch betrachtet, der tatsächliche Aktionsradius der chinesischen Dschunken gelegentlich und so entwickelt die nautische Technik (Bussole und Kompaß41 war, so geringfügig war doch die relative Bedeutung des Seehandels, verglichen mit dem zugehörenden Binnenkörper. Und überdies hatte China seit Jahrhunderten auf eigene Seemacht – die unentbehrliche Grundlage des Aktivhandels – verzichtet und schließlich, im Interesse der Erhaltung der Tradition, die Beziehungen zum Ausland bekanntlich auf einen einzigen Hafen (Kanton) und eine kleine Zahl (13) konzessionierter Firmen beschränkt. Dieses Ende war nicht zufällig. Schon der Kaiserkanal wurde, wie jede Karte und auch die erhaltenen Berichte ergeben, geradezu nur gebaut, um den durch Piraterie und vor allem durch die Taifune unsichern Seeweg für die Reissendungen von Süd nach Nord zu vermeiden: amtliche Berichte führten noch in der Neuzeit aus, daß der Seeweg für den Fiskus solche Verluste mit sich bringe, daß die gewaltigen Kosten des Umbaus des Kanals sich rentieren würden. Die spezifische okzidentale Binnenstadt des Mittelalters andererseits war zwar, wie die chinesische und vorderasiatische, regelmäßig eine Gründung von Fürsten und Feudalherren zur Gewinnung von Geldrenten und Steuern. Aber zugleich wurde die europäische Stadt sehr früh ein hoch privilegierter Verband mit festen Rechten, die planvoll erweitert wurden und erweitert werden konnten, weil der feudale Stadtherr damals die technischen Mittel zur Stadtverwaltung nicht besaß und: die Stadt ein Militärverband war, der einem Ritterheer die Tore erfolgreich schließen konnte. Die großen vorderasiatischen Städte, etwa Babylon, wurden demgegenüber früh von der Gnade der bureaukratischen königlichen Kanalbauverwaltung in ihrer ganzen Existenz abhängig. Trotz der sehr geringen Intensität der chinesischen Zentralverwaltung galt dies auch von der chinesischen Stadt. Auch ihr Gedeihen hing sehr stark nicht von dem ökonomischen und politischen Wagemut ihrer eigenen Bürger, sondern von dem Funktionieren der kaiserlichen Verwaltung, vor allem: der Stromverwaltung, ab.42 Unsere okzidentale Bureaukratie ist jung und teilweise geschult erst an den Erfahrungen der autonomen Stadtstaaten. Das chinesische kaiserliche Beamtentum war sehr alt. Die Stadt war hier – vorwiegend – ein rationales Produkt der Verwaltung, wie schon ihre Form zu zeigen pflegte. Zuerst war die Pallisade oder Mauer da, dann wurde die oft im Verhältnis zum ummauerten Areal unzulängliche Bevölkerung, eventuell zwangsweise,43 herangeholt, und mit der Dynastie wechselte, wie in Ägypten, entweder auch die Hauptstadt selbst oder doch ihr Name. Die schließliche Dauerresidenz Peking war bis in die Neuzeit nur in äußerst geringem Maße ein Handels- und Exportindustrieplatz.
Die – wie wir sehen werden – außerordentlich geringe Intensität der kaiserlichen Verwaltung brachte es zwar, wie schon angedeutet, mit sich, daß tatsächlich die Chinesen in Stadt und Land sich selbst verwalteten. Wie die Sippen – deren Rolle öfter zu erörtern sein wird – auf dem Lande, so waren neben ihnen, und für denjenigen, der keiner oder doch keiner alten und starken Sippe angehörte: statt ihrer, in der Stadt die Berufsverbände souveräne Herren über die ganze Existenz ihrer Mitglieder. Nirgends (außer – in anderer Art – in den indischen Kasten) war die unbedingte Abhängigkeit des einzelnen von der Gilde und Zunft (beide wurden terminologisch nicht geschieden) so entwickelt wie in China.44 Mit Ausnahme der wenigen Monopolgilden seit jeher ohne jegliche offizielle Anerkennung durch die staatliche Regierung, hatten sie tatsächlich oft die absolute Jurisdiktion über ihre Mitglieder sich zugeeignet.45 Ihrer Kontrolle unterlag alles, was ökonomisch für ihre Angehörigen von Bedeutung war: Maß und Gewicht, Währung (Stempelung der Silberbarren),46 Straßenerhaltung,47 Kontrolle der Kreditgebarung der Mitglieder und: Konditionenkartell, würden wir sagen:48 Feststellung der Lieferungs-,49 Lager- und Zahlungsfristen, der Versicherungssätze und der Zinsraten,50 Unterdrückung fiktiver oder sonst illegaler Geschäfte, Sorge für die ordnungsmäßige Abfindung der Gläubiger bei Geschäftsübertragung,51 Regelung der Geldsortenkurse,52 Bevorschussung von lange lagernden Waren,53 für die Handwerker vor allem: Regulierung und Beschränkung der Lehrlingszahl54 und eventuell Wahrung des Produktionsgeheimnisses.55 Einzelne Gilden verfügten über ein Millionenvermögen, angelegt oft in gemeinsamem Grundbesitz, erhoben Steuern von ihren Mitgliedern, Eintrittsgelder und Kautionen (für Wohlverhalten) von Neueintretenden, richteten Schauspiele aus und sorgten für das Begräbnis verarmter Genossen.56
Zu der Masse der Berufsverbände stand der Zutritt jedem, der das betreffende Gewerbe betrieb, offen (und war, normalerweise, für ihn pflichtmäßig). Aber es fanden sich nicht nur zahlreiche Reste alter, als tatsächlich erbliches Monopol oder geradezu erbliche Geheimkunst betriebener Sippen- und Stammesgewerbe,57 sondern daneben auch Gildemonopole, welche durch die fiskalische oder fremdenfeindliche Politik der Staatsgewalt geschaffen wurden.58 Und die leiturgische Bedarfsdeckung, zu welcher die chinesische Verwaltung im Mittelalter immer wieder periodisch überzugehen suchte, läßt es möglich erscheinen, daß der Übergang vom interethnisch arbeitsteiligen Sippen- und Stammesgewerbe mit Wanderbetrieb zum ortssässigen frei zur Lehre zugänglichen Handwerk für manche Gewerbe durch Zwischenstufen zwangsmäßig von oben für Staatslieferungen organisierter und an den Beruf gebundener Gewerbeverbände hindurch sich vollzogen hat. Dies bedingte, daß in einem sehr breiten Teil des Gewerbes Sippen- und Stammesgewerbecharakter erhalten blieb. Unter den Han waren mannigfache gewerbliche Hantierungen noch strikte Familiengeheimnisse, und die Kunst der Herstellung von Fuchou-Lack z.B. starb in der Taiping-Rebellion völlig aus, weil die Sippe, die das Geheimnis hütete, ausgerottet war. Es fehlte im allgemeinen die städtische Monopolisierung des Gewerbes. Zwar die von uns als Stadtwirtschaft bezeichnete Art der lokalen Arbeitsteilung zwischen Stadt und Land hatte sich entwickelt – wie sie es überall tat – und auch einzelne stadtwirtschaftspolitische Maßregeln finden sich. Aber jene Art systematischer Stadtpolitik, welche die zur Herrschaft gelangten Zünfte im Mittelalter – die ja die Stadtwirtschaftspolitik erst wirklich durchzuführen suchten – getrieben haben, ist trotz mancher Ansätze nie zur Vollendung gediehen. Insbesondere hat die öffentliche Gewalt zwar gelegentlich immer wieder zu leiturgischer Bindung gegriffen, nicht aber ein System von Zunftprivilegien geschaffen, wie es das hohe Mittelalter kannte. Gerade das Fehlen dieser rechtlichen Garantien verwies ja die Berufsverbände in China auf den Weg rücksichtsloser Selbsthilfe in einem Maß, wie sie im Okzident unbekannt blieb. Sie bedingte es auch, daß feste, öffentlich anerkannte, formale und verläßliche Rechtsgrundlagen einer freien, genossenschaftlich regulierten Handels- und Gewerbeverfassung, wie sie der Okzident kannte und wie sie der Entwicklung des Kleinkapitalismus im abendländischen mittelalterlichen Gewerbe zugute kamen, in China fehlten. Daß sie fehlten, hatte seinen Grund in dem Fehlen einer eigenen politisch-militärischen Macht der Städte und Gilden, und diese Tatsache wiederum findet ihre Erklärung in der frühen Entwicklung der Beamten- (und: Offiziers-) Organisation in Heer und Verwaltung.
Fürstenverwaltung und Gotteskonzeption
im Vergleich mit Vorderasien.
Für die Entstehung der seit aller sicheren geschichtlichen Erinnerung bestehenden Zentralgewalt und ihres Patrimonialbeamtentums ist in China, wie in Ägypten, die Notwendigkeit der Stromregulierung als Voraussetzung aller rationalen Wirtschaft entscheidend gewesen, wie sehr deutlich z.B. eine Bestimmung in einem bei Mencius erwähnten, ins 7. Jahrhundert vor Chr. verlegten, angeblichen Kartell der Feudalfürsten beweist.59 Im Gegensatz zu Ägypten und Mesopotamien stand allerdings, wenigstens im nördlichen China, der politischen Keimzelle des Reiches, der Überschwemmungsschutz durch Deiche und der Kanalbau zu Binnenschiffahrtszwecken (vor allem: Fouragetransportzwecken) voran, nicht in gleichem Maß der Kanalbau zum Zweck der Bewässerung, an dem in Mesopotamien die Anbaufähigkeit des Wüstengebietes überhaupt hing. Die Stromregulierungsbeamten und die schon in sehr alten Dokumenten – damals als eine Klasse hinter den Nährständen und vor den Eunuchen und Lastträgern – erwähnte Polizei bildeten den Keim der präliterarischen, reinen Patrimonialbureaukratie –.
Es fragt sich, inwieweit diese Verhältnisse Konsequenzen nicht nur – wie fraglos ist – politischer, sondern auch religiöser Natur gehabt haben. Der Gott Vorderasiens war nach dem Modell des irdischen Königs geformt. Für den mesopotamischen und ägyptischen Untertan, der den Regen kaum kannte, hing alles Wohl und Wehe, vor allem die Ernte, an dem Tun des Königs und seiner Verwaltung. Der König schuf direkt die Ernte. Das war auch in einigen Teilen des südlichen China, wo die Wasserregulierung alles andere an Wichtigkeit überragte, wenigstens entfernt ähnlich, wenn auch nicht annähernd gleich zwingend. Der direkte Übergang von dem Hackbau zur Gartenkultur war allerdings dadurch bedingt. Im nördlichen China stand dagegen, trotz der auch hier erheblichen Entwicklung der Bewässerung, die Frage der Naturereignisse, des Regens zumal, für die Ernte weit stärker im Vordergrund. In Vorderasien nun begünstigte die alte zentralisierte bureaukratische Verwaltung unzweifelhaft die Möglichkeit der Vorstellung des höchsten Gottes als eines Himmelskönigs, der Welt und Menschen aus dem Nichts geschaffen hat und nun als überweltlicher ethischer Herrscher von der Kreatur die Leistung ihrer Pflicht und Schuldigkeit verlangt: – eine Gottesidee, die tatsächlich nur hier in dieser Stärke die Oberhand behalten hat. Sogleich ist jedoch hinzuzufügen: daß sie die Oberhand behielt, ist aus jenen Ökonomischen Bedingungen allein nicht ableitbar. Auch in Vorderasien selbst ist der himmlische König ja gerade dort zur höchsten, schließlich – allerdings erst bei Deuterojesaja im Exil – zu einer schlechthin überweltlichen Machtstellung emporgestiegen, wo er, in Palästina im Gegensatz zu den Wüstengebieten, nach seiner Gnade Regen und Sonnenschein als Quelle der Fruchtbarkeit sandte.60 Es spielten also offenbar andere Momente bei dem Gegensatz der Gotteskonzeptionen mit. Diese lagen zum erheblichen Teil nicht auf wirtschafts- sondern auf außenpolitischem Gebiet. Wir müssen da etwas weiter ausholen.
Der Gegensatz der vorder- und der ostasiatischen Gottesvorstellungen war keineswegs von jeher in starker Schroffheit vorhanden. Das chinesische Altertum kannte einerseits für jeden Lokalverband einen aus dem Geist des fruchtbaren Erdbodens (schê) und dem Erntegeist (tsi) zusammengeschmolzenen, bereits als ethisch strafende Gottheit entwickelten bäuerlichen Doppelgott (sche-tsi) und andererseits die Tempel der Ahnengeister (tsong-miao) als Gegenstand des Sippenkults. Diese Geister zusammen (sche-tsi-tsong-miao) bildeten den Hauptgegenstand der ländlichen Lokalkulte, den zunächst wohl noch naturalistisch, als eine halbmaterielle magische Kraft oder Substanz vorgestellten Heimatsschutzgeist, dessen Stellung etwa jener des (schon früh wesentlich personaler vorgestellten) westasiatischen Lokalgottes entsprach. Mit steigender Fürstenmacht wurde der Geist des Ackerlandes zum Geist des Fürstengebietes. Mit Entwicklung des vornehmen Heldentums entstand offenbar auch in China, wie meist, ein persönlicher Himmelsgott, etwa dem hellenischen Zeus entsprechend, vom Gründer der Tschou-Dynastie zusammen mit dem Lokalgeist in dualistischer Verbindung verehrt. Mit der Entstehung der kaiserlichen Macht, zunächst als oberlehensherrlicher Gewalt über den Fürsten, wurde das Opfer für den Himmel, als dessen Sohn der Kaiser galt, dessen Monopol; die Fürsten opferten den Geistern des Landes und der Ahnen, die Hausväter den Ahnengeistern des Geschlechts. Der, wie überall, so auch hier, animistisch-naturalistisch schillernde Charakter der Geister, vor allem des Himmelsgeistes (Schang-ti), der sowohl als der Himmel selbst wie als Himmelskönig vorgestellt werden konnte, wendete sich nun aber in China, gerade bei den mächtigsten und universellsten von ihnen, immer mehr ins Unpersönliche,61 genau umgekehrt wie in Vorderasien, wo über die animistisch-halbpersönlichen Geister und die Lokalgottheit sich der persönliche überweltliche Schöpfer und königliche Regent der Welt heraushob. Die Gottesvorstellung der chinesischen Philosophen blieb lange höchst widerspruchsvoll. Für Wang Tschung noch war Gott zwar nicht anthropomorph zu fassen, aber er hatte doch einen Leib, eine Art Fluidum scheint es. Andererseits begründete der gleiche Philosoph seine Leugnung der Unsterblichkeit auch wieder mit der völligen Formlosigkeit Gottes, zu welcher der Menschengeist – ähnlich der israelitischen ruach – nach dem Tode zurückkehre: eine Auffassung, die auch in Inschriften Ausdruck gefunden hat. Immer stärker wurde aber die Nicht-Persönlichkeit gerade der höchsten überirdischen Mächte betont. In der konfuzianischen Philosophie verschwand die Vorstellung eines persönlichen Gottes, die noch im 11. Jahrhundert Vertreter fand, seit dem 12. Jahrhundert, unter dem Einfluß des noch von Kaiser Kang Hi (Verfasser des Heiligen Ediktes) als Autorität behandelten Materialisten Tsche Fu Tse. Daß sich diese Entwicklung zur Unpersönlichkeit62 nicht ohne dauernde Rückstände der Personalkonzeption vollzog, ist später zu erörtern. Gerade im offiziellen Kult aber gewann sie die Oberhand. – Auch im semitischen Orient war zunächst das fruchtbare Land, das Land mit natürlichem Wasser, Land des Baal und zugleich dessen Sitz, und auch hier wurde der bäuerliche Baal des Landes im Sinne des ertragbringenden Bodens zum Lokalgott des ortsgebundenen politischen Verbandes: des Heimatlandes. Aber dies Land galt nun dort als Eigentum des Gottes, und ein Himmel, der, nach chinesischer Art, unpersönlich und doch beseelt, als Konkurrent eines Himmelsherrn hätte auftreten können, wurde nicht konzipiert. Der israelitische Jahwe war zuerst ein bergsässiger Sturm- und Naturkatastrophengott, der in Gewitter und Wolken den Helden zu Hilfe in den Krieg heranzog, der Bundesgott der kriegerisch erobernden Eidgenossenschaft, deren Verband durch Vertrag mit ihm, vermittelt durch seine Priester, unter seinen Schutz gestellt worden war. Dauernd blieb daher die auswärtige Politik seine Domäne, deren Interessenten auch alle größten unter seinen Propheten: diese politischen Publizisten in den Zeiten der ungeheuren Angst vor den mächtigen mesopotamischen Raubstaaten, waren. Durch diesen Umstand gewann er seine endgültige Formung: die auswärtige Politik war seine Tatenbühne mit Krieg und Völkerschicksal in ihren Peripetien. Deshalb war und blieb er zunächst und vor allem der Gott des Außerordentlichen: des Kriegsschicksals, seines Volkes. Da aber dies Volk nicht selbst ein Weltreich schaffen konnte, sondern ein kleiner Staat inmitten der Weltmächte blieb und schließlich ihnen erlag, so konnte er ein Weltgott nur als überweltlicher Schicksalslenker werden, vor dessen Augen auch das eigene auserwählte Volk nur kreatürliche Bedeutung hatte, je nach seinem Verhalten bald gesegnet und bald verworfen wurde.
Demgegenüber wurde das chinesische Reich in historischer Zeit trotz aller Kriegszüge doch immer mehr ein befriedetes Weltreich. Zwar der Anfang der chinesischen Kulturentwicklung stand unter rein militaristischen Zeichen. Der schih, später der Beamte, ist ursprünglich der Held. Die spätere Studienhalle (Pi yung kung), in welcher, dem Ritual nach, der Kaiser persönlich die Klassiker auslegte, scheint ursprünglich ein Männerhaus (ανδρειον) in dem über fast die ganze Welt bei allen spezifischen Kriegs- und Jagdvölkern verbreiteten Sinn gewesen zu sein, das heißt: der Aufenthaltsort der Bruderschaft der durch die noch heute erhaltene Bekappungs-Zeremonie, zweifellos nach vorausgegangener Erprobung, wehrhaft gemachten Jungmannschaft in der Altersstufe ihrer familienfremden Kasernierung. In welchem Maß das typische Altersklassensystem dabei entwickelt war, bleibt fraglich. Daß die Frau ursprünglich die Ackerbestellung allein in der Hand hatte, scheint sich etymologisch wahrscheinlich machen zu lassen: jedenfalls aber nahm sie an den außerhäuslichen Kulten nie teil. Das Männerhaus war offenbar das Haus des (charismatischen) Kriegshäuptlings: hier vollzogen sich diplomatische Aktionen, wie die Unterwerfung von Feinden, hier wurden die Kriegswaffen verwahrt, hierher die Trophäen (abgeschnittene Ohren) gebracht, im Verband der Jungmannschaft das rhythmische – das heißt: disziplinierte – Bogenschießen geübt, nach dessen Ergebnissen der Fürst sich seine Gefolgen und Amtsträger auswählte (daher die zeremoniale Bedeutung des Bogenschießens bis in die jüngste Zeit). Es ist möglich – wenn auch nicht sicher –, daß auch die Ahnengeister dort Rat spendeten. Trifft dies alles zu, dann würden dem die Nachrichten über die ursprüngliche Mutterfolge entsprechen: Mutterrecht scheint primär überall, soviel heut ersichtlich, die Konsequenz der militaristischen Familienfremdheit des Vaters gewesen zu sein.63 In geschichtlicher Zeit lag das weit zurück. Der individuelle Heldenkampf, auch in China, wie anscheinend über die ganze Erde hin (bis Irland), durch die Verwertung des Pferdes, zunächst als Zugtier des Kriegswagens, auf die Höhe gebracht, ließ die infanteristisch orientierten Männerhäuser zerfallen: der hochtrainierte und kostspielig bewaffnete Einzelheld trat in den Vordergrund. Auch dies homerische Zeitalter Chinas lag aber weit zurück und es scheint, daß hier so wenig wie in Ägypten oder Mesopotamien die ritterliche Kriegstechnik je zu einer so individualistischen Sozialverfassung geführt hat, wie im homerischen Hellas und im Mittelalter. Die Abhängigkeit von der Stromregulierung und damit von der fürstlichen bureaukratischen Eigenregie ist vermutlich das entscheidende Gegengewicht gewesen. Die Stellung von Kriegswagen und Gepanzerten wurde den einzelnen Bezirken auferlegt, ähnlich wie in Indien. Kein persönlicher Kontrakt also, wie beim okzidentalen Lehensverband, sondern die katastermäßig reglementierte Gestellungspflicht war die Grundlage auch des Ritterheeres. Doch immerhin war der vornehme Mann Kiün tse, (gentleman), des Konfuzius ursprünglich der waffengeübte Ritter. Aber die Wucht der statischen Tatsachen des Wirtschaftslebens ließ die Kriegsgötter nie zu einem Olymp aufsteigen: der chinesische Kaiser vollzog den Ritus des Pflügens, er war ein Schutzpatron des Ackerbauers geworden und also längst nicht mehr ein Ritterfürst. Zwar die rein chthonischen Mythologeme64 haben keine beherrschende Bedeutung erlangt. Aber seit der Herrschaft der Literaten war die zunehmend pazifistische Wendung der Ideologien naturgegeben, – und: umgekehrt, wie wir sehen werden.
Der Himmelsgeist wurde nun – zumal nach der Vernichtung des Feudalismus – im Volksglauben ganz wie die ägyptischen Gottheiten aufgefaßt nach Art einer idealen Beschwerdeinstanz gegen die irdischen Amtsträger, vom Kaiser angefangen bis zum letzten Beamten. Wie in Ägypten (und in nicht ganz so ausgeprägter Art auch in Mesopotamien) aus dieser bureaukratischen Vorstellung heraus der Fluch des Bedrückten und Armen besonders gefürchtet war: – wir werden sehen, wie das auf die benachbarte israelitische Ethik zurückwirkte –, so auch in China. Diese Vorstellung und nur sie stand, als eine Art superstitiöser Magna Charta, und zwar als eine schwer gefürchtete Waffe, den Untertanen gegen die Beamten und ebenso gegen alle Privilegierten, auch die Besitzenden, zur Seite: ein ganz spezifisches Merkmal bureaukratischer und zugleich pazifistischer Gesinnung.
Die Zeit irgendwelcher wirklicher Volkskriege jedenfalls liegt in China jenseits der historischen Epochen. Freilich war mit der bureaukratischen Staatsordnung die kriegerische Epoche Chinas nicht abgebrochen. Sie führte seine Heere nach Hinterindien und bis in die Mitte von Turkestan. Die älteren literarisch-dokumentarischen Quellen rühmen allen andern voran den Kriegshelden. In historischer Zeit ist nach der offiziellen Auffassung allerdings nur einmal ein siegreicher General als solcher vom Heer zum Kaiser proklamiert worden (Wang Mang um Chr. G.); – tatsächlich ist natürlich das gleiche weit öfter geschehen, aber in den rituell gebotenen Formen oder durch rituell anerkannte Eroberung oder Revolte gegen einen rituell inkorrekten Kaiser. In der für die Prägung der geistigen Kultur entscheidenden Zeit zwischen 8. und 3. Jahrhundert vor Chr. war das Reich ein sehr lockerer Verband politischer Herrschaften, welche zwar sämtlich formell die Oberlehensherrlichkeit des politisch ohnmächtig gewordenen Kaisers anerkannten, aber untereinander in Fehde und vor allem im Kampf um die Hausmeierstellung standen. Der Unterschied gegenüber dem Heiligen Römischen Reich des Okzidents bestand vor allem darin, daß der kaiserliche Oberlehensherr zugleich und vor allem – ein in vorgeschichtliche Zeit zurückreichender wichtiger Sachverhalt – nach Art etwa des okzidentalen Papstes in der von Bonifaz VIII. beanspruchten Stellung: der legitime Oberpriester war. Diese unentbehrliche Funktion bedingte seine Erhaltung. Durch sie bildete er ein wesentliches Element des Kulturzusammenhalts der in ihrem Umfang und ihrer Machtstellung stetig wechselnden Teilstaaten. Die (wenigstens theoretische) Gleichheit des Rituals bildete den Kitt jenes Zusammenhalts. Hier wie im okzidentalen Mittelalter bedingte diese religiöse Einheit die rituelle Freizügigkeit der vornehmen Familien zwischen den Teilstaaten: aus dem Dienst des einen Fürsten trat der vornehme Staatsmann rituell ungehemmt in den Dienst eines anderen über. Die Herstellung des Einheitsreichs seit dem 3. Jahrhundert vor Chr., welche seitdem nur auf kurze Zeiten unterbrochen wurde, befriedeten das Reich – wenigstens dem Prinzip und der Theorie nach – nach innen. Rechtmäßige Kriege waren seitdem in seinem Innern nicht mehr möglich. Die Abwehr und Unterwerfung der Barbaren aber war eine rein sicherheitspolizeiliche Aufgabe der Regierung.
Der Himmel konnte daher hier nicht die Form eines in Krieg, Sieg, Niederlage, Exil und Heimatshoffnung verehrten, in der Irrationalität der außenpolitischen Schicksale des Volks sich offenbarenden Heldengottes annehmen. Dafür waren, wenn man von der Zeit der Mongolenstürme absieht, seit der Errichtung der großen Mauer diese Schicksale im Prinzip nicht mehr wichtig und nicht irrational genug, standen gerade in den Zeiten der ruhigen Entwicklung der religiösen Spekulation nicht greifbar genug, als drohende oder als überstandene Fügungen, als beherrschende Probleme der ganzen Existenz, jederzeit vor Augen, waren vor allem nicht eine Angelegenheit der Volksgenossen. Die Untertanen wechselten nur den Herren bei Thronusurpationen ebenso wie bei gelungenen Invasionen, und in beiden Fällen bedeutete dies lediglich einen Wechsel des Steuerempfängers, nicht einen Wechsel der sozialen Ordnung.65 Die Jahrtausende alte unerschütterte Ordnung des politischen und sozialen Innenlebens wurde daher hier das, was der göttlichen Obhut anheimfiel und sie offenbarte. Auch der israelitische Gott nahm von den sozialen Innenbeziehungen Notiz: als Anlaß der Bestrafung seines Volkes wegen Abfalls von den von ihm eingesetzten alten Bundesordnungen durch kriegerisches Mißgeschick. Aber diese Verletzungen waren, gegenüber der weit wichtigeren Abgötterei, nur eine Kategorie der Sünde unter anderen. Für die chinesische Himmelsmacht dagegen waren die alten sozialen Ordnungen Eins und Alles. Als Hüter ihrer Stetigkeit und ungestörten Geltung und als Hort der durch die Herrschaft vernünftiger Normen garantierten Ruhe, nicht als Quelle irrationaler, befürchteter oder erhoffter, Schicksalsperipetien, waltete der Himmel. Solche Peripetien waren Unruhe und Unordnung. Sie waren daher spezifisch dämonischen Ursprungs. Die Garantie der Ruhe und inneren Ordnung leistete am besten eine in ihrer Unpersönlichkeit und gerade durch sie als über alles Irdische spezifisch erhaben qualifizierte Macht, welcher Leidenschaft, und vor allem Zorn: das wichtigste Attribut Jahwes, fremd bleiben mußte. Diese politischen Grundlagen des chinesischen Lebens also begünstigten den Sieg derjenigen Elemente des Geisterglaubens, welche zwar überall in aller zum Kult sich entwickelnden Magie vorgeformt waren, aber im Okzident durch die Entfaltung der Heldengötter und, endgültig, eines persönlichen ethischen Welterlösergottes von Plebejerschichten, in der Entwicklung gebrochen wurden. Die eigentlich chthonischen Kulte mit ihrer typischen Orgiastik sind zwar auch in China durch die Ritter- und später die Literatenaristokratie ausgetilgt worden.66 Es finden sich weder Tänze – der alte Kriegstanz war verschwunden – noch Sexualorgiastik, noch musikalische Orgiastik, noch andere Rauschformen, kaum auch Rückstände vor, und nur ein einziger Ritualakt scheint sakramentalen Charakter angenommen zu haben; aber gerade er war ganz unorgiastisch. Der Himmelsgott siegte auch hier: – die Philosophen motivierten dies nach Se Ma Tsien's Konfuzius-Biographie damit: daß die Götter der Berge und Wasserbäche die Welt regieren, weil von den Bergen der Regen kommt. Aber er siegte als Gott der himmlischen Ordnung, nicht der himmlischen (Kriegs-) Heerscharen. Es war die spezifisch chinesische, aus andern Gründen und in anderer Art auch in Indien in der Oberhand gebliebene Wendung der Religiösität, welche an der Unverbrüchlichkeit und Gleichmäßigkeit des die Geister zwingenden magischen Rituals und des für ein Ackerbauvolk grundlegenden Kalenders, beide: die Naturgesetze und die Ritualgesetze in Eins setzend und nun an diese Einheit des Tao67 anknüpfend, das Zeitlose, Unabänderliche zur religiös höchsten Macht erhob. Nun wurde statt eines überweltlichen Schöpfergottes ein übergöttliches, unpersönliches, immer sich gleiches, zeitlich ewiges Sein, welches zugleich ein zeitloses Gelten ewiger Ordnungen war, als letztes und höchstes empfunden. Die unpersönliche Himmelsmacht sprach nicht zu den Menschen. Sie offenbarte sich ihnen durch die Art des irdischen Regimentes, also in der festen Ordnung der Natur und des Herkommens, das ein Teil der kosmischen Ordnung war, und – wie überall: – durch das, was den Menschen geschah. Gutes Ergehen der Untertanen dokumentierte die himmlische Zufriedenheit, also: das richtige Funktionieren der Ordnungen. Alle schlimmen Ereignisse dagegen waren Symptome einer Störung der providentiellen himmlisch-irdischen Harmonie durch magische Gewalten. Diese für China durchaus grundlegende optimistische Vorstellung von der kosmischen Harmonie ist aus dem primitiven Geisterglauben allmählich herausgewachsen. Das Ursprüngliche68 war hier wie anderwärts der Dualismus der guten (nützlichen) und der bösen (schädlichen) Geister, der Shen und der Kwei, welche das ganze Universum erfüllten und in den Naturereignissen ebenso wie im Handeln und Ergehen der Menschen sich äußerten. Auch die Seele des Menschen galt – entsprechend der überall verbreiteten Annahme von einer Mehrheit der beseelenden Kräfte – als zusammengesetzt aus der dem Himmel entstammenden Shen- und der irdischen Kwei-Substanz, welche sich nach dem Tode wieder trennten. Die allen Philosophenschulen gemeinsame Lehre faßte dann die guten Geister als das (himmlische und männliche) Yang-Prinzip, die bösen als das (irdische und weibliche) Yin-Prinzip zusammen, aus deren Verbindung die Welt entstanden sei. Beide Prinzipien waren ewig, wie Himmel und Erde. Dieser konsequente Dualismus war aber hier, wie fast überall, optimistisch abgeschwächt und getragen durch die Identifikation des dem Menschen Heil bringenden magischen Charisma der Zauberer und Helden mit den heilbringenden Shen-Geistern, die der segenspendenden Himmelsmacht, dem Yang, entsprangen. Da nun der charismatisch qualifizierte Mensch offensichtlich Macht über die bösen Dämonen (die Kwei) hatte, und feststand: daß die Himmelsmacht die gütige höchste Leiterin auch des sozialen Kosmos war, so mußten also die Shen-Geister im Menschen und in der Welt in ihrem Funktionieren gestützt werden.69 Dazu genügte es aber, daß die dämonischen kwei-Geister in Ruhe gehalten wurden: dann funktionierte die vom Himmel geschützte Ordnung richtig. Denn ohne Zulassung des Himmels waren die Dämonen unschädlich. Die Götter und Geister waren mächtige Wesen. Kein einzelner Gott oder vergötterter Heros oder noch so mächtiger Geist aber war allwissend oder allmächtig. Die nüchterne Lebensweisheit der Konfuzianer konstatierte im Fall des Unglücks frommer Menschen unbefangen: daß Gottes Wille oft unstet sei. Alle diese übermenschlichen Wesen waren zwar stärker als der Mensch, standen aber tief unter der unpersönlichen höchsten Himmelmacht und auch unter einem kaiserlichen Pontifex, der in der Himmelsgnade stand. Nur diese und die ihr ähnlichen unpersönlichen Mächte kamen – im Gefolge dieser Vorstellungen – für die überpersönliche Gemeinschaft als Kultobjekte in Betracht und bestimmten ihr Schicksal.70 Das Schicksal des einzelnen konnten dagegen die magisch zu beeinflussenden Einzelgeister bestimmen.
Mit diesen verkehrte man ganz urwüchsig auf dem Tauschfuß: soundsoviel rituelle Leistungen für soundsoviel Wohltaten. Zeigte sich dann, daß ein Schutzgeist nicht stark genug war, die Menschen trotz aller Opfer und Tugenden zu schützen, so mußte man ihn wechseln. Denn nur der Geist, der sich als wirklich machtvoll bewährte, verdiente Verehrung. Ein solcher Wechsel geschah tatsächlich oft und insbesondere der Kaiser verlieh den Göttern, die sich bewährt hatten, Anerkennung als Objekten der Verehrung, Titel und Rang71 und setzte sie eventuell wieder ab. Nur das bewährte Charisma eines Geistes legitimierte. Zwar war – wie gleich zu besprechen – der Kaiser für Unglück verantwortlich. Aber auch dem Gott, der durch Los-Orakel oder sonstige Weisungen ein mißglücktes Unternehmen veranlaßt hatte, gereichte dies zur Schande. Noch 1455 hielt ein Kaiser dem Geist des Tsai-Berges offiziell eine strafende Rede. Und in anderen Fällen wurden solchen Geistern Kulte und Opfer gesperrt. Der Rationalist unter den großen Kaisern und Einiger des Reichs: Schi-hoang-ti, ließ einen Berg zur Strafe dafür, daß der Geist sich renitent gezeigt und ihm den Zutritt erschwert hatte, kahl schlagen, wie Se Ma Tsien in dessen Biographie erwähnt.
Charismatische und pontifikale Stellung des Zentralmonarchen.
Ihm, dem Kaiser selbst, ging es aber natürlich, getreu dem charismatischen Prinzip der Herrschaft, ganz ebenso. Von dieser eingelebten politischen Realität ging ja diese ganze Konstruktion aus. Auch er mußte sich durch seine charismatischen Qualitäten als vom Himmel zum Herrscher berufen bewähren. Das entsprach durchaus den – erbcharismatisch temperierten – genuinen Grundlagen charismatischer Herrschaft. Charisma war überall eine außeralltägliche Kraft (maga, orenda), deren Vorhandensein sich in Zaubermacht und Heldentum offenbarte, bei den Novizen aber durch Erprobung in der magischen Askese festgestellt (je nach der Abwandlung der Vorstellung auch: als neue Seele erworben) werden mußte. Die charismatische Qualität war aber (ursprünglich) verlierbar: der Held oder Magier konnte von seinem Geist oder Gott verlassen werden. Nur solange sie sich bewährte: durch immer neue Wunder und immer neue Heldentaten, mindestens aber: dadurch, daß der Magier oder Held nicht sich selbst und seine Gefolgschaft offenkundigen Mißerfolgen aussetzte, erschien ihr Besitz gewährleistet. Heldenstärke galt ursprünglich ja ebenso als magische Qualität wie die im engeren Sinne magischen Kräfte: Regenzauber, Krankheitszauber und die außeralltäglichen technischen Künste.72 Entscheidend für die Kulturentwicklung war wesentlich Eins: die Frage, ob das militärische Charisma des Kriegsfürsten und das pazifistische Charisma des (in der Regel: meteorologischen) Zauberers beide in einer Hand lagen oder nicht. Im ersten Fall (dem des Cäsaropapismus) aber: welches von beiden primär die Grundlage der Entwicklung der Fürstenmacht wurde. In China nun haben – wie früher schon eingehend dargelegt wurde – grundlegende, für uns aber vorhistorische Schicksale, vermutlich durch die große Bedeutung der Stromregulierung mitbedingt,73 das Kaisertum aus dem magischen Charisma hervorgehen lassen und weltliche und geistliche Autorität in einer Hand, jedoch unter sehr starkem Vorwalten der letzteren, vereinigt. Das magische Charisma des Kaisers mußte sich zwar auch in kriegerischen Erfolgen (oder doch dem Fehlen eklatanter Mißerfolge), vor allem aber in gutem Erntewetter und gutem Stande der inneren Ruhe und Ordnung bewähren. Die persönlichen Qualitäten aber, die er, um charismatisch begnadet zu sein, besitzen mußte, wurden von den Ritualisten und Philosophen ins Rituelle und weiterhin ins Ethische gewendet: er mußte den rituellen und ethischen Vorschriften der alten klassischen Schriften entsprechend leben. Der chinesische Monarch blieb so in erster Linie ein Pontifex: der alte Regenmacher der magischen Religiosität,74 ins Ethische übersetzt. Da der ethisch rationalisierte Himmel eine ewige Ordnung schützte, waren es ethische Tugenden75 des Monarchen, an denen sein Charisma hing. Er war, wie alle genuin charismatischen Herrscher, ein Monarch von Gottes Gnaden nicht in der bequemen Art moderner Herrscher, welche auf Grund dieses Prädikates beanspruchten, für begangene Torheiten nur Gott, und das heißt praktisch: gar nicht, verantwortlich zu sein. Sondern im alten genuinen Sinne der charismatischen Herrschaft. Das hieß nach dem soeben Ausgeführten: er hatte sich als Sohn des Himmels, als der von ihm gebilligte Herr, dadurch auszuweisen: daß es dem Volke gut ging. Konnte er das nicht, so fehlte ihm eben das Charisma. Brachen also die Flüsse durch die Deiche, blieb der Regen trotz aller Opfer aus, so war dies, wie ausdrücklich gelehrt wurde, ein Beweis, daß der Kaiser jene charismatischen Qualitäten nicht besaß, welche der Himmel verlangte. Er tat dann – so noch in den letzten Jahrzehnten – öffentlich Buße für seine Sünden. Ein solches öffentliches Sündenbekenntnis verzeichnet die Annalistik schon für die Fürsten des Feudalzeitalters76 und die Sitte hat bis zuletzt fortbestanden: noch 1832 folgte auf eine solche öffentliche Beichte des Kaisers alsbald der Regen.77 Wenn auch das nicht half, hatte er Absetzung, in der Vergangenheit wohl Opferung, zu gewärtigen. Er war der amtlichen Rüge der Zensoren ausgesetzt78 wie die Beamten. Vollends ein Monarch, welcher den alten festen sozialen Ordnungen, einem Teil des Kosmos, der als unpersönliche Norm und Harmonie über allem Göttlichen stand, zuwiderhandelte: – der z.B. etwa das absolute göttliche Naturrecht der Ahnenpietät alteriert hätte –, würde damit (nach der immerhin nicht schlechthin gleichgültigen Theorie) gezeigt haben, daß er von seinem Charisma verlassen und unter dämonische Gewalt geraten war. Man durfte ihn töten, denn er war ein Privatmann.79 Nur war die dafür zuständige Macht natürlich nicht jedermann, sondern es waren das die großen Beamten (etwa so wie bei Calvin die Stände das Widerstandsrecht hatten).80 Denn auch der Träger der staatlichen Ordnung: das Beamtentum, galt als mitbeteiligt am Charisma81 und daher in gleichem Sinn als eine Institution heiligen Rechtes, wie der Monarch selbst, mochte auch der einzelne Beamte persönlich, wie bis in die Gegenwart, ad nutum amovibel sein. Auch ihre Eignung war daher charismatisch bedingt: jede Unruhe oder Unordnung sozialer oder kosmisch-meteorologischer Art in ihrem Sprengel bewies: daß sie nicht die Gnade der Geister hatten. Ohne alle Frage nach Gründen mußten sie dann aus dem Amt weichen.
Diese Stellung des Beamtentums war seit einer für uns vorgeschichtlichen Zeit in Entwicklung begriffen. Die alte halb legendäre heilige Ordnung der Tschou-Dynastie, wie sie im Tschou-li überliefert ist, steht bereits auf dem Punkt, wo der urwüchsige Patriarchalismus in den Feudalismus überzugehen beginnt.