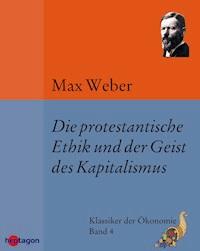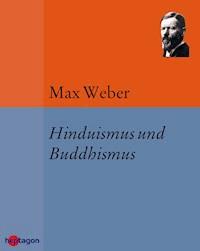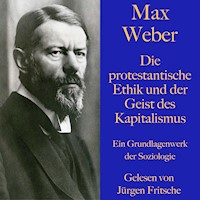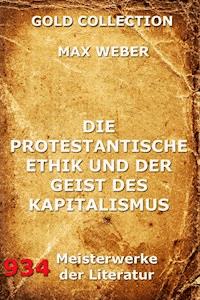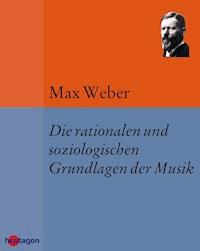Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: heptagon
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In diesem interdisziplinären 'betriebssoziologischen' Werk von 1908 analysiert Max Weber verschiedene Aspekte menschlicher Arbeit. Themenbereiche der auf vielen statistischen Auswertungen beruhenden Studie sind u.a. Ermüdung durch Arbeit, Auswirkungen von Luftfeuchtigkeit und Alkoholkonsum auf die Arbeitsleistung, Lärmschutz und die Schwankungen der Arbeitsleistung zwischen einzelnen Wochentagen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Veröffentlicht im heptagon Verlag Berlin 2013 ISBN: 978-3-934616-89-9 www.heptagon.de
Ursprünglich ist das Werk erschienen als: »Zur Psychophysik der industriellen Arbeit«, in: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. Band 27 (1908). S. 546–558, Band 28 (1909). S. 219–277 und S. 719–761. Als Referenz diente uns: »Max Weber: Zur Psychophysik der industriellen Arbeit, in: Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik. Herausgegeben von Marianne Weber. Tübingen 1924. S. 61–255.«
Zwecks Lesbarkeit auf allen gängigen E-Book-Readern – insbesondere älteren Modellen mit einer Auflösung von nur 600*800 Pixeln – haben wir in einzelnen Tabellen Wörter abgekürzt oder auch mehrere Tabellen aus einer gemacht. Falls einige Tabellen dennoch auf einem solchen Gerät bei Ihnen nicht vollständig auf den Bildschirm passen, können Sie in diesem Fall zum Betrachten der vollen Tabelle die Schriftart kleiner stellen. Das funktionierte bei allen von uns getesteten Readern.
Vorbemerkung
Bei den außerordentlichen Fortschritten der anthropologischen, physiologischen, experimentalpsychologischen, psychopathologischen Forschung erscheint es auf den ersten Blick überraschend, daß bisher der Versuch, Resultate dieser Disziplin mit der sozialwissenschaftlichen Analyse der wirtschaftlichen Arbeit in Beziehung zu setzen, nur in einigen Ansätzen (die später erwähnt werden) gemacht worden ist. Jeder Vorgang der Arbeitsteilung und Spezialisierung, insbesondere aber der Arbeitszerlegung innerhalb der modernen Großbetriebe, jede Änderung des Arbeitsprozesses überhaupt durch Neueinführung und Änderung von Arbeitswerkzeugen (Maschinen), jede Änderung der Arbeitszeit und der Arbeitspausen, jede Einführung oder Änderung eines Lohnsystems, welche die Prämiierung bestimmter qualitativer und quantitativer Arbeitsleistungen bezweckt, – jeder dieser Vorgänge bedeutet ja in jedem einzelnen Fall eine Veränderung der an den psychophysischen Apparat des Arbeitenden gestellten Ansprüche. Welche Erfolge eine jede solche Änderung erzielt, hängt also von den Bedingungen ab, unter denen jener Apparat funktioniert und bestimmte Leistungen hergibt. Wenn also z.B. das Verhältnis von Arbeitszeit, Arbeitslohn und Arbeitsleistung diskutiert oder sonst die Bedingungen und Wirkungen der Intensitätssteigerung der Arbeit erörtert werden, so spielen – neben verschiedenen anderen Dingen – doch stets auch jene grundlegenden Bedingungen der Arbeitsleistung hinein, deren Untersuchung zu den Aufgaben der erwähnten naturwissenschaftlichen Disziplinen gehört. Gleichwohl begnügen wir uns bei diesen Erörterungen innerhalb unserer Disziplin im allgemeinen mit, in der Fachsprache der Psychologen geredet: vulgärpsychologischen Erfahrungen und Erwägungen. Es könnte nun sein, daß dieser scheinbare Mangel für große Teile der Untersuchungen unserer Fachdisziplin seinen guten methodischen Grund hat: – worin dieser liegt, wird späterhin zur Sprache kommen. Allein hier stellen wir uns vorerst auf den, rein theoretisch, natürlich unanfechtbaren Standpunkt: es müßte, im Prinzip, möglich sein, auf Grund physiologischer, experimentalpsychologischer und vielleicht auch anthropologischer Erkenntnisse, auch Einsichten über die Voraussetzungen und Wirkungen der technischen und ökonomischen Veränderungen der Bedingungen industrieller Arbeit zu gewinnen.
Zweck der nachfolgenden Zeilen ist es nun: 1. die Schwierigkeiten verständlich zu machen, denen es zuzuschreiben ist, daß jene im Prinzip mögliche Zusammenarbeit der verschiedenen Disziplinen zur Zeit noch so gut wie nicht stattfindet, – 2. zu fragen, in welchem Sinn und Maße vielleicht in Zukunft eine solche Zusammenarbeit möglich werden könnte.
Es erscheint dabei unvermeidlich, zu diesem Behuf hier den Versuch zu machen, einen – gegenüber der ausgedehnten Literatur freilich sehr summarischen – Überblick über eine Anzahl von experimentellen Untersuchungen zu gewinnen, auf deren Resultate es für unsere Gesichtspunkte wesentlich ankommen würde. Wenn ein auf jenen Gebieten so vollkommener Laie wie ich dies Wagnis unternimmt, so geschieht dies natürlich in jeder Hinsicht cum beneficio inventarii und in der Erwartung, daß vielleicht gerade ein solcher Laienversuch mit den ihm notwendigerweise anhaftenden Mängeln den Fachmännern es erleichtern könnte, uns an denjenigen Punkten beizuspringen, an denen wir ihrer Hilfe am dringendsten bedürfen. An diesen Versuch muß sich dann die Frage schließen, ob und welche Verbindungslinien sich etwa zwischen den Untersuchungsmitteln der naturwissenschaftlichen Disziplinen zu denjenigen Mitteln, welche unsrer eigenen Facharbeit zu Gebote stehen, herstellen ließen, oder inwieweit die breite, heute hier klaffende Lücke als, sei es vorläufig, sei es dauernd, unausfüllbar anzusehen ist. Nur auf diese methodische Frage, nicht etwa auf den (wie sich leider zeigen wird, in fast jeder Hinsicht verfrühten) Versuch, schon jetzt irgendwelche Ergebnisse der naturwissenschaftlichen Disziplinen direkt für die sozialwissenschaftliche Analyse zu verwerten, läuft diese Darstellung hinaus. –
Besprochene Literatur
Für alle sozialwissenschaftlichen Probleme der modernen (speziell der großindustriellen) Arbeit müßten im Prinzip die physiologischen und psychologischen Bedingungen der Leistungsfähigkeit (für konkrete Arbeiten) den Ausgangspunkt der Betrachtung bilden. Gleichviel nun, worauf der Besitz oder Nichtbesitz einer Leistungsfähigkeit für bestimmte Arbeiten bei einem Individuum beruht: – ob also ererbte Anlage, Erziehung, Ernährung oder andere Lebensschicksale ausschlaggebend an ihrer Entwicklung beteiligt waren, – immer äußert sich diese seine Arbeitseignung praktisch in der Art der Arbeitsökonomie seines psychophysischen Apparats. Daher stehen für die nachstehende Kompilation im Mittelpunkt der schwer zu übersehenden experimentalpsychologischen Literatur die umfassenden, auf äußerst intensiver Denkarbeit und höchst sinnreichen und mühevollen, mehr als ein Jahrzehnt fortgesetzten, Experimenten ruhenden Arbeiten des ausgezeichneten Psychiaters E. Kraepelin und seiner Schüler über die psychophysischen Voraussetzungen und Wirkungen von Arbeitsleistungen. In seinem, die Publikation dieser Arbeiten einleitenden Artikel legt Kraepelin die Gesichtspunkte dar, unter denen er an seine Untersuchungen herantrat: Von der Aphasielehre her habe sich die Psychiatrie gewöhnt gehabt, die Seele monadologisch in eine Unzahl von spezifischen Mächten zu zersplittern und demgemäß psychische Leistungen anzusehen als Ergebnis von Majoritätsbeschlüssen des Unterhauses der Wahrnehmungen und des Oberhauses der Erinnerungsbilder. Es sei demgegenüber nötig, als entscheidend für den Ablauf psychophysischer Leistungen die physiologischen Grundqualitäten der Persönlichkeit anzusehen, welche die Art und Weise entscheiden, wie der einzelne die Reize, auf welche er reagiert, in sich verarbeitet. Auf die Ermittlung dieser Grundqualitäten des Arbeiters ist also die Untersuchung letztlich abgestellt, und, um diese zu ermitteln, muß von den möglichst einfachsten Grundkomponenten der Arbeitsleistung ausgegangen werden. Es liegt auf der Hand, wie sehr diese Fragestellung dem Interesse unserer Disziplin entgegenkommt. Im nachfolgenden wird daher durchweg von den Untersuchungen Kraepelins und seiner Schüler ausgegangen (insbesondere überall da, wo nicht im Text das Gegenteil ersichtlich gemacht ist). Andere Literatur ist nur ergänzend, insbesondere da, wo sie sich zu Kraepelin und seinen Schülern kritisch stellt, herangezogen.1 Was an nicht experimentalpsychologischen Arbeiten über Arbeitspsychologie und Physiologie sonst bereits existiert, bleibt vorläufig einmal beiseite. Wir stellen zunächst die wesentlichen Ergebnisse der Kraepelinschen und verwandter Arbeiten voran, um dann nach der Methodik zu fragen, die ihrer Herausarbeitung zugrunde liegt, und sie mit unseren eigenen methodischen Hilfsmitteln zu vergleichen.
Wenn man die Arbeitsleistungen eines kontinuierlich in bestimmter Art arbeitenden Menschen entweder direkt mittels geeigneter maschineller Vorrichtungen im Laboratorium oder aber durch Feststellung des Produktes nach Quantität und Qualität in möglichst kleinen Zeitintervallen mißt und das Ergebnis in ein Koordinatensystem als Leistungskurven einträgt, so zeigt diese Linie einen sehr unregelmäßigen, nicht nur auf den ersten Blick, sondern auch nach bereits ziemlich eingehendem Studium schwer erklärlichen Verlauf, an dem zuerst nur ein gewisses Maß von Ansteigen bei Beginn der täglichen Arbeitszeit, ein gewisses (aber sehr verschieden starkes und abgestuftes) Fallen gegen Ende hin gemeinsam scheint. Auf die Komponenten dieses Verlaufs der Arbeitskurve, die man sich gleichfalls einzeln als Kurven darstellbar denkt, beziehen sich nun die folgenden Begriffe:
1
Übersicht:
Kraepelin
selbst hat seine Auffassung 1. in der von ihm verfaßten Einleitung zu dem fünfbändigen Sammelwerk:
Psychologische Arbeiten, herausgegeben von E. Kraepelin
, 2. in der Festschrift für Wundt (Philosophische Studien XIX S. 475: auch als Heft separat:
Die Arbeitskurve
, 1902), 3. im Archiv für die gesamte Psychologie Bd. I niedergelegt. Wesentlich auf seinen Forschungen beruhen die betreffenden Abschnitte in den bekannten Werken von
Wundt
,
Ebbinghaus
u.a. Für die Leistungen des Muskels sind die einschlägigen Abschnitte in den physiologischen Kompendienwerken von
Munk
,
Thierfelder
, und für die Bewegungslehre namentlich R.
Du Bois Reymond
(Spezielle Muskelphysiologie und Bewegungslehre 1903, S. 210 ff.) zu benützen (vgl. auch in
Rankes
bekanntem Werke: Der Mensch, Bd. I, S. 476 ff., Bd. II. S. 163 ff.). Es ist das Verdienst des hübsch geschriebenen Aufsatzes von Derson (im 10. Bande der Zeitschrift f. Sozialwissenschaft), den Versuch systematischer Verwertung physiologischer Kenntnisse für sozial
theoretische
Zwecke zuerst gemacht zu haben, so skeptisch man vielem, was er sagt, gegenüberstehen mag. – Die nachstehende Kompilation ist, wie im Text gesagt, im wesentlichen eine zusammenfassende Besprechung der in dem genannten fünfbändigen Sammelwerk von Kraepelin herausgegebenen, im psychologischen Laboratorium der Heidelberger Irrenklinik ausgeführten Arbeiten seiner Schüler, kombiniert mit einiger anderer Literatur. Die schon in diesem Teile des Referats mit herangezogene differentialpsychologische und psycho-pathologische Literatur, namentlich auch diejenige zur Vererbungsfrage, wird besser zu dem zweiten Aufsatz angeführt. Hier sei nur zu den einzelnen Abschnitten des Textes noch auf folgende Arbeiten speziell hingewiesen: Ermüdung und Erholung:
Mosso
, Die Ermüdung, deutsch von Glinzer. Dazu Ph. L.
Bolton
, Kraepelins Arbeiten IV, S. 175 f. (speziell über die Methodik, auf welche im zweiten Aufsatz zurückzukommen ist). Ferner (für die Nachwirkungen geistiger und körperlicher Arbeit):
Bettmann
, Kraepelins Arbeiten I, S. 182;
Miesemer
, das. IV, S. 375 ff.
Trèves
, Le travail, la fatigue et l'effort. L'année psychologique XII (1906), S. 34 f. Für Muskelarbeit (Ergogramm-Untersuchungen)
Oseretzkowsky
, Kraepelins Arbeiten III, S. 507 ff.;
Yoteyko
, in l'Année psychologique V, 1899 (Alter und Ermüdungskurve:
Maggiora
, Arch. ital. di biol. 29, 1898);
Trèves
, ebenda. Arbeit ohne Ermüdung:
Broca
und
Richet
, Arch. de physiol. normale et patholog. 5 Sér. X, 1898. Polemik gegen den Kraepelinschen Ermüdungsbegriff bei:
Seashore
, Psychol. Bull. I, 1904, S. 87-101 (Bericht für die Versammlung der Amer. Psychol. Assoc. - Uebung: von älteren Arbeitern, bes.
Fechner
, Verh. d. Sächs. G. d. Wiss. (Math.-Phil. Kl.) IX (1857), S. 113; X (1858), S. 70. Wirkung der Uebung: Bolton, Gerson a.a.O.
Ebert
und
Meumann
, Archiv f. d. ges. Psychologie IV, 1904, dazu die Besprechung von D. E. Müller in der Ebbinghausschen Zeitschrift für Physiologie und Psychologie der Sinnesorgane 39, 1905. v.
Voß
(Schwankungen geistiger Arbeitsleistungen), Kraepelins Arbeiten II, S. 399 ff. - Reaktionstypen und Rhythmisierung:
Specht
, Archiv f. d. ges. Psychologie III, 1904;
Yerkes
(Variabilites of reaction times), Psychol. Bull. I, 1904, S. 137-146.
Tarchanoff
, Atti del XI Congr. medico internaz. di Roma (Wirkung der Musik), im übrigen das zum 2. Aufsatz zu zitierende Buch von W. Stern und die andere dort angegebene Literatur. - Mitübung:
Fechner
a.a.O. (1858),
Volkmann
, Verh. d. Sächs. Ges. d. Wiss. VIII (1856),
Washburn
, Philos. Stud. XI, 95. - Versuche über Übung mit Setzern: Aschaffenburg bei Kraepelin I, S. 611. (Über
Abbé
s. d. 2. Artikel.)
Ablenkung und Gewöhnung, Arbeitskombination:
Vogt
, Kraepelins Arbeiten III, S. 62 ff. – Arbeitswechsel:
Weygandt
, Kraepelins Arbeiten II, S. 118 ff. Kritik dieser Arbeit bei
Seashore
a.a.O. Über Lerntechnik und Lernökonomie: Christo Pentschew im Archiv f. d. ges. Psychologie I (1903). Über Übungsfestigkeit z.B.: Swift, Memory of shifted movements, Psychol. Bull. III (1906), S. 185–187. – Arbeitsunterbrechung, Pausenwirkung:
Hylan
und
Kraepelin
in Kraepelins Arbeiten IV, S. 454 ff.,
Oseretzkowsky
a.a.O.,
Heumann
, Kraepelins Arbeiten IV, S. 538 ff. Über die
methodische
Bedeutung der Pausenuntersuchungen: Kraepelin in dem oben unter Nr. 3 zitierten Aufsatz. Weitere Literatur zum zweiten Aufsatz.
Wertvolle Hinweise verdanke ich den Herren Dr. H. Gruhle in Heidelberg und Privatdozent Dr. W. Hellpach in Karlsruhe.
»Ermüdung« und »Erholung«.
Dem Grundbegriff der Ermüdung steht derjenige der Erholung gegenüber. Beide werden praktisch auf die Abnahme bzw. Wiederzunahme der Fähigkeit bezogen, konkrete Leistungen in gegebenen Zeiteinheiten zu wiederholen. Es wird angenommen, daß jene Abnahme der Leistungsfähigkeit, welche das Symptom der Ermüdung bildet, auf einem zwiefachen Grunde ruhe, nämlich: – 1. auf der direkten Hemmung der Leistung durch stetig zunehmende Anhäufung von Ermüdungsstoffen; 2. der Abnahme der (bzw. einiger) für die Leistungsfähigkeit unentbehrlicher Stoffe (Erschöpfung). Diese Hypothese dient zur Deutung des Verlaufs der Erholung. Für die Beseitigung jener direkten Hemmung genügen kurze, die Fortschaffung der Ermüdungsstoffe vermittels Durchspülung des betreffenden Organs mit frischem Blut ermöglichende, evtl. nur wenige Minuten dauernde Zwischenräume zwischen den Leistungen. Für die Beseitigung der Erschöpfung, die Herstellung also der physiologischen Anfangsqualitäten des Organs, sind dagegen längere, nach Kraepelin stets, auch bei kurzer Arbeit, über mehrere Stunden sich erstreckende Zeiträume erforderlich. Es steht, wie es scheint, physiologisch vorerst nicht endgültig fest, ob der Ermüdungsvorgang bei vorwiegend nicht muskulären Leistungen, insbesondere also bei Leistungen des nervösen Zentralapparates, jener von J. Ranke u.a. entwickelten chemischen Auffassung der Muskelermüdung unbedingt gleichartig ist. Jedenfalls aber scheint die Ermüdung in beiden Fällen in ihrem Effekt auf die Leistungsfähigkeit wesentlich gleichartig zu verlaufen. – Ermüdung ist im übrigen bekanntlich nicht nur die Folge von Arbeit im Sinn der Vollziehung irgendwelcher bewußten äußeren oder inneren Anstrengungen. Erfahrungsgemäß ist vielmehr ausreichender Schlaf als Mittel für die Beseitigung derjenigen allgemeinen Ermüdung, welche durch den Kräfteverbrauch des bloßen wachen Lebensprozesses als solchen, gleichviel ob die Wachezeit in Arbeit oder in absoluter Ruhe zugebracht wird, entsteht, stets schlechthin unersetzlich.
Von der Ermüdung durch Arbeit wird nun, offenbar behufs leichterer Anpassung an gewisse naturwissenschaftliche Grundhypothesen, angenommen und empirisch wahrscheinlich zu machen gesucht, daß sie mit dem ersten Moment des Beginns der Arbeit einsetze und – sofern nicht durch Pausen eine Erholung herbeigeführt werde, – unaufhörlich fortschreite, genau entsprechend dem Kräfteverbrauch, welcher seinerseits der wirklichen Arbeitsleistung parallel gehe. Soweit der Ablauf der Arbeitsleistung dem Anscheine nach dieser Hypothese widerspricht, wird dies auf die Einwirkung bestimmter anderer, weiterhin zu besprechender, ursächlicher Komponenten des äußeren Hergangs zurückgeführt. Insbesondere wird deshalb streng geschieden von der objektiven, d.h. auf materiellen Stoffverbrauch- und Stoffersatzvorgängen ruhenden Ermüdung das subjektive Gefühl der Müdigkeit, dessen psychisches Wesen, Entstehung und Verlauf ein (ziemlich komplexes) Problem der Psychologie ist. So gewiß diese Gefühlslage in einem gewissen durchschnittlichen Zusammenhang mit jenen physiologischen Tatbeständen zu stehen pflegt und so wünschenswert, hygienisch gewertet, das Bestehen des normalen Maßes von Parallelismus beider ist, so häufig fallen doch im Einzelfall beide auseinander, weil – von pathologischen Abnormitäten ganz abgesehen – die subjektive Müdigkeit auch Funktion zahlreicher außerhalb der wirklichen Leistung selbst liegender Bedingungen, darunter namentlich auch des psychischen Sichverhaltens zu der geforderten Arbeitsleistung, namentlich des Maßes des Arbeitsinteresses, ist. Diese psychisch bedingte Müdigkeit läßt nun zwar die effektive Arbeitsleistung keineswegs unberührt (sie wirkt auf gewisse weiter unten zu besprechende Komponenten ein, welche Kraepelin als Anregung und Willensantrieb bezeichnet) und sie kann auf die Dauer wohl zweifellos einen allgemeinen ungünstigen, schließlich auch physisch sich äußernden Gesamthabitus hervorrufen. Dagegen ihr direkter Einfluß, und damit auch der direkte Einfluß solcher Momente, wie: Arbeitsfreude, Stimmung usw. auf die Leistungsfähigkeit wird, gegenüber jenem physiologischen Tatbestand der Ermüdung, von Kraepelin und seinen Schülern (und auch von andern Psychologen) ganz wesentlich geringer eingeschätzt, als dies heute zuweilen geschieht. Solche Momente beeinflussen also, von pathologischen Hemmungsvorgängen abgesehen, wesentlich die Arbeitsneigung, nicht: die objektive Arbeitseignung. Trotz großer Arbeitsunlust und subjektiver Müdigkeit wurden nicht nur gleiche, sondern sogar (infolge der Übung) steigende Leistungen erzielt. Die Leistungsfähigkeit (soweit sie als abhängig von der objektiven Ermüdbarkeit zu denken ist) gilt darnach als etwas psychologischnicht Kennzeichnendes und also – darf hinzugefügt werden – auch nicht psychisch Bedingtes, – eine für die Kraepelinsche Schule charakteristische Auffassung, welche sicherlich noch zu manchen prinzipiellen Auseinandersetzungen führen wird.
Natürlich gilt dauernde erhebliche Diskrepanz zwischen subjektiver Müdigkeit und objektiver Ermüdung als ein, die Kontrolle über die Kräfteökonomie und damit die organische Selbststeuerung der Arbeit empfindlich beeinträchtigendes, daher indirekt auch die dauernde Leistungsfähigkeit gefährdendes Moment.
Die Arbeitsermüdung, mit welcher wir hier allein zu tun haben, ist stets Folge konkreter Leistungen. Auf rein muskulärem Gebiet bedeutet dies: daß sie die Folge der Inanspruchnahme bestimmter einzelner Muskeln oder Muskelgruppen ist. Aber ihre Wirkung ist dennoch nicht rein lokal. Ermüdung nur eines Muskels ist, wie es scheint, selbst im Wege des Experiments vermittels eigens dazu eingerichteter Apparate, – z.B. des Mossoschen Ergographen – nicht zu erzielen, weil, physiologisch betrachtet, nie mit nur einem Muskel agiert wird. Stets ist vielmehr die Arbeitsleistung Resultante einer Reihe, sozusagen, übereinander gelagerter Wirkungen verschiedener Muskelgruppen, und namentlich sind sehr häufig, speziell im Falle der Ausschaltung oder der Erschöpfung eines oder einiger von diesen, andere Gruppen vorhanden, welche in die betreffenden Funktionen einspringen können. Vor allen Dingen aber haben bei allen Leistungen ein ganzer Apparat von peripherischen motorischen Endorganen, Nervenleitungen und, vor allem, das nervöse Zentralorgan zusammen zu wirken. Und wenn von den Nerven bestritten zu sein scheint, in welchem Sinne sie überhaupt oder wenigstens: im Verlauf welcher Zeiten sie durch Inanspruchnahme ermüden können, so ist dies bei dem Gehirn, auch bei körperlicher Arbeit, unzweifelhaft innerhalb normaler Tagesleistungen der Fall. In der Theorie wäre also peripherische Ermüdung (Muskel und motorische Endapparate) und zentrale Ermüdung zu scheiden. Schon die durch die Kräfteökonomie des Muskels selbst bedingte Ermüdung desselben folgt nun aber, für sich allein (vermittels der Zuckungsexperimente) betrachtet, ziemlich verwickelten Gesetzen (z.B.: Änderung wesentlich der Intensität, nicht der Quantität, der in Betracht kommenden Stoffwechselvorgänge, zunehmende Trägheit des Oxydationsprozesses ohne wesentliche Abnahme der Menge der oxydierten Stoffe, nach Volkmann). Durch die Kombination mit den Zentralvorgängen und durch die Änderung der Lage und Spannung des Muskels im Verlauf seiner Inanspruchnahme kompliziert sich die kausale Analyse noch weiter. Und da beide in der Praxis, z.B. in den Kurven der Ergogramme ungeschieden vereint sind, begegnet die gesonderte Messung beider Komponenten natürlich den größten Schwierigkeiten. Wie dem nun sei, jedenfalls ist anerkannt, daß auch körperliche Ermüdung nicht nur über die konkret ermüdende Einzelleistung, sondern auch über diejenige Funktion des psychophysischen Apparates, welche durch jene Einzelleistung in Anspruch genommen wurde, hinausgreift. Sie ist also mindestens insoweit eine nicht rein lokale, sondern generelle psychophysische Zuständlichkeit (oder wird dies doch bei hinlänglich fortgesetzter Inanspruchnahme des Organismus). Von der geistigen Ermüdung nimmt Kraepelin, welcher auf dem Gebiet der Körperleistungen partielle Ermüdbarkeit des Organismus ziemlich weitgehend anerkennt, unbedingt an, daß sie ein für allemal eine generelle sei. Vielleicht geht er darin zu weit (s.u.), jedenfalls aber ermüdet geistiges Arbeiten bestimmter Art das Zentralorgan auch für andere geistige Leistungen, als diejenige, deren anhaltender Vollzug die Ermüdung herbeiführte. Ferner aber ermüdet starke körperliche Arbeit in gewissem Maße auch für geistige Leistungen, – ein Effekt, der experimentell festgestellt zu sein scheint, wennschon er, wie auch die Alltagserfahrung lehrt, zeitweise durch die psychomotorische Erregung, welche körperliche Leistungen zu hinterlassen pflegen, sowohl subjektiv als in der Kurve der objektiven Leistung verdeckt werden kann. Es scheint weiter, daß umgekehrt auch körperliche Leistungsfähigkeit durch voraufgehende intellektuelle Anstrengung gehemmt wird, obschon die Tragweite bestritten und vielleicht, je nach dem (sensorischen oder motorischen) Charakter der Leistung verschieden ist. Daß z.B., wie Hylan zur Erklärung gewisser experimentell gewonnener Ergebnisse als möglich annahm, die vorangegangene physische Arbeit ihre Ermüdungswirkung stärker auf die Gedächtnisleistung, ihre Erregungswirkung stärker auf die Leichtigkeit der Reaktion bei einer nachfolgenden geistigen Leistung wirken läßt, scheint an sich plausibel, wenn auch wohl noch nicht erwiesen. Und endlich ermüdet auch eine spezifisch körperliche Leistung, wenigstens bei hinlänglich starkem Fortschritt der Ermüdung, für andere, und zwar wie es scheint, unter Umständen auch für ganz heterogene Leistungen ganz anderer Muskeln. Man wird a priori geneigt sein anzunehmen, daß in allen diesen Fällen die Ermüdung der nicht direkt ermüdeten, sondern nur mitermüdeten Leistungsfähigkeiten eine geringere sei, als wenn sie unmittelbar in Anspruch genommen werden, ebenso, daß durch eine bestimmte Arbeit die Fähigkeiten zur Leistung anderer Arbeiten, je nach der Beschaffenheit beider, möglicherweise verschieden stark mitermüdet werden. Es läge namentlich die Annahme nahe, daß, speziell auf geistigem Gebiete, Leistungen, welche ihrer Art nach psychophysisch miteinander näher verwandt seien, von der Mitermüdung durch angestrengte Ausübung einer von ihnen stärker, heterogenere Leistungen dagegen weniger mitbetroffen würden. Indessen die weiter unten, bei Erörterung des Arbeitswechsels, zu besprechenden Erfahrungen scheinen diese Voraussetzung nicht zu bestätigen, oder doch jedenfalls der Aufstellung eines allgemeingültigen Satzes dieser Art eher ungünstig als günstig zu sein. Es ist dabei auch zu erwägen, daß die Frage einer näheren oder entfernteren Verwandtschaft verschiedener Leistungen untereinander, von welcher ebenfalls (bei Erörterung der Arbeitskombination) noch zu reden sein wird, nicht so ganz einfach zu entscheiden ist, und daß, falls für die Mitermüdung überhaupt irgendwelche Verwandtschaftsgrade der Leistungen mit in Betracht kämen (was z.B. von Kraepelin bestritten wird), wohl jedenfalls nicht der rein psychologische, sondern der physiologische Charakter der Leistungen ausschlaggebend sein würde, daneben vielleicht eine Reihe bisher ganz unbekannter Umstände. Vorerst scheint nur das eine sicher zu sein: daß die Ermüdung durch Arbeit zwar stets, auch bei reinkörperlichen Leistungen, über den Bereich der unmittelbar beanspruchten Funktion des Organismus hinausgeht, schon weil stets das Zentralnervensystem mitbeteiligt ist, – daß dies aber um so höher in höherem Grade der Fall ist, je mehr eine Leistung geistigen Charakters ist, das heißt: vornehmlich Funktionen des Zentralnervensystems in Anspruch nimmt.
Maß und Tempo der objektiven Ermüdung, wäre theoretisch betrachtet, direkt durch die Abnahme der Leistung, unter den erforderlichen Kautelen zur Ausschaltung von Nebeneinflüssen, meßbar, Maß und Tempo der Erholung durch den Vergleich der Leistungsfähigkeit nach einer eingeschalteten Pause bei Feststellung des zu Beginn der Pause eingetretenen Ermüdungsgrades, unter den gleichen Kautelen. In Wahrheit stellt aber schon die Messung des Einflusses, den die Ermüdung – in Kraepelins Sinn des Wortes – auf den Verlauf der wirklichen Arbeitskurve ausübt, wegen der Fülle von Komponenten, welche in ganz verschiedener Art deren Gestalt beeinflussen, ein ungemein schwieriges Problem dar, dessen Lösungsversuch durch Kraepelin, trotzdem er auf der Arbeit eines Jahrzehnts beruht, doch nach seiner eigenen Ansicht im einzelnen noch stark hypothetisch geblieben ist. Soweit eine einigermaßen plausible Herausschälung des Verlaufs der Ermüdung gelingt – auf welchem Wege? davon später – soll, nach Kraepelins Ansicht, es wahrscheinlich gemacht sein, daß sie zwar je nach der variierenden Tages-Disposition einer Person erheblich variiert, dennoch aber bei ein und demselben Menschen ein bedeutendes Maß von Konstanz der Rhythmik aufweist. Von der hiernach in Maß und Tempo bestimmbaren Ermüdbarkeit eines Individuums und ebenso von seiner Erholbarkeit nimmt Kraepelin an, daß sie nicht nur für konkrete Leistungen, sondern regelmäßig für Leistungen jeder Art, im wesentlichen in gleichem Maße bei ihm vorhanden seien, daß sie ferner zwar durch Übung (s.u.) erheblich modifizierbar seien, aber in ihrem Grundbestande doch der konkreten Persönlichkeit als solcher dauernd generell charakteristische Eigenarten darstellten, die also an einer (beliebigen) Leistung desselben gemessen werden könnten. Die Erholbarkeit soll dabei u.a. mit der Schlaffestigkeit des Individuums meist proportional gehen. – Dieser Standpunkt Kraepelins ist namentlich von amerikanischen Psychologen (Seashore) angefochten und behauptet worden, daß Ermüdung weder etwas Homogenes, noch etwas Generelles sei, daß vielmehr Art und Umfang der Ermüdung durchaus von Art und Grad der ermüdenden Arbeit abhänge, die Ermüdbarkeit einer Person also nicht eine am Verlauf einzelner Arbeitskurven meßbare einheitliche Qualität sei. Der Nichtfachmann wird hier nicht urteilen können, – für die Wirkungen geistiger und körperlicher Arbeit aufeinander könnten auch einzelne Resultate von Arbeiten aus Kraepelins Schule einen von dem seinigen abweichenden Standpunkt nahelegen. Inwieweit übrigens mit Kraepelins Standpunkt zur Sache zugleich statuiert sein würde, daß jene von ihm angenommene Grundqualitäten durchweg angeboren, und – was damit nicht identisch – ererbt seien, steht natürlich dahin. Dauernde allgemeine Dispositionen kann man ja auch erwerben; von der Akquisition erhöhter Ermüdbarkeit durch Krankheit und andere Schädlichkeiten, insbesondere alkoholischer und sexueller Provenienz abgesehen, ist sicherlich das ganze Jugendschicksal, darunter wohl auch die Art der Ernährung, von Einfluß, z.B. nach neueren Behauptungen die Länge der Stillungszeit der Säuglinge auf das Maß der später von ihnen erreichten körperlichen und, wie gelegentlich nachzuweisen versucht worden ist, auch geistigen Leistungsfähigkeit.
»Übung«
(»Mechanisierung«, Rhythmisierung, Summation und Ausnutzung der »Reiznachwirkungen«, »Leistungsverschiebung«; »Übungsfähigkeit« und »Übungsfestigkeit«; »Mitübung« und »Vorübung«).
Ein weiterer Grundbegriff ist derjenige der Übung. Sie bedeutet: Steigerung der Leichtigkeit, Schnelligkeit, Sicherheit und Gleichmäßigkeit einer bestimmten Leistung durch deren oftmalige Wiederholung. Die Übung in diesem Sinn ist nun schon bei einfachen, das heißt: praktisch nicht weiter zerlegbaren Leistungen ein komplexer Vorgang, bei welchem eine Reihe von Einzelursachen zusammenwirken, um jene Verbesserung der Kräfteökonomie zu erreichen, welche das Wesen des Übungsvorgangs ausmacht.1 Sein Effekt ist: sparsamere und erfolgreichere Ausnutzung des Kräftevorrats und der Kraftkapazität des gegebenen psychophysischen Apparats, also Erzielung einer (absolut) zunehmenden Leistung unter Aufwendung (mindestens: relativ) abnehmender Kräftequanta. Diese Kräfteökonomie wird nun vor allem bewirkt durch Ausschaltung oder Beschränkung der Inanspruchnahme aller der Teile des psychophysischen Apparates, welche für die konkrete Leistung entbehrlich sind. Körperlicher und geistiger Arbeit gemeinsam ist in dieser Hinsicht vor allem der Vorgang der Mechanisierung, Automatisierung möglichst vieler, anfänglich in allen ihren Einzelheiten durch gesondert bewußtwerdenden Willensimpuls und unter konstanter Inanspruchnahme der Aufmerksamkeit vollzogenen Bestandteile der Leistung. Das heißt also: mit häufiger Wiederholung einer Leistung stellt sich allmählich die Fähigkeit ein, sie auch ohne jene bewußte Inanspruchnahme des Willens und der Aufmerksamkeit für die erforderlichen Einzelfunktionen des psychophysischen Apparates, schließlich sogar besser ohne Hinlenkung der Aufmerksamkeit auf sie, zu vollziehen. Abgesehen davon, daß dieser, aus der Alltagserfahrung ja genugsam bekannte Vorgang den bewußten Willen und die Aufmerksamkeit für anderweitige Inanspruchnahme disponibel macht, und daß er daher insbesondere die unentbehrliche Grundlage aller kombinierten und komplizierten Leistungen ist, bedeutet er vermutlich auch ganz direkt eine Kraftersparnis durch Entlastung des nervösen Zentralorgans. Die Mechanisierung scheint nun in hohem Grade durch Rhythmisierung der Arbeit gefördert zu werden, weil diese die Hervorbringung der typischen Reaktionen ohne artikulierten Willensimpuls wesentlich erleichtert, und zwar sowohl bei körperlichen als bei geistigen Leistungen. Die Zusammenhänge von physischer Arbeit und Rhythmus hat Bücher in seinem bekannten schönen Buch kulturgeschichtlich beleuchtet. Für die psychophysische Analyse kommt nun aber wesentlich in Betracht, daß die einzelnen Individuen sich 1. in dem Grade ihrer Beeinflußbarbeit durch Rhythmen ziemlich verschieden zu verhalten scheinen: wesentlich muskulär (s.u.) reagierende Personen werden von Änderungen eines die Arbeit begleitenden Rhythmus nach den Beobachtungen von Specht unbewußt sehr stark beeinflußt, sensorielle Reaktionstypen dagegen unter Umständen gar nicht. Ferner aber scheint es 2. ein unter Umständen erheblicher Unterschied zu sein, ob der Rhythmus dem Arbeitenden von außen aufgenötigt wird, oder aber ein ihm, nach den individuellen Strukturverhältnissen seines psychophysischen Apparates, adäquates Tempo hat. Awranoff nimmt zur Erklärung dessen an, daß die Rhythmisierung der Arbeit ihren Erfolg wesentlich der Anpassung an die natürlichen Willens- und Aufmerksamkeitsoszillationen (s.u.) verdankt. Jedenfalls ist die Bedeutung dieser individuellen Differenzen wohlverschieden je nach der Art der Leistung und des Rhythmus. Es scheint durchaus glaublich, daß es zahlreiche einfache Leistungen und zu ihnen gehörige Rhythmen: z.B. Marschrhythmen u. dgl. gibt, an welche sich die große Mehrzahl der Menschen leicht anpaßt. Dagegen ist andererseits auch die Behauptung plausibel, daß bei differenzierten und komplizierten Arbeiten der einzelne auf verschiedene Rhythmen sehr verschieden reagiert. Gerade bei kombinierten Leistungen ist die Rhythmisierung als Mittel der Gewöhnung (s.u.), und zwar insbesondere, um die – wie später zu erörtern sein wird, für den Vollzug komplizierter Leistungen sehr wichtige – Möglichkeit zu gewinnen, die einzelnen miteinander kombinierten Teilleistungen gegenseitig in ihre kleinsten, unmerklichen Pausen hineinzupassen, anscheinend von Wichtigkeit.
Die Mechanisierung der Leistung scheint ferner, wenn auch nicht immer, so doch häufig, und zwar gerade da, wo sie den höchsten Grad erreicht, mit einer Umgestaltung des Reaktionsablaufes Hand in Hand zu gehen, welche, physiologisch gesprochen, die Ausnutzung der »Reiznachwirkungen« durch Summation ermöglicht. Der Vorgang findet, scheint es, bei allen Arten von Arbeit statt. Auf dem Gebiet der Muskelinanspruchnahme bedeutet er in einfachster Form: daß, durch Beschleunigung des Aufeinanderfolgens der einzelnen Reize, derjenige Reiz, welcher die folgende Muskelzuckung hervorruft, vor dem vollen Ablauf der voraufgehenden Zuckung wirksam wird, womöglich im Moment der Maximalhöhe der ersten Zuckung oder sogar schon vor ihrem Beginn (im sog. Latenz zustande des ersten Reizes). Ist dies letztere der Fall, so kann die starke, stets mehr als proportionale Mehranstrengung, welche eine so starke Beschleunigung der Leistung erfordert, dennoch mehr als aufgewogen werden durch den Effekt der Superposition der Reize. Das heißt praktisch: eine Summe kleiner, unter Umständen unmerklicher, und daher nicht artikuliert zum Bewußtsein gelangender Reize kann dann eine summierte, kontinuierliche Wirkung ausüben, welche selbst von (summiert gedacht) wesentlich stärkeren Reizen, wenn sie in größeren Zeitintervallen erfolgen, nicht erreicht werden könnte, weil im ersten Falle weit weniger von den Wirkungen der Einzelreize ungenutzt verloren geht als in letzteren. Solche tetanus-(krampf-)artigen Muskelzustände, – deren arbeitsökonomische Wirkung man, wie es scheint, auch am Ergographen bei großer Beschleunigung des Tempos an den Arbeitskurven beobachten kann, – scheinen nun auf dem Gebiet des vorwiegend nicht muskulären, geistigen Arbeitens eine Parallele zu finden in der Ausnutzung des ebenfalls krampfartigen Erregungszustandes, welcher bei größtmöglichster Beschleunigung z.B. des Zahlenaddierens entsteht, überhaupt aber in dem Ablauf, welchen der Vollzug sehr einfacher Arbeitsverrichtung bei sehr hohem Grade der Übung nimmt. Die Arbeitsleistung wird dann in hohem Maße stetig: die Leistung scheint von einer kontinuierlichen Anspannung getragen: – v. Voß beobachtete, daß diese Gleichmäßigkeit als Folge der Übung sowohl (und namentlich) auf Kosten der langsamsten, als auch auf Kosten der allerschnellsten Reaktionen, die bei unstetigerer Arbeit vorkommen, entsteht. – Daß sie in Wahrheit auch dann von lauter einzelnen, stoßweise sich folgenden, Willensimpulsen hervorgebracht wird, kommt bei der großen Schnelligkeit, mit welcher diese aufeinanderfolgen, nicht zum Bewußtsein. Ebenso nicht, daß die kontinuierliche Aufmerksamkeit in Wahrheit aus einer Serie von stets neuen Impulsen zur Einstellung auf diese konkrete Leistung besteht. Beides läßt sich aber, scheint es, experimentell wahrscheinlich machen, und gewisse im Experiment nachweisbare, kleine Oszillationen, welche sowohl die Willensspannung, als die Aufmerksamkeit bei hoch geübten und möglichst einfachen Arbeiten zeigen, scheinen zu ergeben, daß dabei eine Art von Rhythmisierung des Stärkegrades der einzelnen Willens- und Aufmerksamkeitsimpulse sich entwickelt.2 Die arbeitsökonomische Zweckmäßigkeit der Arbeitszerlegung beruht, wie angenommen wird, zum nicht geringen Teil auch darauf, daß bei den einfachsten Leistungen jene krampfartige Ausnutzung der Reiznachwirkungen und ihrer Superposition die vollständigste sein kann, vollständiger als bei Leistungen, von denen jede eines anders gerichteten Impulses bedarf, und daher jede, infolge der Verlangsamung durch die erforderliche Einschaltung anders gerichteter Reize und Reaktionen, Verluste an Ausnutzung der Reiznachwirkungen erleiden muß.
Mit diesen Vorgängen gehen nun bei der Übung eine Reihe von anderen Prozessen parallel, welche gleichfalls der Kräfteökonomie des psychophysischen Apparates dienen. So zunächst bei der Übung der für eine bestimmte Reaktion verwendeten Muskeln. Schon an sich ist der Muskel – nach Munks Ausdruck – die vollendetste Dynamomaschine, die wir kennen, weil er unter Umständen bis zu 40% von den chemischen Spannkräften der verbrauchten Stoffe in Arbeitsleistung umzusetzen vermag (während der als unbenutzte Wärme entweichende Bruchteil bekanntlich bei jeder Maschine bis 9/10 und mehr beträgt). Die fortschreitende Übung bedeutet nun die stets fortschreitende Reduktion der ohne Nutzen für die betreffende Leistung verbrauchten Spannkräfte, oder, anders ausgedrückt, die stete Verbesserung des Verhältnisses zwischen physiologischer (Arbeits-)Leistung zur physikalischen (Energie-)Leistung. Dies geschieht vor allem durch die möglichste Beschränkung der Bewegung 1. auf die an der betreffenden Arbeit direkt mitbeteiligten Muskeln: Ausschaltung der im Anfang der Übung massenhaft auftretenden unwillkürlichen Mitbewegung anderer, für die Leistung entbehrlicher, Muskeln, welche ja das äußerlich charakteristische Symptom der Ungeschicklichkeit und, vor allem, eine Verletzung der Kräfteökonomie ist, 2. auf diejenigen unter den, nicht selten, mehreren möglichen Muskeln, welche die betreffende Arbeit unter dem kleinstmöglichen Kräfteaufwande vollbringen können. Ob bei diesen Vorgängen ferner auch eine allmähliche Beseitigung irgendwelcher gegenseitiger innerer physischer Hemmungen des möglichst freien Spiels der Muskeln durch diese selbst untereinander wirksam wird, scheint vorerst seitens der Fachmänner nicht entschieden zu sein. – Von den beiden erwähnten Richtungen, in welchen bei der Übung die Kräfteökonomie fortschreitet, ist nun die Verschiebung der Leistung auf diejenigen Muskeln, welche den geringsten Kräfteaufwand erfordern, die prinzipiell interessanteste. Über sie hat neuerdings – soviel ich sehe, unter dem Gesichtspunkt der Arbeitsökonomie zuerst – Gerson in einem geistreich geschriebenen Essay ansprechende, teilweise auch der Laienerfahrung entsprechende, natürlich aber in allem einzelnen und in ihrer Tragweite nur durch den physiologischen Fachmann nachprüfbare Theorien entwickelt. – Die Mechanisierung und Beschleunigung, welche Bedingungen der Kräfteersparnis sind, sollen darnach ihr Maximum bei solchen Bewegungen erreichen, die von kleineren Muskeln ausgeführt werden, deren Reizschwelle3 niedrig sei und deren Kraftverausgabung bei der einzelnen Zuckung leicht unterhalb der Bewußtseinsschwelle bleibe. Von den Bewegungen der größeren Muskeln erfordere dagegen im allgemeinen jede einzelne einen starken Reiz, um überhaupt in Betrieb zu kommen (hohe Reizschwelle). Es erfolge ferner sowohl die Wirkung des Reizes als der Ablauf der Reaktionen bei den großen Muskeln so langsam, und es stelle jede Einzelbewegung einen so bedeutenden Kraftaufwand dar, daß sie schwerer automatisiert werde (z.B. die Bewegungen etwa des Schmiedes oder des Ruderers; anders steht es mit den Gangbewegungen, solange die Gangart nicht besonders anstrengend ist), als dies bei Bewegungen kleinerer Muskeln (z.B. Schreibbewegungen usw.) gelinge. Die Verschiebung möglichst aller Leistungen, welche ein bestimmter Arbeitszweck erheischt, auf die möglichst kleinsten Muskeln, namentlich die Muskeln der Hand, und die Entlastung der größeren Muskeln bedeute daher, selbst wenn der von den kleinen Muskeln insgesamt für einen Arbeitszweck zu leistende Kraftaufwand nicht geringer ist, als ihn (für den gleichen Zweck) die großen zu leisten hätten, dennoch eine vollständigere Ausnutzung der umgesetzten Spannkräfte, weil die Ausnutzung der Reizwirkungen und die Mechanisierung dabei vollständiger sein könne. – Daß die modernen Maschinen, im großen und ganzen, die Entlastung speziell der großen Muskeln zu Lasten der kleinen besorgt haben, wird nicht bestritten werden können. Es wäre durchaus fruchtbar, die Entwicklung der Technik unter diesem Gesichtspunkt eingehender zu analysieren, so wenig es natürlich angeht, die ganze Kulturgeschichte oder auch nur die ganze Geschichte der Technik sozusagen aus einem Prinzip des kleinsten Muskels erklären zu wollen. Noch mehr der näheren Untersuchung bedürftig erscheint, inwieweit diese, wohl innerhalb gewisser, a priori nicht sicher feststellbarer, Grenzen, für die Kulturgeschichte zutreffende Entwickelung auch für die individuellen Übungsvorgänge eine Rolle spielt. Soweit überhaupt die Möglichkeit einer annähernd gleichwertigen Verwendung verschiedener Muskelgruppen zu der gleichen Arbeitsverrichtung besteht (wo und wie oft dies überhaupt der Fall ist, könnte nur die Einzelanalyse der Fachmänner zeigen), da wird auf die Dauer zweifellos die möglichste Ausschaltung aller übrigen mit Ausnahme des unter der größten Kraftersparnis verwendbaren Muskels stattfinden. In vielen Fällen wird dies vermutlich zugleich der möglichst kleinste Muskel sein. Ob immer, könnte nur fachmännische Untersuchung entscheiden. Jedenfalls findet nicht selten, – so in der Arm- und Handmuskulatur – im Wege der Übung in Wahrheit eine Verschiebung in den für eine Leistung aufgewendeten Mitteln statt.
Eine solche Verschiebung in der Art der Leistungsmittel findet sich nun, in charakteristischer Weise, auch auf dem Gebiet des geistigen Arbeitens. In nicht wenigen Fällen kann eine und dieselbe Leistung mit sehr verschiedenen Mitteln vollzogen werden. Man pflegt z.B. die Art des Gedächtnisses zu unterscheiden, je nachdem die Einprägung etwa von Zahlen- oder Silbengruppen unter Benutzung visueller Mittel (Gesichtsbilder der Zahlen bzw. Silben) oder akustisch (Gehörsbilder: man hört sich innerlich sprechen) oder aber motorisch (man fühlt sich innerlich flüstern) erfolgt, bzw., da sehr oft nur von einem Überwiegen des einen Mittels über das andere die Rede sein kann: je nachdem vorwiegend das eine oder das andere von ihnen sich im Betrieb befindet. Kraepelin wollte darnach überhaupt Erlernung (sensorische Einprägung) von Übung (motorische Einschulung) grundsätzlich scheiden (denen beiden, wie er andeutete, vielleicht die assoziative Übung als dritter Typ zuzugesellen sei). Praktisch scheint bei Gedächtnisleistungen meist nur ein mehr visueller und ein mehr akustisch-motorischer Typ leicht unterscheidbar: das bekannteste und oft angeführte Beispiel waren die beiden Rechenkünstler Inaudi und Diamandi, von denen der letztere nur mit Gesichtsbildern, der erstere (bis zum 20. Jahre Analphabet) rein akustisch-motorischsich die Zahlengruppen einprägte. Es handelt sich hier um Anschauungstypen, die zwar in einem gewissen, oft vielleicht hohen Maße, auf angeborener Anlage ruhen, andererseits aber auch, – wie Henry betont hat, – in ziemlich erheblichem Maße durch die faktisch einmal eingeschlagene Richtung der Übung ausgeprägt und oft geradezu geschaffen werden. Die Zugehörigkeit zum einen oder anderen Typus und vor allem die, bei der Mehrzahl der Individuen in irgendeinem Grade vorhandenen Möglichkeit, zwischen der Art der Auffassung zu wechseln, ist, wie später zu erörtern, für die Möglichkeit der Kombination mehrerer Teilleistungen miteinander vermutlich ziemlich wichtig. In ähnlicher Art pflegt man auch Reaktionstypen zu unterscheiden, je nachdem bei dem Ablauf der Reaktion auf einen Reiz die Aufmerksamkeit vornehmlich auf den Reiz oder auf die auszuführende Bewegung gerichtet ist: sensorielle oder motorische Reaktionsweise vorherrscht. Man hat (Baldwin) diese Gegensätze mit den Anschauungs- und Sprachtypen kombinieren und, da man auf Grund einiger Beobachtungen annahm, daß die Reaktion bei sensorischem Ablauf langsamer erfolge, deren Zeitdauer für das entscheidende Merkmal der Eigenart eines jeden Individuums hinstellen wollen. In der Tat hängt jener Gegensatz der Reaktionsweise, obwohl auch er in der Mehrzahl der Fälle relativ ist, anscheinend oft mit praktisch weitgehenden Unterschieden der Persönlichkeiten (der Temperamente) zusammen. Die größere Fähigkeit zur Kritik z.B. pflegt, bei gleichzeitig größerer Passivität, den sensorischen, die größere Promptheit und Aktivität, Vielseitigkeit, den motorischen Typ auszuzeichnen. Allein schon der Umstand, daß sensorische Sprachtypen bestimmter Art (auditive) häufiger sind als sensorische Reaktionstypen, scheint es auszuschließen, daß man einfach sensorische und motorische Persönlichkeiten scheidet. Auch Anschauungstypen und Reaktionstypen decken sich nicht. Und ebenso glaubt Flournoy gezeigt zu haben, daß die sensorische Reaktionsweise zwar häufig, aber nicht immer, die langsamere sei, – eine Behauptung, die von anderer Seite als durch die stets nur relative Reinheit der Typen (Übergangstypen: Götz-Martius) veranlaßt angesehen wird. Es scheint immerhin möglich, daß zahlreiche Individuen gerade darnach klassifiziert werden könnten: welche von beiden Reaktionsarten bei ihnen schneller und leichter abläuft, daß es ferner auch Individuen gibt, die keinen von beiden Typen angehören oder die sich zu beiden indifferent verhalten, das heißt: bei denen die Reaktion gleich schnell abläuft, mögen sie nun ihre Aufmerksamkeit dem Reiz, der Reaktion oder keinem von beiden vorwiegend zuwenden. Gleichwohl bleibt in sehr vielen Fällen der Unterschied der einem Individuum gewohnten Reaktionsweise, ebenso die Art seines Anschauungstyps und vor allem: die größere oder geringere Fähigkeit, mit der Art der Benutzung seines psychophysischen Apparates in diesen Hinsichten zu wechseln, eine wichtige Komponente seiner Leistungsfähigkeit, und zwar speziell seiner Fähigkeit, kombinierte Leistungen zu vollbringen. Es zeigt sich nun, daß durch die Übung nicht selten bei einer und derselben Person ein Wandel in diesen Verhältnissen eintritt, namentlich dann, wenn die Übung in besonders starkem Maße auf die steigende Schnelligkeit der Leistung abgestellt wird. Es findet sich dann namentlich oft, daß der Übende unvermerkt von der sensorischen zur motorischen Übung übergeht, um auf diese Weise die Beschleunigung und Mechanisierung der Leistung zu erleichtern. Denn wenn auch, wie gesagt, in Abrede gestellt wird, daß motorische Leistung an sich schon größere Schnelligkeit bedeute, so hängt doch wohl allerdings die möglichste Verdrängung der Leistung aus dem Bereich der bewußten Aufmerksamkeit und Willensimpulse (die Automatisierung) mit dem Überwiegen der motorischen Reaktionsweise ziemlich eng zusammen, und ebenso hat die motorische Reaktionsweise für die Schnelligkeit der Leistung (im Gegensatz zur Präzision derselben) den Vorteil, die allgemeine (psychomotorische) Erregung, welche jede vorwiegend motorisch zu vollziehende Arbeit hervorbringt, als Anregung (s.u.) für die Steigerung der Leistungskurve verwerten zu können. Über die Bedeutung derjenigen Fälle von Wechsel in den technischen Mitteln der Erzielung einer Leistung, welche durch die Notwendigkeit, diese mit andern Leistungen zu kombinieren und also diese verschiedenen Leistungen möglichst auf verschiedene Mittel des psychophysischen Apparates zu verteilen, geschaffen werden, wird weiter unten zu handeln sein. In jedem Falle zeigt das Vorkommen solcher Änderungen des psychophysischen Charakters einer Arbeit bei Gleichbleiben ihres Leistungseffekts, daß man sich hüten muß, diesen Effekt und also den Sinn und Zweck einer Leistung zur Grundlage einer Klassifikation der Arbeit nach ihrer psychophysischen Eigenart zu machen. Und ebenso zeigt sich: daß die Übung einer Leistung unter Umständen deren qualitative Änderung, ja geradezu: die Substitution eines dem Wesen nach anderen psychophysischen Geschehens bedeuten kann.
Die Wirkung der Übung äußert sich in erkennbarer Weise am unmittelbarsten natürlich in den Fortschritten des Leistungsmaßes in der Zeiteinheit im Verlauf einer kontinuierlichen Arbeit. Allein in diesem Fall wirkt, vom Standpunkt der Kraepelinschen Betrachtungsweise aus gesehen, die stetig fortschreitende Ermüdung ihr entgegen. Während anfangs die zunehmende Übung die beginnende Ermüdung überwiegt und also die Arbeitskurve, im ganzen, sich aufsteigend bewegt, beginnt, bei immer weiterer Fortsetzung der Arbeit, die Ermüdung gegenüber der Übungszunahme im Effekt auf die Arbeitsleistung mehr und mehr zu überwiegen. Man pflegt daher den Übungsfortschritt zu messen nach dem Maß des Zuwachses, den die Leistungsfähigkeit bei Beginn einer neuen, durch eine zur Erholung ausreichende Pause von der vorangehenden getrennten, Arbeitsperiode, insbesondere eines neuen Arbeitstages gegenüber dem Niveau bei Beginn des vorhergehenden, aufweist. Als erfahrungsgemäß (und experimentell) feststehend wird aber andererseits angesehen, daß das erreichte Niveau der Geübtheit sich mit Aufhören der kontinuierlichen Wiederholung der Leistung sofort, zunächst schnell, dann langsamer, zu senken beginnt (Übungsverlust); es wird also auf diese Weise nur der bei Beginn der neuen Arbeitsperiode noch verbliebene Rest des Übungszuwachses (Übungsrückstand) gemessen. Der Übungsverlust während des Schlafs scheint geringer zu sein als derjenige während des Wachens, offenbar weil der Einfluß andersartiger Einstellungen des psychophysischen Apparates die Spuren der Übung alteriert. Durchweg nimmt ferner im Verlauf immer weiter fortgesetzter Übung und immer höheren Niveaus der Geübtheit der Übungszuwachs, relativ betrachtet, ab, bis zur Erreichung eines Maximums von Geübtheit, welches natürlich für jede Person und jede Leistung verschieden sein kann. Je mehr sich das Maß der Geübtheit diesem Maximum annähert, desto früher muß in den Arbeitskurven der einzelnen Tage, – die nunmehr infolge des hohen Standes der Geübtheit ja mit viel höheren Anfangsleistungen einsetzen als die Arbeitskurven Ungeübter (aber dafür auch weniger steigerungsfähig sind) – die Ermüdung die Arbeitskurve zum Sinken bringen. Andererseits scheint die experimentelle Erfahrung zu lehren, daß bei hohem Übungsstande diesem früheren Manifestwerden des Einflusses der Ermüdung eine größere Langsamkeit in der Senkung der Arbeitskurve also eine geringere Ermüdbarkeit entspricht. Die Arbeitskurve des Geübten setzt also höher ein, steigt mäßiger an, beginnt früher zu sinken, sinkt aber langsamer und verläuft also im ganzen 1. auf höherem Niveau, 2. flacher und stetiger, als die des Anfängers.
Das Tempo des Übungszuwachses stellt nach Kraepelins Terminologie das Maß der Übungsfähigkeit dar. Das bei verschiedenen Personen sehr verschiedene Tempo des Übungsverlustes oder vielmehr das Maß des nach Pausen, insbesondere nach dem Nachtschlaf, noch verbliebenen Übungsrückstandes, bezeichnet er als Übungsfestigkeit. Die Übungsfestigkeit äußert sich zunächst in dem Grade der Stetigkeit, mit welcher, infolge der zunehmenden Übung, die Leistungsfähigkeit beim Arbeitsbeginn von Tag zu Tag zunimmt, bis die maximale