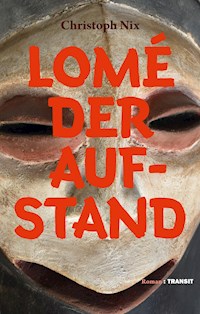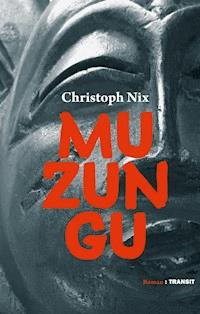Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Königstuhl
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
In Burundi, einem der ärmsten Länder dieser Erde, bereitet sich der Präsident auf seine dritte Amtszeit vor. Seine Kabinettskollegen streiten über die Nachfolge und der Verteidigungsminister wird in die Luft gesprengt. Schlägertruppen beherrschen das Strassenbild, es droht ein neuer Genozid. Die staatlichen Terroristen machen vor Geistlichen nicht halt, drei weiße Ordensschwestern werden ermordet. Die reiche Welt hat kein Interesse an der Aufklärung der Verbrechen. Der Vatikan schweigt. Die letzten Journalisten verlassen das Land. Vier selbst ernannte Detektive stellen sich dem Terror und finden mitten im Kongo eine gesellschaftliche Utopie und eine Antwort auf die Taten. KONGOTOPIA – Zartes Land.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christoph Nix
KONGOTOPIA
Christoph Nix
KONGOTOPIA
ROMAN
Impressum
© 2023 Edition Königstuhl
Alle Rechte vorbehalten.
Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert werden, insbesondere nicht als Nachdruck in Zeitschriften oder Zeitungen, im öffentlichen Vortrag, für Verfilmungen oder Dramatisierungen, als Übertragung durch Rundfunk oder Fernsehen oder in anderen elektronischen Formaten. Dies gilt auch für einzelne Bilder oder Textteile.
Bild Umschlag: Lukas Ondreka
Gestaltung Umschlag: Johannes Nix
Satz: Stephan Cuber, diaphan gestaltung, Bern
Lektorat: Franziska Bolli
Druck und Einband: CPI books GmbH, Ulm
Verwendete Schriften: Baskerville, Mark
ISBN 978-3-907339-46-6
eISBN 978-3-907339-75-6
Printed in Germany
www.editionkoenigstuhl.com
© Foto: Lukas Ondreka
Christoph Nix (1954) ist Strafverteidiger, Regisseur und Schriftsteller. In Togo hat er das Theater Luxor de Lomé unterstützt, in Burundi und Malawi Theaterprojekte entwickelt, im Kongo zum Völkermord in Ruanda recherchiert, am Theater Konstanz mit Henning Mankell »Die Rote Antilope« uraufgeführt. KONGOTOPIA beendet seine AFRIKANISCHE TRILOGIE, die in Uganda (MUZUNGU), Togo (LOMÉ – DER AUFSTAND), Burundi und dem Kongo spielt.
Kommt der Krieg zwischen Tutsi und Hutu daher,
dass sie in verschiedenen Gegenden wohnen?
Nein, sie leben ja im selben Land.
Dann sprechen sie nicht dieselbe Sprache?
Doch, sie sprechen dieselbe Sprache.
Vielleicht haben sie nicht denselben Gott?
Doch, sie haben denselben Gott.
Aber … warum machen sie dann Krieg?
Weil sie nicht die gleichen Nasen haben.
Gael Faye
Prolog:
Das Goldene Nashorn
Strobel kam zu spät. Er war müde. Sein Jackett saß schief und der Hemdkragen war zerknittert. Kaum stand er am Pult, steckte er sich eine Zigarette an. Eine Studentin wollte protestieren, doch als er sie ansah, ließ sie ihre übereifrige Hand auf den Schreibblock zurücksinken.
Sein Blick wanderte über die wenigen Studierenden, die ihm geblieben waren. Ein Zug aus der Zigarette und man hörte seine Stimme:
»In Europa weiß man wenig über die frühe Geschichte des afrikanischen Kontinents. Man will es nicht wissen. Hartnäckig wird daran festgehalten, es handle sich um die Geschichte von Stämmen und Stammeskriegen in Regenwald und Savanne. Dabei waren die Kulturen und Königreiche Afrikas schon im frühen Mittelalter verbunden mit unserer Welt.
Im Jahr 1932 stehlen Grabräuber ein kleines goldenes Rhinozeros. Dieses Rhinozeros von Mapungubwe mit nur einem Horn wird für den Ethnologen François-Xavier Fauvelle zu einem Symbol. Er reist auf diesem Tier durch das frühe Afrika. Er reitet auf ihm wie ein junger Gott über die Savanne, wie Don Quichotte durch La Mancha. Dabei gewinnt er einen neuen Blick auf Afrika. Ein neues Wesen betritt die Weltbühne. Sein Schöpfer muss ein weitgereister Mann gewesen sein, denn dieses goldene Nashorn ist ein Abbild des kleinen asiatischen Nashorns. Mitten in Afrika, im 9. Jahrhundert.
Als die belgischen Kolonialherrn im Kongo im 19. Jahrhundert auf das Königreich der Kuba stießen, trafen sie auf einen Staat mit einer ausgeklügelten Demokratie, klug und differenziert durchdacht, mit starken plebiszitären Elementen. Das System orientierte sich ausschließlich an Gerechtigkeitsfragen und eine hoch entwickelte handwerkliche Tradition versorgte alt und jung. Die Kuba mussten in Kontakt mit der westlichen Zivilisation gestanden haben. Davon waren die belgischen Invasoren überzeugt. Von wegen. Es war umgekehrt. Alle Menschen stammen aus Afrika, unsere europäische Welt hat ihre Geschichte vergessen. Die Weißen erhoben sich über die Hochkulturen des afrikanischen Mittelalters: Von den nubischen Königreichen mit ihren Pyramidenbauten über die reiche Schriftkultur des mittelalterlichen Malireichs bis zur Blütezeit Groß-Simbabwes gab es eine alte Welt auf dem alten Kontinent, von der wir in Europa allenfalls träumten. Sie war entstanden aus dem Denken und dem Handeln der Afrikaner, in einer Zeit, als bei uns noch die Hexen verbrannt wurden und die Erde eine Scheibe war.
In der Region, in der im letzten Jahrhundert einer der größten Genozide stattfand, tappt man immer noch im Dunkeln: ich spreche vom Dreiländereck Ruanda, Burundi und Kongo. Hier gab es im sechsten Jahrhundert nach Christus eine demokratische Hochkultur.«
Die Asche viel herab. Strobel hatte sich eine Zigarettenlänge Zeit gegeben. Er überzog, war milde, verzieh sich seinen Überschwang:
»Im Reich des heutigen Ruanda ernannte König Gihanga um das Jahr 1100 Prinz Gahima zum Nachfolger. Sein Einflussgebiet erstreckte sich über das gesamte untere Nilbecken. Gahima ist der Urvater von Twa, Hutu und Tutsi. Sie sind die Völker dieser Erde, standen während vieler Jahrhunderte in keinerlei kriegerischer Absicht zueinander. Wie konnte es dazu kommen, dass die drei Ethnien viele Jahrhunderte später so aufgebracht waren? Wo liegt die Wurzel dieses Krieges?
In die Regierungszeit Kigeli II., etwa um 1600, fallen die großen Kriege im Ostkongo, besonders gegen Basongora. Kigeli verstieß gegen das uralte Gebot, Basongora niemals anzugreifen. Damit nicht genug. Kigeli glaubte nur an sich, seine männliche Stärke und eroberte die heilige Trommel »Icyungo«. Er hielt nichts von Mythen, von angestammten Rechten, von Traditionen und von den Göttern. Seine Soldaten sahen das jedoch anders und rebellierten gegen ihn. Das Wort Putsch stammt vom ausscherenden Befehlshaber Nputncha ab und ist eine indigene Lautverschiebung. Militärisch hatte er keine Chance. Kigeli II. war klug, wild und gnadenlos. Seine Mehrheiten sicherte er sich durch Geschenke und ein feines Netz von Abhängigkeiten.
Dennoch gab es nach wie vor Aufrechte. Ein Teil des Heeres floh mit Frauen und Kindern über den Fluss Ruzizi, in den Regenwald des heutigen Kongo. Dort versteckten sie sich 99 Tage lang. Als ihre Spuren verwischt waren, stiegen sie hinauf in die Berge. Sie gerieten in Schneestürme, viele Kinder und Alte erfroren. Sie überquerten den großen Graben, der durch den afrikanischen Kontinent geht. Mitten im heutigen Itombwe-Gebirge entdeckten sie eine fruchtbare Hochebene: geschütztes Land, saftige Wiesen, fremde Pflanzenarten, viele wilde, bunte Tiere, die sie vorher nie zu Gesicht bekommen hatten.
Der Anführer der Flüchtlinge sah hier eine segensreiche Zukunft. Vielleicht könnte eine neue Welt entstehen, frei von Tyrannei und Habsucht. Auf 3200 Metern Höhe, im Verborgenen, nahe am Himmel, gab es Täler, Hügel, Flüsse, Moore, dichtes Buschwerk und wohlriechende Kräuter. Der Namenlose verliebte sich in diese Landschaft. Er war fasziniert von den Buschelefanten, die friedlich die Köpfe neigten und die man leicht dazu bringen konnte, den Pflug zu ziehen. Der Namenlose entschied, an diesem Ort zu bleiben, um eine neue Welt zu schaffen.
Als in Europa der erste große Krieg begann, der dreißig Jahre dauerte und das Gesicht der folgenden Kriege prägte, entstand in Afrika, auf dem dunklen, dem hoffnungsvollen Kontinent, eine neue Gemeinschaft.
Die Frau Kigelis II. hatte sich nach der Flucht der Abtrünnigen das Leben genommen. In ihrem Bauch trug sie das Kind des Namenlosen. Sie hätte ihrem Sohn den Namen Mulenge gegeben.
Etwa 300 Jahre später schenkte sich ein barbarischer König aus Europa das Herz des afrikanischen Kontinents und nannte es Kongo. Leopold von Belgien hat den afrikanischen Kontinent nie betreten, aber seine Soldaten wüteten dort wie die Teufel. In den Bergen des Ostens blieb das Volk der Hoffnungsvollen unentdeckt: die Banyamulenge.«
Der Professor taumelte, fast wären ihm seine Gefühle entglitten. Er wollte nicht sentimental werden. Er steckte sich eine zweite, eine letzte Zigarette an und betrachtete noch einmal den Hörsaal der Humboldt-Universität.
»Die Geschichte endet hier. Das war meine letzte Vorlesung. Ich wünsche Ihnen viel Glück auf all Ihren Reisen in das offene Herz Afrikas.«
Strobel verbeugte sich, unauffällig, ließ Zettel und Bücher auf dem Katheder liegen, packte die speckige Aktentasche aus Schlangenleder, eilte die Treppe hinunter, setzte seinen Hut auf. Mit einem Taxi fuhr er zum Flughafen. Von dort flog er in den Süden, nach Afrika.
Erstes Buch:
Burundi
I
Ein warmer Wind wehte den Hügel empor. Im Turm der Kapelle schlug der Klöppel gegen die Glocke. Ein heller Klang. Schwester Lisette erwachte. Sie setzte die Füße auf den Holzboden. Der vertraute Kaffeegeruch fehlte. Sie vergewisserte sich, dass keine Spinne in ihren Hausschuhen steckte und warf einen Blick unters Bett.
Sie stand auf und spähte in die Küche. Niemand da. Die Tür zum Schlafzimmer der Oberin war angelehnt. Sie stellte Wasser auf den Herd, setzte sich an den Küchentisch, stützte den Kopf in die Hände. Was tat sie hier? Ihr ganzes Leben hatte sie in Burundi verbracht. Sie liebte diese feinen Menschen. Lisette war eine moderne Frau. Sie glaubte nicht an den Satan, aber bereits zweimal hatte sie erlebt, wozu Menschen fähig sind.
Lisette war vierzig Jahr alt, von schlanker Statur, das weiße Habit machte sie größer. Ihre Gesichtszüge waren fein, man sah – und das war nicht immer zu ihrem Vorteil – dass sie eine Tutsi war.
Sie wusste nicht, ob sie ihren Glauben noch hatte, aber das Vertrauen war ihr geblieben. Wenn es Gott gab, war er gut. Abwesend. Wie die meisten Männer. Die Frauen retten die Welt, zumindest ihre Kinder. Es war nicht leicht, nur mit Frauen unter einem Dach zu leben.
Lisette sprang auf und lief ins Schlafzimmer der Oberin. Ein süß-säuerlicher Geruch stieg ihr in die Nase, ihr Blick fiel aufs Bett: Dorena lag in ihrem Blut, den Unterleib aufgeschlitzt, das Gesicht erstarrt, die Hände zu Fäusten geballt. Lisette wollte schreien. Es ging nicht. Ihre Knie gaben nach.
Jäh, brutal, das Innerste nach aussen gekehrt – so endete Dorenas Leben nach 43 Jahren auf dem Hügel. Wer hatte das getan? Lisette hatte nichts gehört. Nichts. Was für ein Mensch musste das gewesen sein? Was wollte er? Wofür strafte er? Für Lisette versank alles in Dunkelheit. Kein Licht nirgends.
Die Schwestern wecken? Die Soldaten rufen? Von der Regierung war keine Hilfe zu erwarten. Die Regierung interessierte sich nicht für die Menschen. Den Körper der Oberin waschen. Die Tote herrichten. Der Oberin ihre Würde zurückgeben.
Danach weckte sie die Schwestern. Über dem Kloster Mutumba lag eine unheimliche Stille. Was für eine Erleichterung, als eine der Schwestern zu weinen begann.
Den Menschen, die mit ihnen auf dem Berg wohnten, blieb auf Dauer nichts verborgen. Sie kamen herbei, um den Schwestern nah zu sein, das Unglaubliche zu beweinen.
Lisette hatte alles getan, ohne Rücksicht darauf, dass die Regierung sie selbst des Verbrechens beschuldigen könnte. Mit dem Blut, das sie vom Boden aufwischte, fegte sie solche Gedanken hinweg. Sie wollte die Mutter Oberin nicht nackt den Militärs präsentieren.
Immer mehr Menschen kamen den Hügel herauf, eine Prozession der Armen. Vor der Kapelle stimmten sie das Salve Regina an.
Aus dem Büro der Oberin telefonierte Lisette mit dem deutschen Botschafter in Bujumbura. Er war oft bei ihnen im Gottesdienst gewesen.
»Sie müssen kommen, bitte!«
Zielstrebig wühlte sie in Mutter Dorenas Schreibtisch-Schublade. Sie blätterte in Briefen und Notizen, fand Fotos eines kleinen Mädchens, das traurig in die Kamera blickte. Andere Bilder zeigten eine reife Frau mit wehendem Kleid auf einem weißen Schiff. ›Zufrieden und glücklich‹, dachte Lisette. Noch mehr Fotos. Dorena mit harten Augen. Dorena mit aufgequollenem Gesicht. Verstört. Was hatte sie aus der Bahn geworfen? Zwischen vergilbten Papieren fand Lisette die Akten, nach denen sie gesucht hatte. War Dorena im Kongo gewesen? Wer war der schwarze Priester auf den Fotos? Opfer oder Täter?
Auch dem Militärposten auf dem Hügel war nicht verborgen geblieben, dass etwas geschehen war. Ein junger Korporal eilte mit vier uniformierten Männern zum Kloster. Sie stellten sich vor der Kapelle auf und schauten zur aufgebahrten Oberin hinüber, die Gewehre fest umschlossen. Der Gesang machte ihnen Angst. Sie traten den Rückzug an, verschanzten sich in ihren erbärmlichen Hütten. Auf einem alten Schild stand: »Militärstation Mutumba«.
Die Bauern, ihre Frauen, die Kinder standen stolz vor der Kapelle, als könnte sie jetzt nichts mehr erschüttern.
›Ein Bild der Bauernkriege. Thomas Müntzer zog in die Schlacht. Sie hatten keine Chance. Die Toten lagen auf dem Feld wie die Toten in Kigali und Bujumbura. Wie anders würde heute die Welt aussehen, hätten die Bauern gesiegt.‹
All dies ging Botschafter Strobel durch den Kopf, als er das letzte Stück des Hügels zu Fuß heraufkam. Er nahm Schwester Lisette unbeholfen in den Arm, er wollte sie trösten.
Der Korporal, der auf den Botschafter zuging, war misstrauisch. Ob er eine Reiseerlaubnis habe, fragte der dünne kleine Mann und Strobel legte ihm den Diplomatenpass vor. »Ich vertrete als Deutscher Botschafter auch die Interessen dieser Schweizer Ordensgemeinschaft in Burundi.«
Der kleine Mann verstummte und verlegte sich darauf, genau zu beobachten, wie Volker Götz, der mit Strobel hergefahren war, auf den Chauffeur wartete, der den Botschaftswagen im Schatten abstellte.
Strobel ging zur aufgebahrten Leiche, die Gemeinde machte ihm Platz. Es dauerte lange, bis er mit Lisette und einer Novizin ins Büro der Kongregation entfliehen konnte.
»Sie haben sie umgebracht! Einfach so!«.
Strobel starrte vor sich hin. Lisette zitterte.
»Wo ist euer Gott?«, murmelte er.
»Er fordert uns heraus. Aber hier brauchen wir Ihre weltliche Hilfe.«
Es klopfte, eine alte Dame erschien.
»Schwester Martha, ich dachte, Sie seien zurück nach Europa.«
»Was soll ich in der Schweiz, in Quarten, eingeklemmt zwischen Berg und Walensee? Da sind die Leute eng im Kopf, ein weiter Geist muss in die Ferne. Was denken Sie?«
Strobel wusste nicht, was die Schwestern von ihm erwarteten.
»Götz, Sie bleiben heute Nacht hier, ich fahre mit dem Chauffeur nach Bujumbura zurück und versuche, auf diplomatischem Weg Hilfe aus Deutschland zu bekommen.«
Langsam ging die Trauergemeinde auseinander. Am Rande des Hügels war von den Schwestern ein Garten angelegt worden: Holunder, Rosen, Hyazinthen und Tulpen. Eine Schwester aus Antwerpen hatte die Tulpenzwiebeln nach Burundi gebracht. Der Gärtner begann mit dem Aushub des Grabes. Götz bekam im Gästehaus eine Zelle zugewiesen. Er legte um das Grundstück Bewegungsmelder an, installierte Lampen und sogar eine Videokamera.
Strobel wollte vor Eintritt der Dunkelheit in Bujumbura ankommen. Die Straßen waren überfüllt, sodass man nicht schneller als dreißig Kilometer pro Stunde fahren konnte.
Hier im südlichen Teil des Landes lebten viele Burundi, die nicht auf der Seite des Präsidenten Pierre Nduwayo waren. Die Straßen waren in einem katastrophalen Zustand, die Schulen verfielen und die wenigen Kliniken hatten kein Personal. Nduwayo war ein Mann Gottes und Gott war ein Mann der Rache.
Sie fuhren den Boulevard Mwezi Gisabo entlang und wollten in den Boulevard du 28 Novembre abbiegen, als sie von einer Kohorte Motorradfahrer eingekreist wurden. Julien bremste ab und fuhr im Schritttempo weiter. Junge Männer mit Schlagstöcken lärmten und fuchtelten mit ihren Pistolen.
Einer riss die Wagentür auf. Strobel schrie:
»Es lebe Pierre Nduwayo, es lebe unser Präsident!«
Da zog die wilde Horde laut lachend ab und schoss einmal in die Luft.
»Was war das, Chef?«.
»Lass uns erstmal eine rauchen.«
Strobel rauchte zwar schon einige Zeit nicht mehr, aber er hatte immer Zigaretten dabei und bot Julien eine an.
»Feuer?«
»Danke, Chef.«
Kurz darauf kam die Militärpolizei. Ein Offizier salutierte, als er die deutsche Fahne am Geländewagen sah. Es tue ihm leid, dass sie zu spät gekommen seien. In Kamenge habe ein Wahnsinniger zwei Nonnen getötet.
»Wie bitte?«, fragte Strobel.
»Kommen Sie mit.«
Sie fuhren im Konvoi, vorne ein Pick-up mit bewaffneten Soldaten, die mit Rufen und Trillerpfeifen die neugierigen Passanten aus dem Weg trieben.
»Kamenge ist der Name eines Stadtteils im Norden von Bujumbura. Hier befindet sich das 1993 gegründete Centre Jeunes Kamenge, ein Jugendzentrum, das die Begegnung junger Tutsi und Hutu fördert. Hier ist auch ein großes Krankenhaus, das Hôpital Roi Khaled. Es soll einem hohen Militär gehören. Dieser Teil der Stadt ist bekannt dafür, dass hier viele Oppositionelle leben.«
Julien hatte etwas Belehrendes. Er hatte Politikwissenschaften studiert und war erschüttert, wie schlecht vorbereitet Diplomaten in die afrikanischen Länder entsandt wurden. Strobel sprach weder Kirundi noch Kisuaheli. Wenn man Glück hatte, sprachen Diplomaten Französisch oder Burisch, die Sprachen der Kolonialherren. Juliens Bild vom weißen Mann hatte sich gewandelt: Reich sein hieß nicht, über Bildung zu verfügen. Strobel war in Ordnung. Es störte ihn nicht, wenn ein Afrikaner ihn belehrte. Er sprach nicht viel, er beobachtete. Hatte er ein Geheimnis? Julien würde es herausfinden. Er hatte Zeit.
Plötzlich hielt der Konvoi an, sie standen vor den Toren der Pfarrei San Guido Maria Conforti, dem Sitz der Ordensschwestern der Xavianer im Distrikt Kamenge. Pater Chessa kam ihnen entgegen, an seiner Seite der Nuntius des Vatikans. Der Nuntius weinte und Pater Chessa rang nach Luft. Ignazio Chessa war ein hübscher, groß gewachsener Mann mit grau meliertem Haar.
»Sie haben die beiden Schwestern Chiara und Claudia ermordet. Kommen Sie.«
Strobel sah das blutverschmierte Zimmer und die beiden mit weißen Tüchern bedeckten Körper. Niemand hinderte ihn, den Tatort zu begehen. Niemand sicherte Spuren.
Strobel fragte:
»Ist ein Arzt hier?«
Er bekam keine Antwort. Noch nie war er in einem Auslandseinsatz mit so viel Gewalt konfrontiert worden. Er funktionierte, er entwickelte Stärke, er staunte. Selbst in Afghanistan hatte er sich sicherer gefühlt als hier in Burundi.
»Schwester Bernadetta hat sie gefunden«, rief Pater Chessa dem Botschafter zu. Die Schwester saß auf einem Stuhl in der Kirche, mit offenem Mund und blutverschmierten Händen.
»Bernadetta war am Nachmittag aus der Stadt zurückgekommen. Seit einigen Monaten lebt sie mit Chiara und Claudia im Kloster. Sie haben fast fünfzig Jahre lang in einer der umkämpftesten Regionen gearbeitet, in Süd-Kivu im Kongo. Bernadetta rief nach Chiara. Keine Antwort. Die Küche war leer und die Tür zu ihrer Zelle versperrt. Sie eilte zu mir, ich bin dann mit ihr zum Dormitorium gelaufen und versuchte, die Tür aufzubrechen. Wir fanden beide Schwestern mit abgeschlagenen Köpfen …«
Was tun? Das Martyrium aushalten? Ein schwarzer Jesus hing am Kreuz.
»Mörder, Feiglinge, Frauenschänder!«
Die Gläubigen kamen aus dem Abendgottesdienst. Sie waren aufgebracht, wütend. Gefahr lag in der Luft. Strobel hatte Angst. Die toten Frauen wurden in die Leichenhalle getragen. Die Polizei patrouillierte auf dem Gelände. Pater Chessa versuchte, die Menschen zu beruhigen. Kerzen wurden angezündet. Strobel setzte sich auf eine Kirchenbank, aber er hielt es nicht lange aus, wollte nach Hause. Julien holte den Wagen, Strobel nahm dieses Mal hinten Platz.
Das Haus lag in der Oberstadt. Unter ihm die Hütten der Armen, über ihm die Villa des Präsidenten. Julien gab Gas und fuhr über den Boulevard 28. Er hupte, zwei Wächter öffneten das Tor.
Es dauerte, sie hatten geschlafen. Beide Männer arbeiteten tagsüber als Lehrer an einer Grundschule. Das knappe Salär reichte nicht einmal für die Miete, Lehrer brauchten Nebenjobs. Strobel zahlte gut.
Mit freudigem Gebell kam Rin-Tin-Tin aus dem Haus gerannt. Strobel hatte den deutschen Schäferhund aus Togo mitgebracht. Er setzte sich auf den Balkon.
›Was für eine Welt‹, dachte Strobel. Er holte sich eine Flasche Mineralwasser, ein Stück Schokolade und schrieb eine WhatsApp an Schwester Lisette.
Rin-Tin-Tin stand auf, legte seinen Kopf auf Strobels Knie und gähnte.
»Komm, es ist spät, wir müssen schlafen gehen«, murmelte der Botschafter.
*
Aus der Bar Iwabo w’Abantu in Kamenge kam noch Lärm. An einem großen Tisch saßen die Offiziere der Regierungspartei. In der Mitte Adolphe, der Kommandeur, mit weißer Baseballmütze. Hinter ihm in einem Käfig ein Affe, der von den Soldaten Bier bekam. Sie lachten über das betrunkene Tier. Der Affe schaute zwischen den Gitterstäben hindurch. Adolphe spendierte seinen Männern Primus-Bier aus der staatlichen Brauerei.
»Wenn einer von euch behauptet, ich stünde hinter den Morden an den Nonnen, bringe ich ihn um.«
Er trank sein Bier in einem Zug leer und fing an zu singen.
Die Offiziere grölten, wurden lauter, die Stimmung drohte zu kippen.
»Macht euch nach Hause, Männer, morgen ist ein schwerer Tag.«
Das war ein Befehl. In wenigen Minuten war die Bar leer.
Adolphe blieb allein zurück.
»Lily, noch ein Bier.«
›Die wollen mir die Morde in die Schuhe schieben. Verdammt. Ich töte keine Frauen.‹
*
Strobel war früh aufgestanden. Er liess Rin-Tin-Tin in den Garten, bereitete sich einen Kaffee und machte den Computer an. Auf der Homepage des UN-Hochkommissars für Menschenrechtsfragen gab er zwei Stichwörter ein: »Imbonerakure« und »Pierre Nduwayo«. Ein Artikel fiel ihm auf. Eine schwedische Journalistin behauptete, die Imbonerakure seien früher in Ausbildungszentren im Kongo gedrillt worden, sie seien eng mit einzelnen Führern von Polizei und Armee sowie mit dem berüchtigten Geheimdienst SNR verbunden.
Strobel sprang auf und rief Julien an:
»Holen Sie mich ab, ich muss in die Botschaft.«