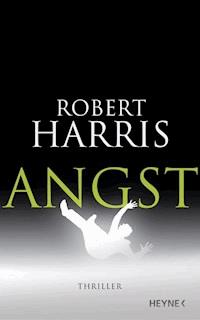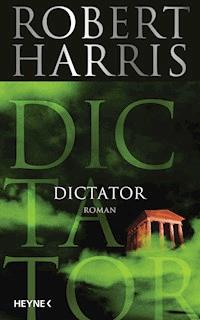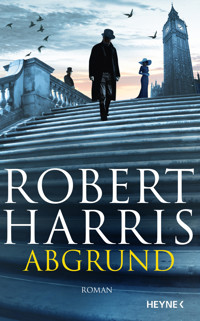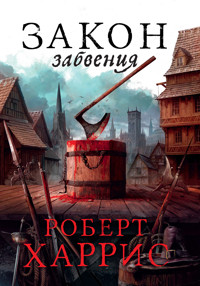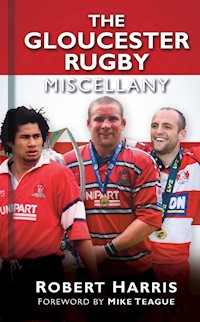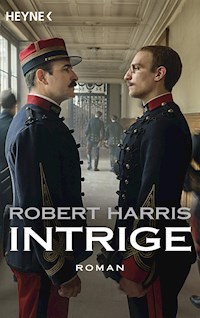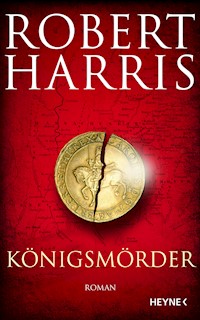
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
England, 1660. König Karl II. erlässt mit einer Akte der Verzeihung ein Generalpardon. Ausgenommen sind die Königsmörder, jene Hochverräter, die das Urteil zur Enthauptung seines Vaters Karl I. unterzeichnet haben. Dazu gehören auch die Oberste Whalley und Goffe, die im Bürgerkrieg auf der Seite Oliver Cromwells kämpften. Sie können rechtzeitig in die neuen Kolonien in Amerika fliehen. Die Flüchtlinge treffen dort auf eine Gesellschaft, die durch einen puritanischen Fanatismus geprägt ist und sich gerade vom Mutterland jenseits des Atlantiks abspaltet. Hier könnten sich die beiden unter Gleichgesinnten in Sicherheit wiegen, wären ihnen nicht ebenso fanatische Häscher auf den Fersen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 674
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Das Buch
England, 1660. Nach den Wirren des blutigen Bürgerkriegs und der Zeit des Lordprotektorats unter Oliver Cromwell gelangt König Karl II. auf den Thron. Er erlässt mit der Akte der Verzeihung ein Generalpardon für alle, die am Bürgerkrieg beteiligt waren. Ausgenommen sind die Königsmörder, jene Hochverräter, die das Urteil zur Enthauptung seines Vaters Karl I. unterzeichnet haben. Dazu gehören auch die Oberste Whalley und Goffe, die im Bürgerkrieg auf der Seite Oliver Cromwells kämpften. Sie können rechtzeitig in die neuen Kolonien in Amerika fliehen. Die Flüchtlinge treffen dort auf eine Gesellschaft, die durch einen puritanischen Fanatismus geprägt ist und sich gerade vom Mutterland jenseits des Atlantiks abspaltet. Hier könnten sich die beiden unter Gleichgesinnten in Sicherheit wiegen, wären ihnen nicht ebenso fanatische Häscher auf den Fersen.
Der Autor
Robert Harris wurde 1957 in Nottingham geboren und studierte in Cambridge. Seine Romane Vaterland,Enigma,Aurora,Pompeji,Imperium,Ghost,Titan,Angst,Intrige,Dictator,Konklave,München,Der zweite Schlaf und zuletzt Vergeltung wurden allesamt internationale Bestseller. Er lebt mit seiner Familie in Berkshire.
ROBERT HARRIS
KÖNIGSMÖRDER
Roman
Aus dem Englischenvon Wolfgang Müller
Die Originalausgabe erscheint unter dem Titel
Act of Oblivion
bei Hutchinson, London
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2022 by Canal K Limited
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabeby Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: Eisele Grafik·Design, München,unter Verwendung von © Hoberman Collection / Getty Images
Herstellung: Mariam En Nazer
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN 978-3-641-29161-7V002
www.heyne.de
Für Gill
INHALT
Vorbemerkung des Autors
Dramatis personae
Teil einsSUCHEN1660
Teil zweiJAGEN1661
Teil dreiVERSTECKEN1662
Teil vierMORDEN1674
Nachwort
VORBEMERKUNG DES AUTORS
Dieser Roman ist die fantasievolle Neuschöpfung einer wahren Geschichte, der Suche nach den »Königsmördern« von König Karl I., der größten Menschenjagd des 17. Jahrhunderts – insbesondere der Verfolgung von Edward Whalley und William Goffe durch ganz Neuengland. Die Ereignisse, die Zeitangaben und die Orte sind historisch zutreffend, und fast jede handelnde Figur hat tatsächlich gelebt – außer Richard Nayler. Er musste erfunden werden: keine Menschenjagd ohne einen Menschenjäger. Wer er auch war, seine Identität ist jedenfalls im Nebel der Geschichte verloren gegangen.
Sonst war ich bemüht, mich genau an die überlieferten Tatsachen zu halten, und habe dabei sogar einige entdeckt, die zuvor noch nicht bekannt waren, wie beispielsweise Goffes Geburtsort und -datum sowie die Identität von Whalleys zweiter Frau.
Aber es ist nun einmal ein Roman. Wer der Geschichte weiter auf den Grund gehen möchte, findet im Nachwort einige Quellen.
Robert Harris, Juni 2022
DRAMATIS PERSONAE
Die Königsmörder
Oberst Edward Whalley
Oberst William Goffe
In Massachusetts
Daniel Gookin – Siedler in Cambridge, Massachusetts
Mary Gookin – Frau von Daniel Gookin
Mary, Elizabeth, Daniel, Samuel, Nathaniel – Kinder der Gookins
John Endecott – Gouverneur von Massachusetts
Jonathan Mitchell – Pfarrer von Cambridge
John Norton – Geistlicher der Ersten Kirche in Boston
Kapitän Thomas Breedon – Kaufmann und Schiffseigner aus Boston; Royalist
Thomas Kellond – Schiffseigner; Royalist
Kapitän Thomas Kirke – Royalist
John Chapin – Naylers Führer
John Stewart, William Mackwater, Niven Agnew, John Ross – Schotten, Mitglieder von Naylers Suchtrupp
John Dixwell – Königsmörder
In New Haven
Reverend John Davenport – Pfarrer und Mitgründer von New Haven
Nicholas Street – Vikar und Schulleiter in New Haven
William Jones – Einwohner von New Haven
Hannah Jones – Frau von William Jones
William Leete – Gouverneur von New Haven
Dennis Crampton – Einwohner von New Haven
Richard Sperry – Bauer
In Connecticut
John Winthrop – Gouverneur von Connecticut
Simon Lobdell – Führer
Micah Tomkins – Besitzer des Krämerladens in Milford
Kapitän Thomas Bull – Puritaner in Hartford
John Russell – Geistlicher in Hadley
In London
Richard Nayler – Beamter des Kronrats
Katherine Whalley – Frau von Edward Whalley
Frances Goffe – Frau von William Goffe, Tochter von Edward Whalley
Frankie, Betty, Nan, Judith, Richard – Kinder der Goffes
Reverend William Hooke – Schwager von Edward Whalley
Jane Hooke – Frau von William Hooke, Schwester von Edward Whalley
Oberst Francis Hacker – ehemaliger Befehlshaber der Bewachertruppe von König Karl I.
Isabelle Hacker – Frau von Francis Hacker
Sir Edward Hyde (später Graf von Clarendon) – Lordkanzler
Sir William Morice – Staatssekretär für das nördliche Departement
Sir Arthur Annesley, Sir Anthony Ashley-Cooper – Mitglieder des Kronrats
Barbara Palmer (später Lady Castlemaine) – Mätresse von Karl II.
Samuel Nokes – Sekretär von Richard Nayler
Herzog von York – jüngerer Bruder von Karl II.
Samuel Wilson – Kaufmann
In Europa
Sir George Downing – Seiner Majestät Botschafter in Den Haag
Sir John Barkstead, John Dixwell, Oberst John Okey, Miles Corbet, Edmund Ludlow – Unterzeichner des Todesurteils für den König
James Fitz Edmond Cotter, Miles Crowley, John Rierdan – irische Offiziere der Royalisten
Sir John Lisle – Advokat und Organisator des Prozesses gegen König Karl I.
Im Bürgerkrieg
Oliver Cromwell – Vetter von Edward Whalley
Henry Ireton – Schwiegersohn von Oliver Cromwell
General Thomas Fairfax – Befehlshaber der Parlamentsarmee
Kornett George Joyce – Soldat bei der Verhaftung des Königs
John Bradshaw – Gerichtspräsident beim Prozess gegen Karl I.
John Cooke – Ankläger beim Prozess gegen Karl I.
Thomas Harrison – Unterzeichner des Todesurteils für den König
TEIL EINS
SUCHEN
1660
KAPITEL 1
Wenn man im Sommer 1660 in Massachusetts die vier Meilen von Boston nach Cambridge gereist wäre, hätte man nach der Überquerung des Flusses Charles als Erstes das Haus der Gookins gesehen. Es stand an der Straße am Südrand der Niederlassung, gleich hinter der Flussbiegung auf halber Strecke im sumpfigen Land zwischen dem Charles und dem Harvard College – ein stattliches zweistöckiges Holzgebäude auf eingezäuntem eigenem Grund, mit einem Speicher unter einem steilen Dach, von wo man freie Sicht auf den Charles hatte. In jenem Jahr baute die Kolonie die erste Brücke über den Fluss. Neben der Böschung, wo die Fähre anlegte, wurden gerade dicke Holzpfeiler in den Schlamm getrieben. Die einschläfernde Mittsommerluft trug das Hämmern und Sägen und die Rufe der Arbeiter bis zum Haus.
An diesem besonderen Tag – Freitag, der 27. Juli – stand die Vordertür weit offen, und an den Torpfosten war ein Schild genagelt worden, auf das in Kinderschrift Willkommen zu Hause stand. Es hatte geheißen, ein Schiff aus London, die Prudent Mary, sei zwischen Boston und Charlestown vor Anker gegangen. Und unter den Passagieren befinde sich Mr Daniel Gookin, der Herr des Hauses, der nach zweijähriger Abwesenheit nach Amerika zurückgekehrt sei.
Das ohnehin makellose Haus war noch einmal aufgeräumt und ausgekehrt, die Kinder geschrubbt und in ihre beste Sonntagskleidung gesteckt worden. Am frühen Nachmittag saßen alle fünf mit Mrs Gookin in der Stube und warteten: Mary, zwanzig Jahre alt, benannt nach ihrer Mutter, Elizabeth, achtzehn, und die drei jüngeren Brüder Daniel junior, zehn, Samuel, acht, und der vierjährige, an seinen Haaren herumzupfende Nathaniel, der bei Gookins Abreise noch nicht sprechen konnte und keine Erinnerung an ihn hatte.
Mrs Gookin wusste, dass er nicht deshalb so unruhig war, weil sie ihn an diesem sonnigen Nachmittag nicht aus dem Haus ließ, sondern weil er zum ersten Mal bewusst seinen Vater sehen würde. Sie hob ihn auf ihre Knie, strich ihm über den Scheitel und erzählte ihm von dem Mann, der bald durch die Tür kommen würde – von seiner Güte und Freundlichkeit, seiner Kraft und Tapferkeit und seiner bedeutenden Arbeit für die Regierung in London, wohin ihn der Lordprotektor persönlich gerufen hatte. »Er liebt dich, Nat, und mit Gottes Hilfe wirst auch du ihn lieben.«
»Was ist ein Lorbebäcker?«
»Lordprotektor. Das war der Herrscher und Beschützer von England und Amerika.«
»Wie ein König?«
»Ja, wie ein König. Nur besser, weil das Parlament ihn gewählt hat. Aber der Protektor ist jetzt tot. Deshalb kommt dein Vater nach Hause.«
Nat machte große Augen. »Aber wenn der tot ist, wer tut uns dann beschützen?«
Das war die Frage, auf die die intelligentesten Köpfe Englands keine Antwort gehabt hatten und auf die auch Mrs Gookin keine hatte. Sie wandte sich über Nats Kopf hinweg an ihre Tochter. »Mary, geh doch mal hinauf in den Speicher, und schau, ob dein Vater schon kommt.«
Mary rannte die Treppe hinauf, kam eine Minute später zurück und berichtete, die Fähre liege immer noch am Ufer gegenüber, und auch auf der Straße sei niemand zu sehen.
Nun stieg alle Viertelstunde eines der Kinder hinauf in den Speicher und hielt Ausschau, aber jedes kehrte immer mit der gleichen Antwort zurück. Allmählich überkam Mrs Gookin der schreckliche Gedanke, dass ihr Mann überhaupt nicht mehr kommen würde, dass das Schiff gar nicht angelandet sei oder dass es zwar angelegt habe, aber ihr Mann gar nicht an Bord gewesen sei. Vielleicht war er in London gar nicht an Bord gegangen, oder auf der zweimonatigen Atlantiküberquerung war ihm irgendein Unglück widerfahren. Der verhüllte Leichnam, die versammelte Besatzung, die kurzen Gebete, die am Hals beschwerte Leiche, die mit dem Kopf voraus die Laufplanke hinunter in die Wellen glitt – das alles stand ihr deutlich vor Augen. Auf ihrer ersten Überfahrt von England nach Amerika vor knapp zwanzig Jahren hatten sie dergleichen zweimal miterlebt.
»Lauft, Jungs, wartet draußen auf ihn.«
Nat kletterte von ihrem Schoß, und alle drei Jungen rannten zur Tür hinaus wie Katzen, die man aus einem Sack in die Freiheit entließ.
»Aber macht euch nicht schmutzig!«
Die Mädchen blieben sitzen. Mary, die mit ihrer beharrlichen praktischen Natur ihrer Mutter am ähnlichsten war und in den letzten beiden Jahren die Rolle des Mannes im Haushalt ausgefüllt hatte, sagte: »Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, Mama. Er steht unter Gottes Schutz.«
Woraufhin Elizabeth – die Hübschere, die ständig über ihre häuslichen Pflichten murrte – laut sagte: »Das Schiff müsste schon seit sieben Stunden da sein, und bis Boston ist es nur eine Stunde!«
»Es steht dir nicht zu, deinen Vater zu kritisieren«, sagte Mrs Gookin. »Wenn er sich verspätet, wird er gute Gründe haben.«
Ein paar Minuten später rief Daniel von draußen: »Da kommt jemand!«
Sie liefen aus dem Haus, durch das kleine Tor und auf die zerfurchte lehmige Straße hinaus. Mrs Gookin schaute mit zusammengekniffenen Augen zum Fluss. Seit der Abreise ihres Mannes waren ihre Augen schlechter geworden. Sie erkannte lediglich die dunklen, einem Wasserkäfer ähnelnden Umrisse der Fähre, die das leuchtende Band des Wassers halb durchquert hatte.
»Ein Wagen!«, riefen die Jungen. »Ein Wagen! Da ist Papa auf einem Wagen!« Und dann rannten sie die Straße hinunter, um ihren Vater zu begrüßen. Mit seinen kurzen Beinen hatte Nat Mühe, mit den Brüdern Schritt zu halten.
»Ist er es wirklich?«, fragte Mrs Gookin und sah hilflos in die Richtung.
»Ja«, sagte Elizabeth. »Da, schau, er winkt.«
»Gott sei’s gedankt.« Mrs Gookin fiel auf die Knie. »Gott sei’s gedankt.«
»Ja, er ist es!«, rief Mary, hielt sich gegen die Sonne die Hand über die Augen und fuhr verwundert fort: »Aber es sind zwei Männer bei ihm.«
Im Überschwang der Küsse und der Umarmungen, der Tränen und des Gelächters, der in die Luft geworfenen und herumgewirbelten Kinder beachtete zunächst niemand die beiden Fremden, die hinten auf dem Wagen zwischen dem Gepäck saßen und höflich schwiegen.
Gookin setzte sich Nat auf die Schultern, klemmte sich Dan und Sam unter die Arme und lief mit ihnen auf dem Hof herum, sodass die Hühner die Flucht ergriffen. Dann wandte er seine Aufmerksamkeit den kreischenden Mädchen zu. Mary hatte vergessen, wie groß ihr Mann war, wie gut aussehend, wie mächtig in seiner Erscheinung. Sie musste ihn immerzu ansehen.
Schließlich setzte Gookin die Mädchen wieder ab, umfasste die Taille seiner Frau und flüsterte: »Ich muss dir zwei Männer vorstellen. Mach dir keine Sorgen.« Dann führte er sie zu dem Wagen. »Verzeiht, meine Herren. Ich habe ganz und gar meine Manieren vergessen. Darf ich Euch meine Frau vorstellen, die wahrhaft kluge Mary – in Fleisch und Blut, endlich.«
Die beiden wettergegerbten, zottelbärtigen Männer wandten sich ihr zu und nahmen die Hüte ab, unter denen langes, stumpfes Haar zum Vorschein kam. Sie trugen gelbbraune, salzverkrustete Ledermäntel und hohe abgewetzte braune Stiefel. Als sie etwas steif aufstanden, knarzte das dicke Leder, und Mary roch einen Hauch von Meer, Schweiß und Moder, als hätte man die Männer gerade vom Grund des Atlantiks gefischt.
»Mary«, sagte Gookin. »Das sind zwei gute Freunde, die mich auf der Überfahrt begleitet haben. Oberst Edward Whalley und sein Schwiegersohn Oberst William Goffe.«
»Es freut mich, Euch kennenzulernen, Mrs Gookin«, sagte Whalley.
Sie rang sich ein Lächeln ab und schaute zu ihrem Mann – zwei Oberste? –, aber er hatte ihre Hand schon losgelassen, um ihnen vom Wagen zu helfen. Ihr fiel auf, wie respektvoll er sich ihnen gegenüber benahm und wie sie leicht schwankten, als sie jetzt nach so vielen Wochen auf See die Füße auf festen Boden setzten. Sie mussten lachen und stützten sich gegenseitig ab. Die Kinder schauten sie mit großen Augen an.
Der Jüngere, Oberst Goffe, sagte: »Lasset uns Dank sagen für unsere Erlösung.« Unter seinem Bart verbarg sich ein feines, scharf geschnittenes gottesfürchtiges Gesicht. Seine Stimme klang melodisch. Er breitete die Arme mit offenen Handflächen aus und blickte gen Himmel. Die Gookins wandten ihren faszinierten Blick von ihm ab und senkten den Kopf. »Wir sprechen den Psalm einhundertsieben. ›Die sollen dem Herrn danken um seine Güte und um seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut. Die mit Schiffen auf dem Meer fuhren und trieben ihren Handel in großen Wassern. Die des Herrn Werke erfahren haben und seine Wunder im Meer.‹ Amen.«
»Amen.«
»Und wen haben wir hier?«, sagte Oberst Whalley. Er ging die Reihe der Kinder entlang und fragte ihre Namen ab. Dann deutete er nacheinander einzeln auf jedes. »Mary. Elizabeth. Daniel. Samuel. Nathaniel. Sehr schön. Ich bin Ned, und das ist Will.«
»Hast du den Lorbebäcker denn gekannt, Ned?«, fragte Nathaniel.
»Ja, sehr gut sogar.«
»Aber der ist jetzt tot.«
»Sei still«, sagte Mrs Gookin.
»Stimmt, Nathaniel«, sagte Ned traurig. »Gott sei’s geklagt.«
Schweigen.
»Also, Jungs«, sagte Gookin schließlich und klatschte in die Hände. »Tragt jetzt die Taschen der beiden Herren ins Haus.«
Bis zu diesem Augenblick hatte Mary Gookin gehofft, ihr Mann habe die beiden nur auf dem Wagen mitgenommen. Entsetzt sah sie nun, wie die beiden Männer ihren Söhnen das Gepäck vom Wagen hinunterreichten. Das war schwerlich das, was sie sich von seiner Heimkehr erträumt hatte – Verpflegung und Obdach für zwei höhere Offiziere der englischen Armee.
»Und wo sollen sie schlafen, Daniel?«, sagte sie so leise, dass die beiden es nicht hören konnten. Dabei schaute sie ihren Mann nicht an. So fiel es ihr leichter, sich zu beherrschen.
»In den Betten der Jungen. Die können unten schlafen.«
»Und für wie lange?«
»So lange wie nötig.«
»Was heißt das? Ein Tag? Ein Monat? Ein Jahr?«
»Das kann ich dir nicht sagen.«
»Warum hier? Gab es in Boston keine Zimmer? Können sich Oberste kein eigenes Bett leisten?«
»Der Gouverneur glaubt, dass es in Cambridge sicherer ist als in Boston.«
Sicherer …
»Du hast also mit dem Gouverneur über ihre Unterkunft gesprochen?«
»Wir waren den halben Tag beim Gouverneur. Er hatte uns zum Essen eingeladen.«
Also deshalb hatte er so lange von Boston bis nach Hause gebraucht. Sie schauten den Jungen hinterher, die sich mit den großen, schweren Taschen abmühten. Die beiden Oberste unterhielten sich mit den Mädchen, während sie den Jungen zum Haus folgten. Zu Mary Gookins Betroffenheit und Verärgerung kam plötzlich eine viel heftigere Gemütsregung hinzu: Angst.
»Und warum glaubt der Gouverneur, dass Cambridge sicherer ist als Boston?«, fragte sie stockend.
»Weil es in Boston von Schurken und Royalisten nur so wimmelt. Hier sind sie unter Gottgefälligen.«
»Dann sind das also keine Besucher aus England, sondern … Flüchtlinge?« Er antwortete nicht darauf. »Wovor sind sie denn auf der Flucht?«
Gookin nahm sich Zeit für seine Antwort. Als er endlich sprach, waren die Männer im Haus verschwunden. »Sie haben den König getötet«, sagte er leise.
KAPITEL 2
In England war es kurz vor neun Uhr abends. Die Sonne ging gerade unter, und Isabelle Hacker ritt in ihr Heimatdorf Stathern in Leicestershire. Nach zwei Tagen auf der Straße war das schlichte blaue Quäkerkleid mit einer braunen Staubschicht überzogen.
Ein anderer Reiter folgte ihr dichtauf. Seine ständige Nähe und seine Schweigsamkeit zermürbten sie. Er war ihr von London den ganzen Weg nach Norden gefolgt. Auch als sie ihre Reise für die Nacht unterbrachen, hatte er kaum ein Wort an sie gerichtet. In seiner Tasche führte er eine drei Tage zuvor vom Oberhaus ausgefertigte Vollmacht mit sich. Die hatte er vorgezeigt, als er in London an ihre Tür geklopft hatte: Hierauf wird angeordnet, dass Oberst Hacker unverzüglich seine Frau aufs Land zu entsenden habe, um das in Rede stehende Todesurteil zu holen, und dass ihr der Gentleman Usher des Oberhauses zu diesem Zwecke einen Begleiter mit auf den Weg gebe.
»Und dieser Begleiter bin ich«, hatte er gesagt.
Mrs Hacker hatte sich sofort bereit erklärt, zusammen mit dem Mann aufs Land zu reiten. Sie würde alles tun, um ihrem Mann zu helfen, den man wegen Verdachts auf Hochverrat in den Tower gesperrt hatte. Die dafür vorgesehene Strafe war ein Tod, der mit kaum vorstellbarer langwieriger Grausamkeit vollzogen wurde: Man wurde gehenkt, bis man das Bewusstsein verlor, dann vom Strick geschnitten und wiederbelebt, anschließend entmannt und ausgeweidet. Die Eingeweide wurden vor den Augen des noch lebenden Opfers verbrannt, dann wurde der Kopf vom Rumpf getrennt und dieser gevierteilt und öffentlich zur Schau gestellt. So unvorstellbar das auch war, standen ihr dennoch unablässig die quälenden Bilder vor Augen. Fast das Schlimmste war, dass er diese Welt unter solch unermesslichen Schmerzen verlassen würde und sie seinen Leib danach nicht einmal begraben konnte.
Sie hatte sich von ihren Kindern verabschiedet, und keine Stunde später waren sie auf der Straße. Immer wieder hatte sie ihren Begleiter verstohlen beobachtet und schätzte ihn auf etwa vierzig, ein paar Jahre jünger als sie selbst. Er humpelte kaum wahrnehmbar. Sie vermutete, dass die Behinderung von einem Geburtsfehler herrührte. Er hatte einen breiten Oberkörper, kurze Beine und eine eigentümlich leise Stimme, wenn sie sie denn einmal zu hören bekam. Sein Name sei Richard Nayler, hatte er gesagt. Sie nahm an, dass er ein Bediensteter des Kronrats war. Er war ein guter Reiter. Das war alles, was sie über ihn sagen konnte.
Es war ein heißer Tag gewesen, und jetzt am Abend war es immer noch warm. Ein paar Dorfbewohner gingen auf der Straße spazieren, andere saßen an ihren kleinen Häusern untätig vor dem Gartentor. Als sie das Klappern der Pferdehufe hörten, wandten sie den Kopf, sahen die Neuankömmlinge kurz an und dann schnell wieder zur Seite. Leute, die noch im Monat zuvor den Hut gezogen oder die Hand gehoben hätten, waren offenbar so empört, oder so verängstigt, dass sie Isabelle Hacker nicht grüßten. Sie mochte eine fromme Quäkerin und die Herrin des Gutshauses sein, aber sie war auch die Frau eines Revolutionärs. Sie schaute verächtlich auf sie hinab.
Stathern Hall, das stattlichste Haus im Dorf, befand sich neben der Kirche St. Guthlac. Das Läuten zur neunten Stunde verklang gerade, als sie von der Straße abbog und durch das offene Tor auf das Anwesen ritt. In den Wochen ihrer Abwesenheit, während der sie um Unterstützung für den Oberst geworben hatte, hatte im Gemüsegarten das Unkraut die Oberhand gewonnen. Aus dem Gras des Obstgartens war eine wuchernde Wiese geworden. In der Abenddämmerung machte das große, dunkel aufragende Haus einen verlassenen Eindruck.
Ihr Pferd trabte die Auffahrt hinauf zum Haus. Sie stieg ab, schlang die Zügel um das Eisengeländer neben dem Eingang und nahm, ohne sich zu dem hinter ihr absteigenden Nayler umzuschauen, den Schlüssel aus ihrer Tasche und schloss die schwere Tür auf. Sie wollte ihren Begleiter so schnell wie möglich wieder loswerden.
Sie betrat die geflieste Diele und rief nach oben in die widerhallende Stille. Sogar die Bediensteten hatten sich davongemacht. Als ihr Begleiter hinter ihr durch die Tür trat, fiel sein Schatten schwach in die Diele. Auf dem Weg zum Arbeitszimmer ihres Mannes hörte sie, wie Nayler ihr mit hastigen Schritten folgte, fraglos in der Absicht, jedem verzweifelten Akt der Zerstörung zuvorzukommen. Die Luft im Haus war stickig. In den Bäumen vor den Bleiglasfenstern sangen Nachtigallen. Sie hob einen kleinen Kasten aus einer Schublade, entnahm ihm einen Schlüssel und kniete sich damit vor das Tresorschränkchen. Sie hatte keine Vorstellung, was genau in dem Dokument stand, wusste aber, wie es aussah. Gib es ihm, rette Francis vor dem Henker, vor dem Schlächter, und dann hinaus mit ihm.
*
Bis zu diesem Augenblick war Nayler nicht davon überzeugt gewesen, dass das Schriftstück überhaupt noch existierte. Seit elf Jahren hatte es niemand mehr zu Gesicht bekommen. Seiner Erfahrung nach erzählten verzweifelte Männer alles Mögliche, um Zeit zu schinden – und Oberst Hackers Lage war in jeder Hinsicht verzweifelt. Aber jetzt kniete seine freudlose Frau auf dem Boden, wandte ihm in der düsteren Kammer ihren schmalen Rücken zu und kramte in den Besitzurkunden, Haushaltsbüchern und anderen Papieren herum. Schließlich zog sie etwas hervor, was er nicht genau erkennen konnte, und stand langsam wieder auf.
Er hatte etwas erwartet, falls es denn existierte, was wie ein erhabenes Stück Pergament im Stil eines vom Parlament beschlossenen Gesetzes aussah: der Bedeutung des Verbrechens angemessen. Aber was sie in Händen hielt, war ein albernes kleines, gut spannengroßes Etwas, das wie die zusammengerollte Kaufurkunde für ein Pferd oder ein Fass Wein aussah und mit einem zerfransten schwarzen Band zusammengebunden war. Allerdings war es für seine Größe vielversprechend schwer. Pergament, kein Papier. Er wog es in der Hand, ging damit zum Fenster, löste in dem trüben Licht das Band und entrollte es zu seiner ganzen Breite von zwei Spannen: das Todesurteil für Karl Stuart, König von England, Schottland und Irland, das Oberst Francis Hacker, dem für die Bewachung des Königs verantwortlichen Offizier, am Morgen von Seiner Majestät Hinrichtung von Oliver Cromwell höchstpersönlich ausgehändigt worden war.
Nayler legte das Schriftstück auf den Schreibtisch des Obersts, wo es sich sofort wieder zusammenrollte – wie eine Schlange, die sich gegen einen Angriff wappnete. Er setzte sich, nahm den Hut ab, legte ihn auf eine Seite des Schreibtischs und wischte sich am Mantel die Hände ab.
»Ich brauche mehr Licht, Mrs Hacker. Wenn Ihr so freundlich wärt.«
Sie ging in der Diele zu der Truhe, wo die Kerzen aufbewahrt wurden. Mit ihren zitternden Fingern brauchte sie eine Weile, bis aus Feuerstein und Stahl die Funken schlugen. Als sie mit zwei Kandelabern in das Arbeitszimmer zurückkehrte, saß Nayler genauso da, wie sie ihn verlassen hatte: regungslos am Schreibtisch neben dem Fenster, die Silhouette seines Kopfs vor violettem Licht. Sie stellte die Leuchter ab. Er zog sie wortlos zu sich heran und entrollte das Pergament.
Die Niederschrift, stellte er interessiert fest, war voller Löschungen und Einfügungen. Was hatte das zu bedeuten, fragte er sich. Vielleicht Hast. Verwirrtheit. Sinneswandel? Er begann laut zu lesen – mehr um selbst den Sinn richtig zu verstehen, weniger um Isabelle Hacker, die ihn gespannt ansah, mithören zu lassen.
»›Da Karl Stuart, König von England, wegen Hochverrats und anderer schwerer Verbrechen überführt, ergriffen und verurteilt ist und das Urteil am vorigen Samstag von diesem Gericht verkündet wurde, ist jenes mittelst Enthauptung zu vollziehen. Besagtes Urteil ist auf offener Straße vor dem Whitehall-Palast am dreißigsten Tage des Januars zwischen der zehnten Stunde des Morgens und der fünften Stunde des Nachmittags zu vollstrecken …‹«
Die schrecklichen, folgenschweren Worte verschlugen ihm die Sprache. Er musste sich räuspern und schlucken, bevor er fortfahren konnte.
»›… und zu diesem Zwecke diene dies als hinreichende Ermächtigung. Sie verlangt von allen Offizieren, Soldaten und anderen aufrechten Männern des Landes England, Euch bei dieser Aufgabe zu unterstützen. Höchstselbst unterzeichnet und besiegelt von …‹« Er hielt inne. »Hier stehen die Namen.« Er überflog die etwa fünfzig Unterschriften, die in sieben Spalten unter dem Text standen. Neben jedem Namen befand sich ein rotes Wachssiegel. Sie besudelten das Schriftstück wie Blutstropfen.
»Und der Name meines Mannes ist nicht dabei?«
Er überflog wieder die Unterschriften. Hier und da hielt er die Kerze näher an einen Namen. Gregory Clements. Edmund Ludlow. Thomas Harrison. William Goffe.
»Nein. Er hat nicht unterschrieben.«
Sie atmete tief durch. »Wie ich Euch gesagt habe. Er sagt die Wahrheit. Er war keiner der Richter des Königs, und er hat auch das Todesurteil nicht unterschrieben.«
»Das nicht, aber sein Name steht trotzdem hier. ›An Oberst Francis Hacker, Oberst Huncks und Oberstleutnant Phayre.‹« Er drehte das Pergament um und deutete auf eine Stelle. »Der Befehl ist sogar zuallererst an Euren Mann gerichtet. Weshalb sich das Schriftstück vermutlich auch in seinem Besitz befindet.«
»Aber nur in seiner Eigenschaft als Soldat«, wandte sie ein. »Als eines Offiziers, der hier nur Befehlen gehorcht und diese nicht etwa erteilt.«
»Das muss das Gericht entscheiden.« Für den Fall, dass sie Anstalten machen sollte, ihm das Dokument zu entreißen, zog er es schnell zurück. Hacker hatte die Hinrichtung überwacht: Seine Schuld war schwarz auf weiß erwiesen. Genauso gut hätte sie ihm die Henkersschlinge für ihren Mann aushändigen können. Sie schien das plötzlich zu begreifen, jedenfalls stand sie mit einem Gesicht so weiß wie das Kerzenwachs leicht schwankend neben dem Schreibtisch. Er wollte sie möglichst schnell loswerden, damit er das Dokument in Ruhe studieren konnte. Sie hatte ihre Rolle gespielt. »Es ist schon spät, Mrs Hacker. Ihr solltet Euch zurückziehen.« Er schaute zu der Polsterbank, die in der Ecke des Raums stand. »Ich werde die Nacht hier verbringen und dann beim ersten Tageslicht aufbrechen.«
Sie weigerte sich, den Schicksalsschlag einfach hinzunehmen. Die Plötzlichkeit, die Grausamkeit, nachdem sie zwei Tage im Sattel gesessen hatte. »Wir haben alles getan, was Eure Lordschaften verlangt haben, Mr Nayler. Das muss doch zählen.«
»Das zu entscheiden ist nicht an mir. Ich schlage vor, Ihr zieht Euch für die Nacht zurück und betet für Euren Mann.« Seinen Mund umspielte ein leises Lächeln. »Was auch immer geschieht, letzten Endes ist es Gottes Wille.«
Wie oft in den letzten elf Jahren hatte er diesen frömmlerischen Spruch gehört? Mal sehen, wie ihnen das jetzt gefiel.
Sie sah ihn weiterhin an und gestattete ihm nicht, ihrem Blick auszuweichen. Diesem Menschen genügte es nicht, die Feinde des Königs einfach nur zur Strecke zu bringen, einzukerkern und hinzurichten. Er musste sich auch noch über ihren Glauben lustig machen. Aber der Teufel zuckte in seinem Triumph nicht mit der Wimper. Er hielt ihrem Starren stand, bis sie sich schließlich umdrehte, auf unsicheren Beinen das Arbeitszimmer verließ und die Treppe hinauf in ihre Schlafkammer ging, wo sie ohnmächtig zu Boden stürzte.
Trotz der langen Reise verspürte Nayler weder Hunger noch Durst. Das Dokument war ihm Speis und Trank genug. Er setzte sich wieder an den Schreibtisch des Obersts und las das Todesurteil noch einmal durch. Mittelst Enthauptung … auf offener Straße vor dem Whitehall-Palast … Die Worte hatten immer noch eine schockierende Kraft. Er öffnete den Mantel, schnürte sein Hemd auf und senkte den Kopf, um das Lederband abzunehmen, das er seit elf Jahren um den Hals trug. Daran befestigt war ein kleiner Beutel. Darin befand sich ein winziger blutbefleckter Leinenfetzen. Er drehte ihn zwischen den Fingern hin und her.
Er erinnerte sich an alles an jenem Tag im tiefen Winter – wie er sich bei Tagesanbruch aus dem Essex-Haus schlich; an den von der Themse heraufwehenden, bitterkalten Wind; wie er die Strand entlangeilte, vorbei an den großen Herrenhäusern, die hinten an den Fluss angrenzten; an den alten Dolch und die Pistole, die er unter seinem Umhang spürte. All das war ihm unwirklich vorgekommen. Einem gesalbten König den Kopf abschlagen? Unfassbar. Barbarisch. Ein Sakrileg. Das würde die Armee niemals in die Tat umsetzen. Dafür würde entweder der Befehlshaber der Parlamentsarmee General Fairfax sorgen, oder die Royalisten, die sich in der Stadt versteckt hielten, würden sich erheben, um das zu verhindern. Sollte man ihm den entsprechenden Befehl erteilen, so war er jedenfalls bereit, sein Leben für die Rettung des Souveräns zu opfern.
Dann war er am Charing Cross in Richtung Whitehall-Palast abgebogen, und seine Hoffnungen fielen in sich zusammen. Die Menge in der King Street, die fünf- oder sechshundert Menschen zählte, mochte zwar durchaus ausreichen, hier Unruhe zu stiften, aber die Soldaten – mindestens tausend – waren eindeutig in der Überzahl. Die Pikeniere standen Schulter an Schulter und hielten das Volk zurück. Dahinter sperrte Kavallerie die Mitte der breiten Straße ab und vereitelte jeden Versuch, zum Schafott vorzudringen. Das provisorische, in schwarzes Tuch gehüllte Holzgerüst grenzte an das Banketthaus. Von der Straßenseite führten keine Stufen hinauf. Auf das Podest gelangte man vielmehr durch ein Fenster im ersten Stock. Ein methodischer Verstand, das sah er sofort, ein militärischer Verstand, hatte das alles sehr sorgfältig geplant.
Er bahnte sich seinen Weg durch den Pöbel. Von der Feiertagsstimmung, die sonst bei Hinrichtungen herrschte, war nichts zu spüren. Sogar die radikalsten Republikaner, die Levellers, erkennbar an den meergrünen Bändern an Mantel und Hut, hielten ausnahmsweise den Mund. Er bewegte sich hinter der schweigenden Menge an der Wand entlang, die den Whitehall-Palast vom Tilt Yard trennte. Um besser sehen zu können, standen die Leute auf der Mauer oder saßen beinebaumelnd darauf. Er entdeckte eine Lücke und rief nach oben, damit man ihn hinaufklettern ließ. Weil sich niemand rührte, packte er den Nächstbesten am Bein und drohte, ihn herunterzureißen, sollte er nicht zur Seite rücken. Nayler hatte die Statur eines Ringers. Man rückte zur Seite.
Jetzt konnte er ziemlich gut über die Köpfe der Schaulustigen und Soldaten hinwegschauen. Das Schafott befand sich in etwa dreißig Schritt Entfernung. Die Fenster im Banketthaus waren verrammelt bis auf jenes im ersten Stock, das den Zugang zum Gerüst ermöglichte. Von Zeit zu Zeit trat ein Offizier heraus und drehte eine Runde auf dem Podest. Nach einem prüfenden Blick auf die Menge stieg er dann wieder aus der Kälte hinein ins Gebäude, und das Fenster schloss sich hinter ihm. In der Mitte des Gerüsts befanden sich fünf kleine Gegenstände, und es dauerte einige Zeit, bis Nayler begriff, wozu sie dienten. Bei einem handelte es sich um einen sehr niedrigen hölzernen Hackblock, kaum höher als eine Männerhand breit, neben dem im Boden zu beiden Seiten Eisenringe verankert waren, und weiter hinten befanden sich noch zwei dicht nebeneinander liegende Bodenringe. Ihr Zweck bestand sichtlich darin, den König, während man ihm den Kopf abhieb, bäuchlings an Händen und Füßen zu fixieren, damit er sich nicht wehren konnte, wenn nicht gar gestikulierend die Menge aufstacheln. Wieder einmal gründlich durchdacht. Barbarisch.
Der Tag wurde nicht wärmer. Nicht ein einziger Sonnenstrahl milderte den eisernen Frost. Gelegentlich wirbelten ein paar Schneeflocken durch die Luft, aber sonst lastete der graue Himmel so schwer auf allem, als wollte er jegliche Farbe aus den Gebäuden pressen. Die Zeit wirkte wie eingefroren. Nayler steckte die Hände in die Taschen und trat beständig von einem Bein aufs andere, damit seine Glieder nicht taub wurden. Schließlich schlug eine halbe Meile südlich die Glocke der Westminster-Abtei zur neunten Stunde. Die alte Beinverletzung schmerzte Nayler, als steckte im Knochen ein Messer. Sein Geist wurde so stumpf wie der Himmel. Es gab nur den Schmerz im Bein, die Kälte und das Grauen. Eine weitere Stunde verstrich. Er zählte die zehn Glockenschläge, und kurze Zeit später vernahm er ein leises Trommeln, das irgendwo hinter ihm im St.-James-Park erklang: ein bedächtiger Trauermarsch. Kurz darauf verstummte der Marsch.
Er schaute nach rechts zum Holbein-Tor. Oberhalb des Bogens führte ein geschlossener Gang quer über die Straße zum Banketthaus. Hinter den gekuppelten Fenstern erschienen Gestalten: erst die von Soldaten, dann die eines kleineren Mannes mit vertrautem Profil, der sich kurz zur Seite wandte und hinunter auf die Menschenmenge und das Schafott schaute, dann zwei Geistliche, und schließlich wieder Soldaten. Im Augenblick des Erkennens schien alle Luft aus Nayler zu entweichen. Kurz darauf verschwand die Prozession. Aber auch andere hatten ihn gesehen. Die Neuigkeit verbreitete sich schnell. »Er ist da!«
Weiterhin geschah nichts. Es schlug elf Uhr. Dann Mittag. Und mit jeder verstreichenden Minute lebte gegen alle Vernunft Naylers Hoffnung wieder auf. Gerüchte über die Gründe für die Verzögerung schwirrten durch die Menge: das in diesem Augenblick tagende Unterhaus würde das Urteil aufheben; der König hätte seiner Abdankung zugunsten seines Sohnes zugestimmt; die Holländer hätten für eine Begnadigung eine halbe Million Pfund geboten. Er wollte sich nicht vorstellen, welche Gedanken Seiner Majestät im Banketthaus gerade durch den Kopf gehen mochten. Schrecklich genug, dass man einen Menschen enthauptete; über alle Maßen grausam hingegen die Verlängerung seines Martyriums.
Es schlug eins und dann, kurz vor zwei, bewegte sich etwas. Das Fenster wurde geöffnet, und eine Reihe Soldaten nebst Offizieren traten ins Freie, gefolgt vom Henker und seinem Gehilfen, die beide einen langen schwarzen Wollumhang und schwarze Beinlinge trugen und deren Gesicht unter einer schwarzen Maske, schlecht sitzender grauer Perücke und falschem Bart verborgen war. Der kleinere der beiden Männer trug ein Beil, dessen langer Stiel auf seiner breiten Schulter ruhte. Hinter ihm erschien ein Bischof mit aufgeschlagenem Gebetbuch.
Als Letzter trat der König aus dem Fenster – eine schmächtige Gestalt, barhäuptig, kaum fünf Fuß und drei Zoll groß, obwohl er sich auch in seinen letzten Minuten wie stets aufrecht wie ein Riese hielt. Er ging geradewegs zu dem niedrigen Henkersblock, und offensichtlich beschwerte er sich bei seinen Offizieren über die Ehrverletzung, bei seiner Hinrichtung auf dem Bauch liegen zu müssen. Sie sahen sich an und schüttelten den Kopf. Der König wandte ihnen den Rücken zu. Unter seinem Umhang zog er ein kleines Stück Papier hervor und trat an den Rand des Schafotts. Er schaute hinunter zu den Soldaten, der Kavallerie und den Menschen dahinter und begriff anscheinend, dass seine Stimme die Menge nicht erreichen würde. Also ging er zurück zur Mitte des Gerüsts und las die Rede seinen Offizieren vor. Nayler verstand kein einziges Wort, aber der Wortlaut war bis zum nächsten Tag auf Flugblätter gedruckt worden, die man auf Londons Straßen allenthalben erstehen konnte. Hätte ich den Weg der Willkür eingeschlagen und alle Gesetze geändert nach Maßgabe der Macht des Schwertes, hätte ich heute nicht hierherkommen müssen. Deshalb sage ich Euch (und ich bete zu Gott, dass dies nicht Euch zur Last gelegt werde), dass ich der Märtyrer des Volkes bin …
Der König öffnete den Umhang und legte ihn ab. Dann zog er seinen Rock aus und übergab ihn zusammen mit einigen glitzernden Schmuckstücken dem Bischof. Er stand im weißen Hemd in der Eiseskälte und steckte seine langen Haare unter eine Kappe. Er zitterte nicht. Er sagte etwas zum Henker und deutete wieder protestierend auf den Henkersblock, zuckte die Achsel, ging auf die Knie, legte sich dann der Länge nach auf den Boden und bewegte den Kopf auf dem Block hin und her, bis er bequem lag. Er streckte die Arme nach hinten. Der Henker stellte sich breitbeinig auf, hob das Beil und holte über die Schulter so weit aus, wie es ihm möglich war. Es vergingen ein paar Augenblicke, dann machte der König eine Geste mit seinen Händen, eine kurze, anmutige Bewegung, als wollte er zu einem Kopfsprung ansetzen, und das Beil fuhr mit solcher Wucht herab, dass der Hieb in der Stille über die ganze Whitehall hinweg zu hören war.
Das Blut schoss aus dem abgetrennten Torso. Der Soldat daneben drehte sich zur Seite, um dem Schwall auszuweichen, der sich jedoch schnell zu einem steten Blubbern wie bei einem hochkant gestellten Fass beruhigte. Der Henker, der nach wie vor das Beil in der einen Hand hielt, packte mit der anderen den Kopf an den Haaren, ging an den Rand des Gerüsts und zeigte der Menge das Gesicht des Königs. Er rief etwas, aber seine Worte verloren sich im lauten Gebrüll der Zuschauer, eine Mischung aus Jubel, Grauen und Bestürzung. Ein Teil der Menge drängte nach vorn, durchbrach die Reihen der abgelenkten Pikeniere, die sich ebenfalls dem Spektakel zugewandt hatten, und lief zwischen den Pferden der Kavallerie hindurch. Nayler sprang von der Mauer und humpelte über die Whitehall hinter ihnen her.
Das Blut sickerte durch die Ritzen zwischen den Holzbohlen. Es klatschte auf den Boden wie die schweren Regentropfen, die ein nahes Unwetter ankündigten. Die drängelnden Menschen schlitterten um ihn herum. Er hielt sein Taschentuch in die Höhe und sah, wie es sich mit purpurroten Punkten einfärbte – einmal, zweimal, dreimal sogen sich die Tropfen in das Leinengewebe, zerflossen und bildeten schließlich einen einzigen Fleck. Nayler kämpfte sich durch die Menschentrauben die Whitehall hinauf in den Winternachmittag und ging dann durch die Strand bis zur Kapelle vom Essex-Haus, wo sein Herr, der Markgraf von Hertford, und seine Familie am Altar knieten und auf Nachricht warteten.
*
Das getrocknete Blut des Märtyrers hatte im Lauf der Jahre eine ausgebleichte rostige Farbe angenommen. Eines Tages würde es vielleicht ganz verschwinden. Aber solange es existierte, hatte Nayler geschworen, würde er alles in seiner Macht Stehende tun, die Ereignisse an jenem Januartag zu rächen. Er küsste das Stück Stoff, faltete es sorgfältig zusammen, steckte es zurück in den Beutel, verknotete das Band und hängte sich die Reliquie wieder um den Hals, sodass sie sich ganz nah an seinem Herzen befand.
Abgesehen vom Flackern der Kerzenleuchter, war es im Arbeitszimmer inzwischen dunkel. Das Vogelgezwitscher draußen vor dem Fenster war verstummt.
Er zählte die Unterschriften auf dem Todesurteil und kam auf neunundfünfzig. Einige bekannte Namen, einige unbekannte. Aber seit er ihren Spuren die letzten zehn Wochen anhand der verstaubten Prozessaufzeichnungen folgte, waren sie ihm vertraut. Und dennoch war es die eine Sache, zu wissen, ob dieser oder jener an diesem oder jenem Tag in der Westminster-Halle über Karl Stuart zu Gericht gesessen hatte; eine ganz andere Sache hingegen, zu beweisen, ob an den Händen eines Betreffenden tatsächlich Blut klebte. Das Todesurteil schließlich war ein unbestreitbarer Schuldbeweis. Der aalglatte Oberst Ingoldsby beispielsweise hatte bereits zugegeben, unterschrieben zu haben, allerdings darauf beharrt, unter Zwang gehandelt zu haben. Cromwell habe sich über seine Zimperlichkeit lustig gemacht, ihm die Feder gewaltsam zwischen die Finger gesteckt und dann seine Hand geführt. Aber hier in der fünften Spalte stand Ingoldsbys Name, die Unterschrift klar und deutlich und anscheinend ohne Eile niedergeschrieben, daneben das ordentlich platzierte Siegel.
Er widmete sich nun den Namen oben in der ersten Spalte. Die erste Unterschrift war die von John Bradshaw, der zum Gerichtspräsidenten beförderte Gelegenheitsanwalt, der sich so sehr vor einem Attentat fürchtete, dass er während des Prozesses eine Rüstung unter seiner Robe und einen mit Stahl ausgekleideten, kugelsicheren Biberfellhut trug. Zu seinem Glück war er seit fast einem Jahr tot, würde seiner Strafe also entgehen. Die zweite Unterschrift war die von Thomas Grey – Lord Grey von Groby, der »Leveller Lord« – ein Mann, der selbst Cromwell zu radikal war, weshalb er ihn schließlich ins Gefängnis werfen ließ. Auch er war tot. Der dritte Unterzeichner war Cromwell selbst, der wahre Architekt des gesamten diabolischen Unternehmens – tot, natürlich, und in der Hölle schmorend. Die vierte Unterschrift jedoch, direkt unter der von Cromwell, gehörte einem Mann, der, soweit Nayler wusste, noch am Leben war – ein Mann, den zu kennen er guten Grund hatte.
Er musste eine neue Liste anlegen.
Er nahm ein Blatt Papier von Hackers Schreibtisch, tauchte die Feder in das Tintenfass und schrieb mit seiner sorgfältigen Handschrift: Col. Edw. Whalley.
KAPITEL 3
Die drei Jungen der Gookins teilten sich ein Zimmer im hinteren Teil des Hauses. Von dort überblickte man das Dorf Cambridge, die dahinter aufragenden Dächer, die breiten Kamine und die dünne Turmspitze von Harvard College, die in der Spätnachmittagssonne wie eine Lanze golden glänzte. Als Mary in das Zimmer eilte, standen Oberst Whalley und Oberst Goffe am Fenster und begutachteten die Aussicht, so wie Daniel, Sam und Nathaniel die beiden Männer begutachteten. Zu Füßen der beiden Männer lagen zwei Taschen, anscheinend ihre alten Armeetaschen. Mary fiel auf, wie zerkratzt das Leder war, wie sehr an vielen Stellen geflickt und ausgebessert. Spärliches Gepäck für eine Reise um die halbe Welt, dachte sie. Sie müssen Hals über Kopf geflohen sein.
»Geht nach unten, Jungs, lasst die Gentlemen in Ruhe.«
»Aber Mama …«
»Ab nach unten!«
Sie stampften maulend die Treppe hinunter.
»Das ist seit ihrer Geburt das Zimmer der Jungen«, sagte Mary. »Was Mr Gookin Euch auch versprochen haben mag … Verzeiht, aber ich glaube, die Jungen sollten ihr Zimmer behalten.«
»Feine Burschen sind das«, sagte Oberst Whalley. »Sie erinnern mich an meine eigenen in dem Alter.« Er wandte sich vom Fenster ab. Zum ersten Mal konnte sie sein Gesicht aus nächster Nähe betrachten: die kräftige Nase, die dunklen Augen, den grauen, von schwarzen Strähnen durchzogenen Bart. »Wir würden nie von Euch verlangen, uns ihre Betten abzutreten.«
»Ich möchte nicht ungastlich erscheinen …«
»Keine Ursache.« Er schaute zur Decke. »Was ist da oben? Der Speicher?«
»Da oben ist nur ein Dienstbotenzimmer.«
»Ihr habt einen Bediensteten? Ich habe keinen gesehen.«
»Im Augenblick nicht«, sagte sie. »Aber der Speicher ist überhaupt nicht behaglich.«
»Nach dem Schiff wird er uns wie ein Palast vorkommen.«
Die beiden Soldaten schwangen sich die Taschen über die Schultern. Oberst Whalley war eindeutig ein Gentleman von Geburt: ein höflicher, an Rücksichtnahme gewohnter Mensch, dem man nur schwer etwas abschlagen konnte. Sie zögerte, da ihr aber kein weiterer Einwand einfiel, glaubte sie keine andere Wahl zu haben, als sie hinaus in den Gang und die schmale Treppe hinaufzuführen.
Der Speicher verlief über die Länge des Hauses. Die Decke bildete den Winkel des Daches ab. Whalley war groß – etwa einen Kopf größer als sein Schwiegersohn – und konnte nur in der Mitte des Raums aufrecht stehen, und als er nun zum Fenster ging, musste er sich selbst dort ducken, damit er mit dem Kopf nicht gegen die Querbalken stieß. Er öffnete den Riegel, lehnte sich hinaus, schaute hierhin und dorthin und zog den Kopf wieder zurück.
»Perfekt. Wir werden uns hier oben äußerst wohlfühlen. Was meinst du, Will?«
»Und ob. Zumindest werden wir Euch nicht im Weg herumstehen, Mrs Gookin. Wir bedauern sehr, Euch diese unerwarteten Umstände zu bereiten.«
Sie schaute sich skeptisch in dem schmalen, beengten Speicher um. Es gab hier nur ein Holzbett, dessen Strohmatratze sie sich würden teilen müssen. Und für Whalley war es zudem zu kurz. Bestimmt würden seine Füße über das Ende hinausragen. Im Halbdunkel am anderen Ende des Raums standen allerlei nicht mehr benutzte Möbelstücke. Unter anderem ein alter Stuhl und eine Truhe. Sie gab sich geschlagen.
»Nehmt Euch, was Ihr braucht. Ich werde die Mädchen mit Bettzeug und Decken schicken.«
»Sehr freundlich.« Oberst Whalley stand schon wieder am Fenster. Er nahm ein kleines Fernrohr aus seinem Mantel, zog es auseinander, stellte es scharf und suchte den Fluss ab. »Die Brücke wird die Wegzeit von Boston hierher deutlich verkürzen. Das sind sicher dreißig Mann, die da arbeiten. Wann soll sie fertig sein?«
»In einem halben Jahr, heißt es.«
»Also im Januar.« Die Antwort schien ihn zufriedenzustellen. »Perfekt«, sagte er noch einmal und schob das Fernrohr zusammen.
*
Daniel Gookin lag in ihrer Schlafkammer auf dem Bett, die Arme weit ausgebreitet, die Augen geschlossen, und schlief fest. Er hatte sich nicht die Mühe gemacht, die Stiefel auszuziehen. Er war jetzt achtundvierzig und dünner, als sie ihn in Erinnerung hatte. Die ergrauenden Schläfen ließen ihn distinguierter aussehen. Plötzlich spürte sie ihre große Liebe für ihn. Die beiden Oberste waren nicht die Ersten, deren er sich erbarmt hatte, und würden sicher nicht die Letzten sein. Sogar Indianer aus der Gegend hatten schon unter ihrem Dach geschlafen. Gookin hatte sich dem Anliegen verschrieben, sie die Heilige Schrift zu lehren. Schwächen wie die seinen kamen nur aus einem guten Herzen. Sie kniete sich am Fußende des Bettes auf den Boden und löste die Schnürsenkel seiner Stiefel. Er spürte die Bewegung und öffnete die Augen, hob den Kopf und sah sie an.
»Lass die Stiefel und leg dich neben mich.«
»Zügelt Eure Ungeduld, Mr Gookin.« Sie schnürte den einen Stiefel auf, fasste ihn an der Hacke und zog ihn vom Fuß und widmete sich dann dem anderen Stiefel. Während seiner Abwesenheit hatte sie die Wechseljahre durchgemacht. Sie würde keine Kinder mehr bekommen, wofür sie Gott dankte. Fünfzehn Schwangerschaften waren mehr als genug gewesen. Sie hob das Kleid und stieg aufs Bett.
Zehn Minuten später hörten sie über sich einen dumpfen Schlag, dann noch einen und schließlich das scharrende Geräusch eines schweren Gegenstands, der über den Boden gezogen wurde.
Gookin schaute zur Decke. »Hast du sie im Speicher untergebracht?«
»Sie wollten es so. Hast du etwas dagegen?« Sie stieg aus dem Bett und suchte ihre Unterkleider zusammen.
»Nein, wenn sie damit zufrieden sind.«
»Wenn du sie so magst, dann können sie auch hier bei uns schlafen, wenn dir das lieber ist.«
Er lachte und streckte die Hand nach ihr aus, aber sie drehte sich weg und zog sich weiter an.
Wieder ein dumpfer Schlag aus dem Speicher.
»Wie hast du sie kennengelernt, Dan?«
Er schwang die Beine aus dem Bett und setzte sich auf die Kante. »Erinnerst du dich an Reverend Hooke aus New Haven, der vor ein paar Jahren wieder zurück nach England gegangen ist?«
»Natürlich.«
»Seine Frau ist Oberst Whalleys Schwester. Als Hooke von meiner Absicht gehört hat, mit Kapitän Pierce nach Amerika zurückzufahren, hat er mich gebeten, auch für seinen Schwager eine Passage festzumachen. Und Ned hat dann Will überredet, auch mitzukommen. Der hat zunächst seiner jungen Familie wegen gezögert.«
»Und warum mussten sie so dringend das Land verlassen?«
»Um es kurz zu machen: Der Sohn des Königs kehrt auf Einladung des Parlaments auf den Thron zurück. Die Armee war mehrheitlich damit einverstanden, und damit ist England keine Republik mehr.«
Die Neuigkeit kam so überraschend und war so überwältigend, dass sie sich erst einmal sprachlos zu ihrem Mann auf das Bett setzen musste. Nach einigen Augenblicken sagte sie: »Warum hat die Armee dem zugestimmt?«
»Im Parlament ist ein neues Gesetz eingebracht worden, sie nennen es die Akte der Verzeihung. Die Vergangenheit soll ruhen. Alle, die gegen den toten König zu den Waffen gegriffen haben, werden amnestiert – mit einer Ausnahme: Alle Königsmörder, die am Prozess und an der Hinrichtung von Karl Stuart unmittelbar beteiligt waren, müssen sich stellen und aburteilen lassen.« Er nahm ihre Hand. »So ist die Lage, einfacher kann ich es nicht ausdrücken. Das war vor zehn Wochen. Unser Schiff war das erste, das mit dieser Nachricht in Boston eingelaufen ist. Das hatte ich dem Gouverneur sofort nach unserer Ankunft zu berichten.«
»Waren noch andere Königsmörder auf dem Schiff?«
»Nur die beiden.«
»Und die anderen?«
»Ein paar sind schon nach Holland geflohen. Die meisten halten sich aber noch in England versteckt. Einige haben wohl vor, sich zu stellen, und hoffen auf Gnade. Wir konnten gerade noch ablegen, bevor die Häfen geschlossen wurden. Jetzt noch zu entkommen wird schwer sein.« Er drückte fest ihre Finger, als könnte er so seine Kraft und seinen Glauben auf sie übertragen. »Es sind gute Männer, Mary. Ned ist ein Vetter von Cromwell. Er hat Cromwells Kavallerie befehligt und Will das Infanterieregiment. Sie brauchen einen Zufluchtsort, bis die Lage sich wieder beruhigt. Wir haben nichts zu befürchten. Niemand weiß, dass sie hier sind – außer dir, mir und der Gouverneur.«
»Oberst Whalley ist Cromwells Vetter? O Daniel!« Sie zog ihre Hand weg. »Die Lage wird sich nie beruhigen. Man wird sie ohne jeden Zweifel jagen. Nichts ist sicherer als das.«
Über ihnen wurde wieder ein Möbelstück verrückt. In Marys angstgetriebener Vorstellung hörte es sich an, als errichteten sie dort oben eine Barrikade.
*
Unten am Fluss hatten die Arbeiter ihr Tagewerk vollbracht. Die Ufer zu beiden Seiten lagen verlassen da. Das Wasser glitzerte einladend im Sonnenlicht. Ned stand wieder am Fenster und wurde von einem Gefühl der Zufriedenheit erfasst. Er mochte die Familie Gookin. Er mochte diesen Ort. In Amerika würde er sehr gut zurechtkommen.
Hinter ihm breitete Will ihr Waffenarsenal auf dem Bett aus: vier Luntenschlosspistolen, zwei Beutel Schießpulver, eine Schachtel Kugeln, zwei Dolche, zwei Schwerter. Seit sie das Haus betreten hatten, hatte er kaum ein Wort gesprochen.
»Lass das, Will.« Ned nahm zwei saubere Hemden aus seiner Tasche und warf eines davon Will zu. In den letzten vier Monaten waren sie ständig zusammen gewesen. Im Gesicht seines Schwiegersohns konnte er lesen, als schaute er durch eine Glasscheibe. Er sah alles, was ihm durch den Kopf ging. »Lass uns zum Fluss hinuntergehen, das Salz vom Leib schrubben. Wird uns guttun.«
Will schaute ihn fragend an. »Und wenn man uns sieht?«
»Da ist niemand, der uns sehen könnte. Und wenn, was soll’s? Wir sind bloß zwei Männer, die baden.«
»Sollten wir Gookin nicht vorher fragen?«
»Er ist unser Gastgeber, nicht unser Gefängniswärter. Der Gouverneur hat gesagt, es sei hier sicher, wir könnten uns frei bewegen.« Er trat einen Schritt vor, fasste Will am Unterarm und schüttelte ihn sanft. »Du wirst deine Frau und die Kleinen wiedersehen, meine geliebte Frances und meine Enkel, da bin ich mir sicher. Gott wird dem Triumph der Frevler nicht lange zuschauen. Wir müssen Geduld üben, und wir müssen glauben.«
Will nickte. »Du hast recht. Verzeih mir.«
»Gut.« Ned ließ seinen Arm los.
Zusammen verstauten sie die Waffen in der Truhe, legten eine Decke darüber und gingen dann, Ned voraus, die Stufen hinunter. Die Türen der beiden gegenüberliegenden Schlafkammern im Gang unter dem Speicher waren geschlossen.
Mary saß auf dem Bett und hörte das Knarzen der Dielen. Sie sah zu ihrem Mann. »Was machen sie jetzt?«, flüsterte sie. Er hatte keine Ahnung und schüttelte den Kopf.
Die beiden Offiziere gingen durch die große Stube, hinaus in den Hof und dann durch das Tor hinunter zum Fluss.
Gookin war mit ihnen von Bord der Prudent Mary schnurstracks zum Haus des Gouverneurs gegangen. John Endecott war ein alter Mann, der mit seinem Spitzenkragen und der schwarzen Kappe auf Ned gewirkt hatte, als wäre jener dem England Königin Elisabeths entsprungen. Sie hatten ihre Einführungsschreiben überreicht – Wills stammte von John Rowe und Seth Wood, den Predigern in der Westminster-Abtei, Neds von Dr Thomas Goodwin von der Kirche der Independenten in der Fetter Lane. Während der alte Mann sich die Schreiben dicht vor die Augen hielt und sie studierte, hatte Ned ihm kurz die Umstände ihrer Abreise geschildert – wie sie sich in Gravesend zwei Tage lang unter Deck hatten verstecken müssen, während das gemeine Volk auf den Kais die baldige Rückkehr von Karl II., Sohn des toten Königs, feierte. Ihre Freudenfeuer ließen den Himmel über der Stadt in diabolischem Rot erglühen, und die Luft war vom Lärm der Zecher und dem Zischen brutzelnder Braten erfüllt. Die Feiern hatten bis schändlich spät in den Sabbat hinein angedauert. Als am Montag die Nachricht vom Parlament eintraf, dass sein Name und der von Will auf der Liste jener stünden, die als für die Ermordung Karls I. Verantwortliche gesucht würden, gab Kapitän Pierce den Befehl zum Auslaufen.
»Aber dank unserem guten Freund Mr Gookin hier waren auch wir an Bord«, schloss Ned.
»Ihr beide wart also Richter des Königs?«
»Ja, und wir haben sein Todesurteil unterzeichnet. Und ich sage es Euch offen, Mr Endecott, denn ich würde hier nie unter Vorspiegelung falscher Tatsachen leben wollen: Wir würden es morgen wieder tun.«
»Wahrhaftig!« Endecott legte die Schreiben zur Seite und musterte die beiden Besucher mit feucht verhangenen Augen, die so blassgrau waren wie Austern. Er umfasste die Kante seines Schreibtischs und erhob sich unter dem Knacken zahlreicher Gelenke. »Dann lasst mich die Hände schütteln, die jenes Urteil unterzeichnet haben, und Euch in Massachusetts willkommen heißen. Ihr werdet Euch inmitten guter Freunde bewegen.«
Sie suchten sich einen Platz etwas abseits der Straße, wo die Strömung einen Teil des Flussufers unterspült und so einen natürlichen Teich geschaffen hatte. Die Baumäste hingen hier fast bis auf die Wasseroberfläche herab. Jemand hatte ein Seil als Schaukel an einen dicken Ast gebunden. Eine lang gestreckte grüne Libelle, exotischer als alles, was sie in England je zu Gesicht bekommen hatten, schwirrte im Schilf herum. Nicht minder befremdliche Wandertauben gurrten im Blätterwerk. Ned zog seine Stiefel aus und steckte kurz den Fuß ins kühle Wasser, streifte dann seine salzstarre Kleidung ab und watete nackt in den Fluss. Er stieß einen lauten Schrei aus, so kalt war das Wasser, tauchte bis über die Schultern unter und hatte sich wenig später an die Temperatur gewöhnt. Will hatte die Stiefel und den Ledermantel ausgezogen, stand aber noch unschlüssig am Ufer. Ned watete zurück und spritzte ihm eine Handvoll Wasser ins Gesicht. Will lachte, hüpfte zur Seite und protestierte laut. Dann zog er sich schnell das Hemd über den Kopf und entledigte sich seiner restlichen Kleider.
Was für ein Bild sie wohl abgaben, dachte Ned, mit ihrem totenbleichen, vom Krieg gezeichneten Leib, Phantome inmitten saftigen Grüns. Er hatte Leichen gesehen, die besser aussahen. Ihre Haut war vorn wie hinten mit Striemen und Schnittwunden übersät. Über Wills Bauch verlief eine gezackte Linie, die aus der Schlacht bei Naseby von der Pike eines Royalisten stammte, er selbst hatte seit der Schlacht bei Dunbar, wo er vom Pferd gestürzt war, einen faustgroßen Krater unterhalb der rechten Schulter. Will stand am Wasser und hob die Arme über den Kopf. Mit zweiundvierzig war er immer noch so schmächtig wie ein Jüngling. Zu Neds Überraschung sprang er nun kopfüber in den Fluss, verschwand der Länge nach unter der Wasseroberfläche und tauchte Augenblicke später wieder auf.
Gab es ein köstlicheres Gefühl, als sich an einem Sommertag in frischem Wasser das getrocknete Salz von der verschwitzten Haut zu waschen? Gelobt sei Gott in all seiner Pracht, dass er uns zu diesem sicheren Ort geführt hat. Ned wühlte mit den Zehen im weichen Schlamm. Jahrelang hatte er nicht mehr geschwommen. Er war nie ein guter Schwimmer gewesen, schon als Knabe nicht. Aber jetzt breitete er die Arme aus und stürzte sich kopfüber ins Wasser, wo er sich dann auf den Rücken drehte. Katherine kam ihm in den Sinn, und ausnahmsweise bemühte er sich nicht, die Gedanken an sie zu verdrängen. Wo war sie jetzt? Wie ging es ihr? Vor vier Jahren hatte sie eine Fehlgeburt gehabt, war fast gestorben, und ihre Gesundheit und ihr Geist hatten sich nie richtig davon erholt. Was hatte es für einen Sinn, sich mit unerträglichen Spekulationen zu quälen, so wie es Will jede Nacht tat? Einer von ihnen musste stark bleiben. Sie hatten die Pflicht, am Leben zu bleiben, nicht für sich selbst, sondern für ihre Sache. Seine Bibelstelle, die Will schließlich davon überzeugte, sich ihm anzuschließen, war Christi Aufforderung an seine Jünger: Wenn sie euch aber in einer Stadt verfolgen, so fliehet in eine andere. Wahrlich, ich sage euch: Ihr werdet die Städte Israels nicht ausrichten, bis des Menschen Sohn kommet.
Als er sich wieder auf den Bauch drehte, war das Ufer plötzlich weit entfernt. Beim Zurückschwimmen spürte er die Strömung, die ihn hinaus in die Massachusetts-Bai ziehen wollte. Will stand mit in die Hüften gestemmten Armen bis zum Nabel im Fluss und beobachtete ihn. Ned trat auf der Stelle Wasser und winkte Will zu, da fiel ihm ein Mann auf, der hinter Will im Schatten der Bäume stand. Er konnte den Fremden nicht genau erkennen. Er war schwarz gekleidet, hatte dunkles Haar, einen kurzen dunklen Bart und stand vollkommen regungslos da. Kaum hatte Ned ihn bemerkt, stellte er fest, dass er wieder abtrieb. Die Strömung zerrte so stark an ihm, als könnte sie ihn, wenn er sich nicht dagegen wehrte, den ganzen Weg zurück nach England ziehen. Der Panik nahe, nahm er den Kopf herunter und schwamm mit aller Kraft in Richtung Ufer. Er zog die Arme durch und trat wie wild mit den Beinen. Als seine Füße schließlich den schlammigen Untergrund berührten und er sich wieder aufrichten konnte, war der Fremde verschwunden.
Er stolperte durch das Wasser und ließ sich atemlos und mit klopfendem Herzen ins Gras fallen. Will lief zu ihm, stand dann mit der Sonne im Rücken vor ihm und blickte lachend zu ihm hinunter. »Ich schwöre, in meinem ganzen Leben habe ich noch nie jemand derart schnell schwimmen sehen. Als wäre der Leviathan hinter dir her gewesen.«
Das hatte Ned schon lange nicht mehr erlebt: einen lachenden Will. Er stützte sich auf die Ellbogen, hustete und spuckte einen Mundvoll Flusswasser aus. Er sah zu den Bäumen hinüber, deren Blätter in der sanften Brise raschelten. Vielleicht hatte er sich die Gestalt nur eingebildet. Seinem Schwiegersohn gegenüber erwähnte er die Sache nicht, weil er ihm nicht die Laune verderben wollte. »Der Fluss ist wie der Mann, nach dem er benannt ist. An der Oberfläche wirkt er überaus freundlich, aber darunter will er einem ans Leben.«
Will lachte wieder, streckte die Hand aus und half Ned auf die Beine. Sie ließen sich von der Sonne trocknen, streiften dann die sauberen Hemden über und gingen auf der leeren Straße zum Haus zurück. Zwei englische Königsmörder, Arm in Arm.
Mrs Gookin stand mit umgebundener Schürze vor dem Herd und bereitete das Abendessen zu, als Ned den Kopf unter dem niedrigen Türstock in die Küche streckte und fragte, ob sie eine Schere und eine Bürste für ihn habe.
Natürlich hatte sie eine Schere, mit Klingen so scharf wie ein Federmesser, und natürlich hatte sie auch eine Bürste. Sie nahm beides aus dem Schrank.
»Und vielleicht noch einen Spiegel?«
Sie gab ihm auch den und sah ihm hinterher, wie er wieder die Treppe hinaufging. An der Stelle, wo er in der Tür gestanden hatte, war ein feuchter Fleck auf dem Boden.
»Wie lange bleiben sie hier, Mama?«, fragte Elizabeth, die den Tisch deckte.
»So lange sie wollen. Dein Vater hat sich da sehr klar ausgedrückt.«
»Aber warum sind sie von England nach Massachusetts gekommen? Für irgendwelche Amtsgeschäfte?«
»Schluss mit der Fragerei. Hol jetzt Wasser.«
Im Speicher stellte Ned den alten Stuhl neben das Fenster und sagte Will, er solle sich setzen. Dann machte er sich daran, ihm die Haare zu schneiden. Seit April waren sie nun auf der Flucht – zuerst anderthalb Monate in England, wo sie in den Häusern fremder Leute geschlafen hatten oder in Scheunen oder unter Hecken. Sie wurden vom Parlament wegen des Versuchs gesucht, die Armee zum Widerstand gegen das Abkommen mit dem exilierten Karl II. aufzustacheln. Und dann waren sie zehn Wochen lang auf dem stinkenden Schiff eingesperrt gewesen. Wills dunkle Locken fielen in Büscheln zu Boden.
Schließlich protestierte Will. »Das reicht jetzt, Ned. Hast du etwa vor, mich kahl zu rasieren?«
»Es reicht noch nicht. Jedenfalls wenn wir anständig aussehen wollen, und das sollten wir tunlichst. Solange wir wie Sträflinge auf der Flucht aussehen, werden wir auch wie solche behandelt. Jetzt das Gesicht, Soldat. Der Bart muss auch runter.«
Er ging vor Will in die Hocke und nahm sich der zotteligen Haare an, die seinem Schwiegersohn fast bis zur Brust reichten. Die Arbeit mit der Schere ging ihm flott von der Hand. Vor dem Krieg, vor langer Zeit in den Zwanzigern, war er in der Schneidergilde in die Lehre gegangen, um von der Pike auf den Tuchhandel zu erlernen. Der Umgang mit der Schere war seinen Fingern immer noch vertraut. Als der Bart fast zur Gänze verschwunden war, kam ein kräftiges, feingliedriges Gesicht voll spiritueller Kraft zum Vorschein – ein Gesicht wie aus der Geschichte der Märtyrer von John Foxe, dachte Ned, und genau ein solcher Märtyrer wäre aus dem jüngeren Mann geworden, wenn er ihn nicht zur Flucht überredet hätte.
»So ist es gut.« Er zeigte Will das Ergebnis im Spiegel, reichte ihm dann die Schere und nahm seinen Platz auf dem Stuhl ein. »Jetzt bin ich dran.«
Will zögerte. Sein Schwiegervater war immer ein Mann von repräsentativer Erscheinung gewesen. Er hatte bestickte Wämser und feines Schuhwerk getragen und in der King Street neben dem Whitehall-Palast in einem prachtvollen Haus gelebt. Die Levellers waren nicht die Einzigen gewesen, die ihm Eitelkeit vorgeworfen hatten. Der alte Mann vermisste das feine Leben sicherlich, doch beklagt hatte er sich nicht ein einziges Mal. Allerdings war er unter der Anspannung des letzten Jahres nunmehr vollständig ergraut.
Zaghaft schnitt Will eine Strähne ab.
»Nur zu, Will, herunter mit dem Putz«, befahl Ned aufgeräumt. Als gleich darauf Haarbüschel in der Farbe von Gänsedaunen zu Boden rieselten, nahm er den Spiegel in die Hand und stellte entsetzt fest, dass er so grau geworden war wie die Soldaten, die einst für die Royalisten gekämpft hatten und jetzt als alte Bettler durch die City von London streunten. Er legte den Spiegel beiseite.