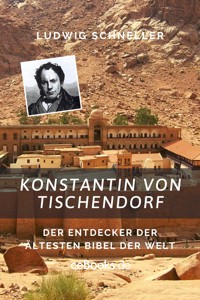
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folgen Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Unzufrieden mit den Aussagen einiger Professoren, die die Bibel als bloße Sammlung von Legenden betrachteten, nimmt sich der junge Forscher eine ehrgeizige Aufgabe vor: Er will die ältesten Bibelhandschriften aufspüren, vergleichen und, wenn möglich, noch verschollen geglaubte Texte entdecken. Seine Suche führt ihn durch die großen Bibliotheken und Archive in Rom, Jerusalem, Istanbul und Kairo – bis hin zu entlegenen Klöstern im Sinai. Mit unermüdlichem Eifer durchforstet er alte Manuskripte, untersucht vergilbte Pergamente und entschlüsselt historische Texte. Dann, an einem völlig unerwarteten Ort – in einem Papierkorb – stößt er auf seinen größten Fund. Doch bevor die Welt von seinen Entdeckungen erfährt, muss er sich zahlreichen Herausforderungen stellen: Überfälle, Verleumdungen und Widerstände bedrohen seine Arbeit. Doch sein Durchhaltevermögen zahlt sich aus – seine Entdeckung wird zu einem Meilenstein der Bibelforschung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 117
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Konstantin von Tischendorf
Der Entdecker der ältesten Bibel der Welt
Ludwig Schneller
Impressum
© 1. Auflage 2024 ceBooks Verlag, Langerwehe
Autor: Ludwig Schneller
Cover: Theophilus Kaufmann
ISBN: 978-3-95893-309-5
Verlags-Seite und Shop: www.ceBooks.de
Kontakt: [email protected]
Dieses eBook darf ausschließlich auf einem Endgerät (Computer, eReader, etc.) des jeweiligen Kunden verwendet werden, der das eBook selbst, im von uns autorisierten eBook-Shop, gekauft hat. Jede Weitergabe an andere Personen entspricht nicht mehr der von uns erlaubten Nutzung, ist strafbar und schadet dem Autor und dem Verlagswesen.
Dank
Herzlichen Dank, dass Sie dieses eBook aus dem ceBooks Verlag erworben haben.
Haben Sie Anregungen oder finden Sie einen Fehler, dann schreiben Sie uns bitte.
ceBooks Verlag, [email protected]
Newsletter
Abonnieren Sie unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über:
Neuerscheinungen von ceBooks.de und anderen christlichen Verlagen
Neuigkeiten zu unseren Autoren
Angebote und mehr
http://www.cebooks.de
Table of Contents
Titelblatt
Impressum
Einleitung
Jugend und Berufswahl
Erste Erfolge
Wachsende Erfolge
Die erste Reise zum Sinai 1844
Der erste Aufenthalt im Katharinenkloster
Die zweite Sinaireise 1853
Die dritte Sinaireise 1859
Die weiteren Schicksale des Codex Sinaiticus
Die Herausgabe des Codex Sinaiticus
Die Wichtigkeit der Sinaitischen Handschrift
Schluss
Letzte Seite
Einleitung
Dieses Buch hat eigentlich Frau Pfarrer Bickel Mönchsrot auf dem Gewissen. Sie ist die Witwe des merkwürdigen Malers, den meine Leser aus meinem Buch „Allerlei Pfarrherren“ kennen.
Sie schrieb mir schon vor mehreren Jahren: „Ich habe schon lange eine Bitte an Sie auf dem Herzen. Wie wär's, wenn Sie Ihrem Schwiegervater Konstantin von Tischendorf auch einmal ein Denkmal setzten in Gestalt eines Büchleins über die Auffindung des Codex Sinaiticus? Es wird mir, so oft ich den Namen Tischendorf höre, feierlich und ehrfürchtig zumute wie vor Großem, Gewaltigem. Das reicht bis in meine Kindheits-Erinnerungen zurück. Mein Vater hat mir, selber in ehrfürchtiger Freude, so viel erzählt von der unvergesslichen Tat, welche Tischendorf der Wissenschaft getan hat. Tischendorfs Neues Testament lag ständig auf seinem Schreibtisch neben der hebräischen Bibel, bei jeder Predigt gebraucht; und dieselbe Gepflogenheit hatte auch mein Mann. Wenn Sie das Lebensbild Ihres Schwiegervaters der Nachwelt erhalten, neu schenken, wird das ein kostbares Geschenk an alle, die seinen Namen zeitlebens in Ehrfurcht liebhaben, denen seine zuversichtliche Ausdauer, sein Festhalten an dem großen, edlen Ziel so oft ein Trost, eine Stärkung gewesen ist. Mir hat sein Name von früher Kindheit an durch die Erzählung meines Vaters einen geweihten Klang. Lassen Sie diesen Klang unserem christlichen Volke neu aufleben, und Sie geben ihm Großes.
Freilich steht ja schon einiges in Ihrem mit Bildern vom Sinai so prächtig geschmückten Buch „Durch die Wüste zum Sinai“ – aber da ist die Sache doch nur so im Vorbeigehen berührt. Es sollte doch dem deutschen Volk, nicht nur den Gelehrten, darüber ein besonderes Büchlein in die Hand gegeben werden. Dem deutschen Volk, soweit es denkt und Geschichte liebt, aber auch der akademischen Jugend, besonders den Theologen. Sie werden sagen, die jungen Theologen wüssten das alles schon. Aber das ist nach meinen Beobachtungen nicht der Fall.
Ich weiß noch wie heute, wie Sie schon im Jahre 1911 am zweiten Advent uns, Herrn Oberkonsistorialrat D. Kahl, meinem Mann und mir, hier in unserem ländlichen Pfarrhaus in Mönchsroth erzählten, unter welchen Umständen der große Gelehrte den berühmten Codex fand, und wie dadurch seine ganze Lebensarbeit gekrönt wurde. Mit atemloser Spannung hörten wir Ihnen zu. Es war eine der großen Stunden im Leben meines Mannes, das alles so lebendig von Ihnen, dem Schwiegersohn des Entdeckers, hören zu dürfen. Wir alle waren gepackt und innerlich warm geworden. Ich habe seither diese Geschichte mehr als einmal jungen Theologen möglichst mit Ihren eigenen Worten erzählt. Da gab es, ehe ich anfing, gewöhnlich verlegene Antworten: ‚Codex? Sinai? Tischendorf? Ach ja, ich erinnere mich – wie war es doch?‘ Erzählte ich ihnen dann, schilderte die Ereignisse so wie Sie sie uns einst vor Augen gemalt hatten, dann waren die jungen Leute jedes Mal ganz angetan und sagten: ‚Wenn man das doch einmal genauer erführe!‘
Seitdem hatte ich die Bitte an Sie auf dem Herzen, hatte nur nicht den Mut dazu. Aber ein ähnliches Erlebnis veranlasst mich heute doch zu der Bitte: Schreiben Sie doch das Buch über Tischendorf und den Codex! Tausende würden es Ihnen in glücklichen Stunden danken. Es lockt so sehr, zu hören: Wie kam der Gelehrte zum ersten Mal an diese Aufgabe? Wie wurde der Gedanke in ihm auf, eine solche, für damalige Zeiten geradezu abenteuerliche Reise bis zum Sinai zu unternehmen? Wie kam die kostbare Handschrift überhaupt in jenen entlegenen Erdenwinkel inmitten der einsamen Wüste? Unser heutiges Geschlecht hat die Sache vergessen. Lassen doch Sie, der in erster Linie dazu Berufene, diese fast märchenhafte Geschichte wieder aufleben, die den meisten ganz unbekannt oder ihnen nur wie eine dunkle Sage zu Ohren gekommen ist, und seien Sie sicher, Sie tun ein Gutes.“
Das war die liebenswürdige Anregung der bayrischen Pfarrfrau. Sie machte mir wohl das Herz warm, aber nicht nur war ich mit anderen Arbeiten reichlich beschäftigt, sondern ich nahm auch wirklich an, dass die Geschichte der Auffindung des Codex Sinaiticus hinreichend bekannt sei. Dieser Annahme widersprach aber die verehrte Freundin in einem wiederholten Schreiben lebhaft. Eigene Erfahrungen bestätigten mir ihre Ansicht. Und da fing denn das Samenkorn, das sie mir ins Herz geworfen, doch noch an, spät zu keimen und zu sprießen. Und das vorliegende Buch ist die reif gewordene Frucht. Möchte es freundliche Aufnahme bei allen finden, welche sich dafür interessieren, was für eine lange und wechselreiche Geschichte unser liebes Neues Testament auch schon äußerlich hinter sich hat.
D. Ludwig Schneller
Jugend und Berufswahl
Familie Tischendorf ist jahrhundertelang in Sachsen ansässig gewesen. Nach einer alten Familienüberlieferung hat ein Stammvater in der Geschichte des sächsischen Fürstenhauses eine Rolle gespielt. Im Jahre 1450 hat der bekannte sächsische Prinzenraub stattgefunden, in dem die Prinzen Ernst und Albert, die nachmaligen Häupter der ernestinischen und albertinischen Linie, entführt wurden. Der im Jahre 1450 gestorbene sächsische Kurfürst Friedrich der Sanftmütige hatte seinen Hofmarschall, den sonst tapferen Ritter Kunz von Kaufungen, schwer erzürnt. Aus Rache beschloss dieser, die beiden Prinzen zu rauben. In dunkler Nacht drang er in das Schloss Altenburg ein, ließ den Prinzen Ernst von einem Genossen wegführen während er selbst mit dem Prinzen Albert auf einsamen Waldwegen über die böhmische Grenze zu entkommen suchte. Kaum noch eine halbe Meile von der böhmischen Grenze entfernt machte er halt, um dem hungernden Kinde Beeren zu pflücken. Da kam ein Köhler dazu, dem sich Prinz Albert zu erkennen gab. Kaum hatte der beherzte Köhler das gehört, so ging er mit seinem Schürbaum gegen den Räuber an. Sein Weib rief alle Köhler der nahen Kohlenmeiler herbei, und ihren vereinten Kräften gelang es, den Ritter zu überwältigen. Die Prinzen wurden dem bekümmerten Vater zurückgebracht und der Ritter enthauptet.
Der Köhler, dem die Rettung in erster Linie zu verdanken war, ist der Vorfahr der Tischendorfschen Familie. Als daher Konstantin Tischendorf später den erblichen Adel erhielt, bekam er das auf dem Titelblatt abgebildete Wappen, in dem oben der Köhler mit seinem Schürbaum zu sehen ist, unten wegen seiner Verdienste um die Heilige Schrift ein Bibelbuch mit dem A und O, daneben das Schwert des Wortes Gottes und die Palme des Friedens.
Dort im sächsischen Land, dem die Familie treu geblieben war, wurde Konstantin Tischendorf am 18. Januar 1815 in dem Städtchen Lengenfeld im Vogtlande geboren. Auf dem Gymnasium in Plauen legte er den Grund zu der ungewöhnlich gründlichen Kenntnis der klassischen Sprachen, auf der sich seine ganze spätere Lebensarbeit aufbaute. Auf der Universität Leipzig, die er 1834 bezog, setzte er diese Studien aufs eifrigste fort. Dem innersten Zuge seines Herzens folgend studierte er vor allem Theologie und bereitete sich besonders für das Fach neutestamentlicher Schriftauslegung vor. Mit fünfundzwanzig Jahren, im Jahre 1840 erwarb er die Berechtigung, an der Universität Vorlesungen zu halten.
Es war damals die Zeit, wo mit die berühmtesten Theologen Deutschlands, in der Meinung, damit der geschichtlichen Wahrheit zu dienen, alles aufboten, um mit den schärfsten Mitteln untersuchender Wissenschaft die Unechtheit der neutestamentlichen Schriften nachzuweisen und so dem Neuen Testament sozusagen das Lebenslicht auszublasen. Nur noch vier Briefe des Apostels Paulus ließ man als echt gelten, alles andere wurde für ein Machwerk späterer Jahrhunderte erklärt. Namentlich die vier Evangelien wurden von den gelehrten Herren völlig verworfen, und am wenigsten fand das Johannes-Evangelium Gnade vor ihren Augen. Wohl gab es an deutschen Universitäten noch machtvolle Zeugen, die diesen grundstürzenden Behauptungen aufs entschiedenste entgegentraten. Aber von den anderen, die sich als die alleinigen Inhaber der Wissenschaft gebärdeten, wurden sie als unwissenschaftlich und rückständig verlacht.
Die entschieden gläubigen Christen hin und her ließen sich von diesen angeblichen Ergebnissen der Wissenschaft nicht anfechten. Aber doch bemächtigte sich weitester Kreise eine große Unsicherheit. Denn die Evangelien, die nun vor aller Welt als unglaubwürdige spätere, sagenhafte Gebilde hingestellt wurden, waren doch die einzige Quelle für die Kenntnis des Lebens Jesu. Wenn sie unecht waren, wo war da noch Glaubensgewissheit zu finden? Wo blieb die Hoheit des Sohnes Gottes, auf der doch das ganze Christentum beruht? Die wichtigsten Grundlagen des christlichen Glaubens schienen ins Wanken zu geraten.
Tatsächlich zogen auch berühmte Vertreter jener Richtung die Folgerungen aus der Unechtheit der Evangelien aufs schärfste. David Friedrich Strauß schrieb sein ‚Leben Jesu‘, in dem er die ganze Geschichte von Jesus für ein Gewebe haltloser Sagen erklärte. Sein Buch, in die breiteste Öffentlichkeit hineingeworfen, wurde von den Gegnern des christlichen Glaubens mit Jubel begrüßt. Jetzt schien ihnen das Christentum endgültig in den Sarg gelegt und begraben. Ihm zur Seite trat der ebenso gefeierte Franzose Renan, indem er mit Misshandlung aller Wissenschaft die Geschichte Jesu zu einem phantastischen Roman herabwürdigte. Mit gleichem Jubelgeschrei wurde sein Leben Jesu nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutschland begrüßt. So reichten sich damals französische Frivolität und deutsche Wissenschaft die Hand, um dem christlichen Glauben, wie er in den Evangelien bezeugt ist, für immer den Garaus zu machen.
Heute steht die wissenschaftliche Forschung auf ganz anderem Boden. Jener ganze Feldzug gegen das Neue Testament hat nur den Erfolg gehabt, die Echtheit der neutestamentlichen Schriften unwiderleglicher denn je ans Licht zu stellen. Über sechzig Jahre lang sind die bedeutendsten Kritiker dem Neuen Testament mit den schärfsten Waffen der Wissenschaft, wie sie noch nie gegen ein anderes Buch der Welt aufgeboten worden sind, zu Leibe gegangen. Und der Erfolg? Heute sehen sich die kühnsten und gelehrtesten Kritiker genötigt, anzuerkennen, dass das ganze Neue Testament unzweifelhaft echt und apostolisch ist.
Sogar Professor D. von Larnack, der anerkannte Führer der kritischen Schule, schreibt über diese Gelehrtenirrungen hinsichtlich der Briefe des Apostels Paulus: „Als ich vor 57 Jahren das theologische Studium begann, galt nur der Theologe als ein kritischer Kopf, der nicht mehr als vier Paulusbriefe als echt bestehen ließ. Seitdem ist es anders geworden. Neben ersten und zweiten Korinther, Galater, Römer ist jetzt auch die Echtheit von ersten Thessalonicher, Kolosser, Philipper, Philemon so gut wie allgemein anerkannt. Kontrovers sind noch von Gemeindebriefen zweiter Thessalonicher und Epheser. Ich verkenne nicht, dass hier Schwierigkeiten bestehen, besonders in Hinsicht auf Epheser; allein sie sind meines Erachtens nicht unüberwindlich, und die inneren Momente, die für die Echtheit sprechen, geben den Ausschlag. Dazu kommt, dass die Sammlung so alt ist, dass die Annahme, einer der Briefe sei eine Fälschung, große Bedenken erregen muss … Kann man sich vorstellen, dass die Thessalonicher-Gemeinde um das Jahr 90 von Korinth aus in einer Sammlung von Paulusbriefen ein Schreiben empfing, von dem sie bisher nichts wusste, oder dass sie selbst um dieses Jahr oder früher ein Schreiben in Umlauf setzte? Es gab damals doch in der Gemeinde Personen genug, die den Apostel und seine Beziehungen zur Gemeinde genau kannten! … Es muss daher als überwiegend wahrscheinlich gelten, dass die ursprüngliche Sammlung von zehn Briefen nur echte Schreiben umfasst.“
Ja, so steht es heute. Aber damals war der Kampf furchtbar ernst, und zahllose Menschen in der Christenheit ließen sich durch die angeblichen Feststellungen der Wissenschaft irremachen, als ob der Glaube an das Neue Testament, und somit auch der Glaube an Jesus ein überwundener Standpunkt wäre. Diese Lage fand der junge Tischendorf vor, als er seine Gelehrtenlaufbahn begann. Er war überzeugt, dass es zur Zeit keine wichtigere Aufgabe in der Theologie gäbe, als die ältesten Handschriften des Neuen Testaments aufs genaueste zu durchforschen, seine Echtheit auch auf diesem Wege nachzuweisen und so die Gegner mit den Waffen der Wissenschaft auf dem Feld zu schlagen. Ihm schwebte als Ziel seines Lebens vor, alle frühzeitigen handschriftlichen Belege für das Vorhandensein und die Anerkennung unserer Evangelien auszusuchen und für diesen Zweck keine Mühe und kein Opfer zu scheuen, selbst wenn ihn sein Suchen in ferne Länder führen sollte. Damit ergriff er in jungen Jahren seine eigentliche Lebensaufgabe. Glücklich, wer in den entscheidenden Lebensjahren den gottgewollten Beruf seines Lebens erkennt! Ein solcher Glücklicher war Tischendorf. Mehr ein Jüngling denn ein Mann, kaum siebenundzwanzig Jahre alt, bald nach Vollendung seiner Studien, veröffentlichte er im Jahre 1842 schon seine erste kritische Ausgabe des griechischen Neuen Testaments, die von den berufensten Männern der Wissenschaft mit ungeteilter Anerkennung und Freude als ein großer Fortschritt begrüßt wurde.
An seine Braut schrieb er darüber: „Endlich bin ich am Vorabend der Vollendung des Neuen Testaments. Das Schicksal dieser Arbeit lege ich in Gottes Land. Ich habe zwar meine Habilitation und Probevorlesung an der Leipziger Universität hinter mir. Aber ich möchte nie genötigt sein, diese Habilitation (Zulassung zum Hochschulamt) allein zur Grundlage meiner Lebensentwicklung zu machen. Vor mir steht eine heilige Lebensaufgabe, das Ringen um die ursprüngliche Gestalt des Neuen Testaments.“
So hat er schon früh seine Lebensaufgabe erfasst, und ihr ist er sein Leben lang treu geblieben. Geradlinig hat er sie bis zu seinem Tod verfolgt. Und wenn man sieht, was er auf diesem Gebiet in vierunddreißig-jähriger unermüdlicher Arbeit geleistet hat, so kann man sich dem Eindruck nicht entziehen: er war von Gott dazu berufen.





























