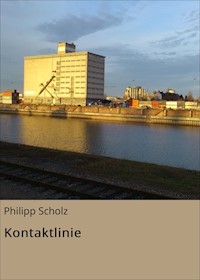
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es ist das Jahr 2015 und der Krieg in der Ukraine geht auch in der Stadt Donezk in das zweite Jahr. Das Leben an der Kontaktlinie gehört für die Bewohner inzwischen zur Normalität. Trotzdem wissen auch sie, dass sich inzwischen viel geändert hat, und dass auch sie selbst sich verändert haben. Das Leben scheint aber plötzlich nicht mehr normal zu sein, wenn sie die Kontaktlinie verlassen. Es ist wie ein Fausthieb, die westliche Gesellschaft und ihr Desinteresse an diesem Konflikt zu sehen und zugleich zu versuchen mit dieser Gesellschaft zurecht zu kommen. Im Umkehrschluss scheint es die Hölle für einen Außenstehenden wie Paul zu sein, an die Kontaktlinie zu kommen. Die Menschen und Freunde in Donezk aber haben diesen Eindruck nicht verdient. Gerade deshalb ist es der richtige Weg als Außenstehender in diese Stadt zu kommen. Dort wo Freunde und Bekannte leben. Denn an die täglichen Probleme und Sorgen, wie wir sie aus Deutschland kennen, werden hier keine Gedanken mehr verschwendet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Philipp Scholz
Kontaktlinie
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Kontaktlinie
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Impressum neobooks
Kontaktlinie
Philipp Scholz
Die folgenden Ereignisse sind frei erfunden. Alle dennoch möglichen Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen oder Handlungen sind rein zufällig.
Für alle gefallenen und verschwundenen Freunde und Kameraden.
Prolog
Mitte Januar des neuen Jahres 2014 kehrte ich wieder nach Deutschland zurück. Es war das letzte Mal, dass ich Lev und seine Familie beisammen sah. Es war das letzte mal, dass ich ein Flugzeug über den Sergei Prokofjew Flughafen besteigen sollte.
Wenige Wochen später begann der bewaffnete Ukrainekonflikt, der sich allmählich in einen Krieg entwickelte.
Fassungslos sah ich den Fernsehbildern der Tagesschau zu, welche die Zerstörungen der Oblasten Luhansk und Donezk zeigten.
Es waren Bilder von zerstörten Straßenzügen und Zivilgebäuden, zerstörten Eisenbahnbrücken und Fahrzeugen.
In bisher ruhigen Wohngebieten durchbrachen Panzer der russischen oder ukrainischen Armee die provisorischen Straßensperren der Milizen in einer solch hohen Geschwindigkeit, dass dabei kaum auf die Zivilbevölkerung Rücksicht genommen werden konnte.
Ende Mai, nach der Präsidentschaftswahl in der Ukraine, schloss der Sergei Prokofjew Flughafen für immer seine Türen. Im Verlauf des Krieges wurde er schließlich vollkommen zerstört.
Der Krieg selbst dauerte unbeeindruckt an.
Hier in Süddeutschland war er weit weg und stellte für viele keine Bedrohung dar.
Ich dachte anders darüber nach. Denn ich hatte gute Bekannte vor Ort.
Die einzigen Auswirkungen, die ich bei uns in Deutschland wahrnehmen konnten, waren, dass die Wertpapiere von Rosneft oder Gazprom stark zurück gingen, oder dass jeden Abend ein weiterer Bericht in der Tagesschau gesendet wurde.
Ansonsten war alles wie immer.
Während ich auf den Verfall des Rubels spekulieren konnte, hatte die russische und ukrainische Bevölkerung unter der Entwertung der eigenen Währung zu leiden.
Während ich mir unentschlossen neue Echtledersitzbezüge für meinen Mercedes aussuchen konnte, wurde Levs Existenz mit Panzern überrollt.
Während in Heidelberg feierlich eine neue Naturwiese für gefährdete Eidechsenarten eingeweiht wurde, fiel im Donezker Flughafen der Tower aus Artilleriebeschuss in sich zusammen.
Das Leben ging weiter.
An einem Sommerabend setzte ich mich auf den Balkon meiner Wohnung und schaute über die Rheinebene dem Sonnenuntergang zu.
Die Sonne hatte ein kräftiges und warmes rotorange, welches mich schon fast blendete. Das Abendrot färbte die vereinzelten Wolken in ein schwaches lila.
Der Blick über die Rheinebene war klar. Linker Hand konnte ich die beiden Kühltürme des AKW Philippsburg I und II sehen. Aus einem Turm stieg eine Wolke empor die aussah als hätte es eine Fehlzündung gegeben. Einzelne kleine Wolken.
Es war eine friedliche Abendstimmung. Lediglich ein Krankenwagen der auf der Bundesstraße 3 in Richtung Heidelberg fuhr unterbrach diese Ruhe für einen Moment.
Ich zündete mir eine Zigarette an, lehnte mich auf das Geländer und träumte weiter in die Landschaft hinein. Am ganz rechten Ende meines Blickfeldes lagen Mannheim und die Schlote der Kraftwerke in Rheinau.
Ich dachte an die vergangenen Zeiten. An die verschiedenen Menschen und deren Schicksale die ich während dieser Zeit kennen gelernt habe. Die erlebten letzten vier Jahre haben mich als Menschen geändert wie es keine andere Zeit in meinem Leben getan hat. Ich bin an ihr gewachsen. Das Erlebte hatte mich geprägt. In der Hinsicht wie der Krieg einen Soldaten prägt, oder wie der Tod eines Angehörigen die Familie prägt. Ich war gezeichnet aber auch zugleich reifer geworden. Ich akzeptierte mein Schicksal, zugleich aber auch mit dem Wissen dass es weitaus schlimmere Schicksale gibt.
Oft waren meine Gedanken bei Lev und seiner Familie.
Später in der Nacht saß ich am Computer und durchblätterte die Seite eines Finanzdienstleisters.
Aus Neugierde und Spaß gab ich jene Wertpapierkennnummer in das Suchfeld ein, deren zu Grunde liegendes Derivat mich damals vor vier Jahren als Anfang Zwanzigjähriger dermaßen aus der Bahn geworfen hatte, dass ich beinahe daran krepierte.
Mittlerweile war die Nummer neu vergeben. Auf ein Konstrukt für fallende Kurse auf Palladium.
Für mich, jedoch wird diese Nummer immer mit einem bestimmten Schein verknüpft bleiben.
Der Schein, der mein Leben und mich für immer verändert hatte. DT1BX9.
Kapitel 1
„Ich habe es gewusst, dass aus dir nie etwas werden wird. Ich habe es schon damals kommen sehen.“
Ich schaute mein Gegenüber verdutzt an.
„Wie bitte?“
„Deine ganze Einstellung zum Leben. Und deine Einstellung zur Arbeit. Ja, bei dir war das vorherzusehen. Und dann noch drei Jahre Gefängnis.“
„Ich war keine drei Jahre im Gefängnis! Und was heißt es überhaupt es war vorherzusehen, dass aus mir nichts werden würde? Was bedeutet es in Ihren Augen überhaupt etwas zu werden, oder es zu etwas zu bringen?“
Mein Gegenüber tat so, als hörte er mir nicht zu. Angestrengt starrte er auf sein iPhone und tippte geschäftig auf dem Display herum.
„Drei lange Jahre im Gefängnis“, sagte er nun, griff nach seinem Kaffee, der vor ihm auf dem Tisch stand und blies den Dampf von der heißen Tasse.
Er machte dabei einen eigenartigen Gesichtsausdruck, sodass man sein schiefes, ungepflegtes und gelbes Gebiss sehen konnte.
Schlürfend nahm er einen Schluck und lehnte sich dann überheblich in seinen Clubsessel zurück. Das Leder knirschte.
„Ja, ja, so ist das mit euch jungen Leuten.“
Ich konnte Herrn Sperling noch nie leiden. Schon damals in der Schule nicht.
Herr Sperling war ein Lehrer von mir gewesen. Deutsch und Religion. Es war Zufall, dass ich ihn heute hier im Café getroffen hatte. Herrn Sperling nahm ich immer als einen sehr unangenehmen Menschen wahr. Ein Mensch, der nur seine eigene Meinung vertrat und nichts anderes akzeptierte. Er hatte keine Idee von den wirklichen Problemen im Leben und interessierte sich auch nicht sonderlich dafür. Trotzdem bezeichnete er sich großspurig als allwissender Pädagoge.
Ich hielt absolut nichts von ihm und ließ ihn das nun, fast zehn Jahre nach Ende der Schulzeit auch spüren.
Herr Sperling behandelte seine Schüler nie gerecht. Er hatte schon damals, während meiner Schulzeit enorme Unterschiede bei seinen Schülern gemacht, und grenzte zwei gewisse Typen voneinander ab.
Die einen, deren Eltern selbst Akademiker waren und eine gehobene Stellung in der Gesellschaft einnahmen und die es den Rest der Gesellschaft auch wissen ließen; sei es durch Auto, Immobilie oder Beruf, und dann die anderen, die angeblich niemals studieren würden und eine normale Angestelltentätigkeit oder irgendeinem Verwaltungsberuf nachgehen würden. Wenn überhaupt.
Es war seine Voreingenommenheit. Herr Sperling sah sich selbst zu besserem berufen und hielt sich auch selbst für etwas besseres.
Ich konnte mich noch genau daran erinnern, wie Anfang bis Mitte der 2000er Jahre immer mehr Schüler einen Heimcomputer im Kinderzimmer stehen hatten. Es war die Zeit als Google, Wikipedia und YouTube aus dem Boden schossen und ans Netz gingen, und so von mehr und mehr Schülern genutzt werden konnten.
Es waren aber auch viele Schüler unter uns, deren Eltern sich einen Computer mit erstem Internetanschluss einfach noch nicht leisten konnten, oder deren Notwendigkeit nicht erkannten. Ganz davon zu schweigen, dass der Unterricht in der Schule überhaupt digital verlief. Selbstverständlich wir hatten einen EDV-Raum mit Rechnern zur Verfügung, das war aber auch alles. Alles andere blieb analog.
Es war schließlich Herr Sperling, der viele Schüler offen anprangerte und zu Menschen zweiter Klasse degradierte, weil sie keinen eigenen Rechner zum Arbeiten hatten, oder welche Art von Eltern sie nur haben konnten, die ihren Kindern keinen eigenen Rechner kaufen würden. Er warf mit Fachausdrücken um sich, die womöglich nur Programmierer benutzt hätten und versuchte, wo es nur ging, seine Mitmenschen und auch Lehrerkollegen mit seiner Überheblichkeit zu degradieren. Wahrscheinlich hatte er selbst gar keine wirkliche Ahnung davon.
Ein Wunder, dass ein Mensch wie Herr Sperling überhaupt Pädagoge geworden war.
Im Gegenzug bestrafte er aber auch alle Schüler, die zu den Sperrzeiten in den EDV-Räumen tätig waren, oder die mit Handys im Flur des Schulgebäudes erwischt worden waren. Er versuchte die zunehmende Digitalisierung als ein Privileg darzustellen. Ein Privileg, welches er ganz bewusst nur wenigen ausgewählten Schülern zusprechen würde.
Ein Glück, dass sich die Zeiten geändert hatten, und uns die Digitalisierung förmlich überrannt hat.
Heute besaß jeder Idiot ein Smartphone oder einen Rechner mit Internetanschluss.
„Sie sollten sich etwas schämen Herr Sperling.“
Jetzt war er es, der mich überrumpelt ansah.
„Sie können froh sein, die Möglichkeit erhalten zu haben, mit solchen Privilegien aufgewachsen zu sein und damit arbeiten zu können. Deshalb können Sie diese aber noch lange nicht als selbstverständlich hinnehmen. Seien Sie froh, in einem Land leben zu können, in dem seit 70 Jahren Friede herrscht. Schauen Sie auf andere Gebiete dieser Erde, dann sollten Sie ihre jetzige Lebenseinstellung nochmals gewaltig ändern und hinterfragen. Denken Sie mal darüber nach! Oder müssen Sie dazu wohl auch zuerst Ihr iPhone nach einer Meinung fragen?“
Ich ließ Herr Sperling nicht zu Wort kommen, sondern griff ihn weiterhin an.
„Und hören Sie auf andere Menschen zu verurteilen oder zu degradieren. Aus Ihrer Situation kann man das leicht tun, denn Sie kennen nichts anderes. Sie können leicht über andere urteilen. Wie bereits erwähnt, wir leben in Deutschland seit 70 Jahren ohne Krieg. Und zudem im Überfluss. Es sei uns allen, wir hoffen es inständig, auch weiterhin gegönnt. Aber legen Sie gerade deshalb ihre Überheblichkeit ab! Legen Sie ihr iPhone und MacBook beiseite und schauen sich die Sorgen der Menschen da draußen an. Der Wohlstand erreicht längst nicht alle. Sie müssen überhaupt nicht weit gehen. Anstatt Religionslehrer hätten Sie wohl besser Apple-Jünger werden sollen.“
Herr Sperling schnitt nun mir das Wort ab.
„Also solche Unterstellungen muss ich mir von dir nicht sagen lassen Paul! Das ist doch eine Unverschämtheit ohnegleichen! Das muss ich mir als Oberstudienrat von niemandem sagen lassen. Und schon gar nicht von einem, der drei Jahre im Gefängnis gesessen hat.“
Herr Sperling bekam einen roten Kopf, als würde er gleich explodieren. Seine ekelhaften gelben Zähne blitzten aus seinem Mund. Er trank eilig seinen Kaffee zu Ende und packte seine Utensilien nebst Notebook und iPhone zusammen.
Ich grinste ihn dabei ununterbrochen an.
„Das ist nun mal die Wahrheit. Sie und wir alle können uns nicht ewig davor verstecken. Da draußen sind die Probleme und Sorgen. Da draußen dreht sich die Welt. Nicht hier, bei Kaffee und kostenfreiem W-LAN zu diskutieren welche Personengruppe sich etwas leisten kann und welche nicht.“
„Ich lasse mir das von dir nicht sagen Paul! Nicht von jemandem wie dir!“
Ich grinste ihn weiterhin provozierend an.
„Ihr großes Vorbild und Prophet, Herr Sperling, Steve Jobs, hat einmal gesagt „Die Menschen wüssten überhaupt nicht was sie brauchen, bis wir es ihnen zeigen“.“
„Ja und? Das hat er doch auch.“
„Merken Sie denn überhaupt nicht, dass Sie mit solchen selbstherrlichen Aussagen ihre Mitmenschen automatisch als weniger intelligent und dumm degradieren? Die Elite ist der angebliche Entscheider, der den anderen zeigt, was sie angeblich brauchen und was nicht. Und das einfache Volk nimmt es einfach hin, was? Und wer legt denn einfach über die Köpfe der anderen hinweg fest, dass der Mensch unbedingt ein iPhone braucht? Es gibt wichtigeres auf der Welt als diesen Luxus.“
Herr Sperling schüttelte nur den Kopf und machte sich auf, das Café zu verlassen.
„Ich werde mit dir ganz bestimmt nicht diskutieren Paul. Du gehörst dieser Elite nicht an!“, blaffte er mich erregt an.
„Sie sollten sich einmal selbst reden hören Herr Sperling. Und so etwas wie Sie nennt sich Gymnasiallehrer oder Oberstudienrat. Sie legen eine elitäre Arroganz an den Tag, die nicht auszuhalten ist!“
Ich rief ihm noch weitere Worte hinterher. Doch da er hatte das Café bereits verlassen.
Ich grinste zufrieden und lehnte mich in meinem Clubsessel.
Eigentlich hätte man es ihm schon viel früher sagen müssen. Aber diese angeblichen Apple-Jünger lassen sich ja auf keinerlei Diskussion und Kritik im Bezug auf ihre Ideologie ein.
„Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Warum schreien Sie sich denn gegenseitig so an?“
Neben mir stand eine hübsche Bedienung mit einem Tablett in der Hand und schaute mich vorwurfsvoll an.
„Nein, vielen Dank. Es ist alles in Ordnung. Aber ich möchte dann gerne zahlen.“
Ich lächelte sie an. Die Bedienung gab mir nur einen versteinerten Blick zurück.
„Und nebenbei, es waren keine drei Jahre Gefängnis. Es waren ein Jahr, sieben Monate und einundzwanzig Tage.“
Das Jahr 2015 war noch jungfräulich und hatte eben erst begonnen. Auf den Straßen Heidelbergs beseitigte die Stadt die letzten Überreste der Silvesterfeierlichkeiten.
Müllwägen sammelten Sektflaschen und Bierkästen ein, die als Abschussvorrichtung für Raketen missbraucht worden waren. Hier und da kehrte man Müllberge von zerfetzten Feuerwerkskörpern und Batterien zusammen.
Ich zog mir den Mantel fester zusammen und lief am Neckarufer entlang, von der Theodor-Heuss-Brücke bis hinab zur Neckar Brücke. Es war bitter kalt.
Es hatte zwar nicht geschneit gehabt, aber über den Dächern von ganz Heidelberg lag eine frostige dünne Eisschicht. Bei jedem Atemzug drang eine weiße Dampfwolke aus den Mündern der Passanten.
Ich wandte meinen Blick hinter mich und schaute auf den Eingang des Neckartals.
Die Spitze des Heiligenberges auf der linken Seite, und die des Königstuhls auf der Rechten war mit Schnee überdeckt. Der Himmel zeigte sich grau. Der Blick in die Ferne war durch den Nebel stark getrübt.
Auch ich selbst blickte in ein ungewisses neues Jahr und auf eine ungewisse Zukunft. Im letzten Spätjahr hatte ich meinen Arbeitsplatz verloren. Das Unternehmen hatte diesen aus Kostengründen wegrationalisiert. Auch meine Wohnung wurde in der Miete so teuer, dass sie für mich nicht mehr tragbar war und ich ausziehen musste.
Seither wurde mein Lebensunterhalt durch Gelegenheitsjobs finanziert. Ich war darum bemüht, eine neue Anstellung zu finden und klapperte alle Orte in Heidelberg und der Umgebung ab, um eine passende und unkomplizierte Arbeit zu finden.
Unkompliziert musste sie in dem Sinne sein, da es für mich als Vorbestrafter generell nicht einfach war eine feste Anstellung zu finden. Denn mit einem negativen polizeilichen Führungszeugnis und und einer abgesessenen Freiheitsstrafe wegen Urkundenfälschung und Veruntreuung war man nicht unbedingt von der Sorte Arbeitnehmer, die händeringend gesucht wurde.
Es war schon merkwürdig, einerseits unwirklich, andererseits aber auch einfach nur gerecht.
Vor fünf Jahren war ich noch im Besitz einer Eigentumswohnung gewesen und ich hatte noch so viel Geld zur Verfügung, dass ich mit fünfstelligen Summen am Aktienmarkt spekulieren konnte.
Heute reichte mein Erspartes noch nicht einmal mehr für eine Monatsmiete.
Letzten Endes waren es wirklich gute Freunde, die mich vor einem weiteren Abstieg bewahrt hatten. So bekam ich von ihnen, ohne eine Gegenleistung, zwei kleine Dachzimmer am so ziemlich westlichsten Ende von Heidelberg als Unterkunft zur Verfügung gestellt. Dort, wo die Autobahn 656 von Mannheim nach Heidelberg hereinführt.
Die Dachzimmer waren nicht besonders wohnlich und hübsch, sondern dienten zuvor vielmehr als Abstellraum und waren zudem heruntergekommen und zuging. Aber es war eine Wohnung und ich war froh darüber. Meine Freunde Steffen und Isabel, denen das Haus gehörte, bewohnten die Stockwerke darunter.
Mittlerweile hatte ich die Treppen zum alten Wehrsteg passiert. Neben mir erstreckte sich der Neckar in seiner naturbelassenen Form.
Flaches Wasser, umgeben von bewachsenen Inseln und Sandbänken. Die winterliche Idylle zeigte ihre ganze Pracht. Die Fahrrinne für die Binnenschifffahrt befand sich auf Neuenheimer Seite.
Ich blieb ein wenig stehen und sah ein paar Wasservögeln zu. Dann ging ich weiter.
In Heidelberg, so kam es mir immer vor, konnte man den Unterschied zwischen Arm und Reich sehr deutlich erkennen.
Generell ist Deutschland ein sehr ungleiches Land, aber gerade hier in Heidelberg konnte man die Unterschiede der Gesellschaftsschichten gut vergleichen.
Die Universitätsstadt präsentierte sich stets privilegiert und mit Sonderstatus. Während die einen am Philosophenweg, mit Blick auf Neckar, Altstadt und Schloss, in Millionenanwesen wohnten, zudem im Schnitt zwei bis drei Autos pro Haushalt ihr eigen nannten, so war es den anderen Monat für Monat ein Kampf die Mieten im Stadtgebiet zu bezahlen. Über fünfzig Prozent des Nettoeinkommens wurde hier von vielen für die Miete aufgewendet. Denn der Wohnraum in Heidelberg war knapp und Angebot gab es so gut wie keines.
Dabei hatte das angeblich doch so gehobene Heidelberg an Verkehrsanbindung, Radwegen und Parks reichlich wenig zu bieten.
Wer mit dem Auto zu Verkehrsspitzenzeiten in die Stadt musste, der konnte mir nur leid tun. Ebenso die zahlreichen Studenten, die sich mangels Radwegen zwischen den Blechlawinen hindurchschlängeln mussten.
Eigentlich war es eine Schande. Die gehobene Klasse dieser Gesellschaft kaufte den Wohnraum auf, da sie sonst nicht wusste, was sie mit ihrem Geld anstellen sollte. Ist der Wohnraum dann aufgekauft, wurden die Wohnungen mit möglichst viel Gewinn neu vermietet. Notfalls wurden die Wohnungen einfach leer stehen gelassen und darauf gewartet bis sich irgendein Idiot fand, der die gewünschte Miete bezahlte oder bezahlen musste. Hauptsache war aber, dass man sie zumindest einmal in seinen Besitz gebracht hatte.
Durch die Spekulationen auf den Wohnraum wurden die Preise künstlich erhöht und das Wohnungsangebot verknappt. Heidelberg und viele andere deutsche Städte waren dadurch überteuert und für einen Großteil der Bevölkerung nicht mehr zu finanzieren.
Zugegeben, in Deutschland herrscht das Gesetz der freien Marktwirtschaft. Es richtet sich nach Angebot und Nachfrage. Und derjenige, der das Geld hat, hat selbstverständlich das Recht Wohnungen zu kaufen. Aber ist es ab einem gewissen Punkt nicht auch eine Frage der Ethik? Genauso wie niemand auf Trinkwasser, Lebensmittel und Arzneimittel spekulieren sollte, sollte doch auch niemand auf Wohnraum spekulieren. Denn am Ende trifft es doch den Menschen selbst. Trinkwasser, Lebensmittel, Arzneimittel und Wohnraum sind und bleiben Grundbedürfnisse eines jeden.
Aber ich konnte es schließlich ja auch niemandem für übel nehmen, geschweige denn Kritik ausüben. Denn dachte ich an mich selbst zurück, so hätte ich vor fünf Jahren bestimmt ebenso gleich gehandelt. Damals, als ich noch das Geld dazu hatte.
Jetzt hatte ich es nicht mehr und stand nun auf der Seite derer, die von den oberen zehn Prozent täglich auf ein Neues überrundet wurden.
Die Schere zwischen Arm und Reich öffnete sich täglich weiter. Deutschland wird auch weiterhin ein Land der Ungleichheit bleiben.
An meiner neuen Wohnung war ich nun endlich, völlig durchfroren, angekommen. Ich klopfte meine Schuhe ab, und ging das Treppenhaus nach oben wo ich mich auf das warme Wohnzimmer freute.
Nachdem ich Mantel und Schuhe ausgezogen hatte, setzte ich in der Küche freudig Wasser für einen Kaffee auf.
Während das kochende Wasser durch den Filter gluckerte, durchstöberte ich am Esstisch die Neuigkeiten und Nachrichten auf meinem Laptop.
Lev hatte mir derweil zwei neue Nachrichten in meinen Posteingang geschickt. Wir hatten gerade erst am Abend zuvor miteinander geschrieben.
Nachdenklich betrachtete ich die Betreffe der beiden neuen Mitteilungen. Ich ließ meinen Blick über den Bildschirm hinweg an die Zimmerwand dahinter gleiten. Dort waren in unterschiedlichen Größen verschiedene gerahmte Fotos aufgehängt.
Relativ zentral in der Mitte der Wand, war ein Bild von Lev und mir zu sehen.
Es zeige uns beide lachend, vor der Datsche von Levs Onkel in Ostpolen stehen. Das Foto war im Sommer 2011 aufgenommen worden.
Ich blickte gebannt und lächelnd darauf.
Wie schön und zugleich auch schrecklich war die Zeit doch damals für mich gewesen. Irgendwie vermisste ich sie aber auch ein wenig.
Seither hatte sich viel verändert.
Ich war nach Deutschland zurückgekehrt und hatte im Gefängnis meine Strafe abgesessen. Nach meiner Haftzeit hatte Lev in Donezk zusehen müssen, wie der Osten des Landes in den Ukrainekrieg gezogen worden war. Ich tat es hier in Deutschland über die Nachrichten.
So hatte jeder von uns mit seinen eigenen Problemen zu kämpfen.
Für Lev brach durch den Krieg allerdings die Hölle herein. Es war mit meinen Problemen der Arbeitslosigkeit und Wohnungssuche nicht zu vergleichen.
So oft es ging versuchten wir Kontakt zu halten und miteinander zu Schreiben. Es war eine ganz eigene Welt für uns beide, in der Lev einfach nur versuchte zu überleben. Die Ignoranz der westlichen Gesellschaft über einen Konflikt vor der eigenen Haustüre, in einem Nachbarland zur Europäischen Union, machte uns beide wütend.
Auch in dieser Hinsicht ging die Schere zwischen Wohlstand und der Zerstörung von menschlichen Existenzen in anderen Ländern immer weiter auseinander.
Kapitel 2
Lev schrieb mir seit Ausbruch des Konfliktes regelmäßig Nachrichten über die aktuelle Situation in Donezk und wie es ihm erging. Wir schrieben miteinander so oft es möglich war. In letzter Zeit, und gerade über den Jahreswechsel hin, musste sich die Situation und der Konflikt dort aber so heftig zugespitzt haben, dass er es sogar gar nicht mehr geschafft hatte regelmäßig zu schreiben.
Seit dem Spätjahr 2014 entwickelte sich eine zweite große Auseinandersetzung um den Flughafen in Donezk. Obwohl zuvor mehrmals Hoffnung auf einen Waffenstillstand aufgekommen war, ging der Krieg unvermindert weiter. Er ging weiter in einer solchen Intensität, dass der Flughafen und viele Ortschaften in direkter Nähe zur Kontaktlinie durch Panzer und schwerem Artilleriebeschuss zerstört worden waren. Selbst Gebäude in der direkten Innenstadt von Donezk blieben davon nicht verschont.
Lev fand sich selbst in der Hölle wieder. Es waren für ihn Monate ohne Hoffnung und in ständiger Angst. Es waren Monate des totalen Wahnsinns.
Am unglaublichsten war für mich aber, dass ich noch vor genau einem Jahr dort gewesen war. In Donezk bei Levs Familie. Heute war es fast unvorstellbar, angesichts der Bilder, die er mir schickte.
Im Januar 2014 hatte ich Lev und seine Familie in Spartak, einem kleinen Vorort von Donezk, besucht gehabt. Niemand von uns konnte ahnen, was auch nur ein paar Monate später hier passieren würde. Seither hatte sich vieles verändert.
Zunächst waren es die Nachrichten über die Annexion der Krim, durch deren Folge auf mich erstmals bewusst die Worte „bewaffneter Konflikt“ und „Ukrainekrieg“ einwirkten. Danach schließlich, dass sich die Oblasten Luhansk und Donezk als eigenständige Volksrepubliken proklamierten.
Die Ereignisse waren alleine deshalb so brisant für mich, weil Lev diese hautnah miterleben musste. Er war dabei, als Regierungsgebäude und andere öffentliche Anstalten besetzt worden waren.
Auch wenn die Situation unüberschaubar war und sich täglich überschlug hatten Lev und seine Familie bis dahin noch keine wirklichen Bedenken oder gar ernste Existenzängste gehabt. Der Konflikt drohte dennoch langsam aber sicher zu eskalieren.
Als Ende Mai, kurz nach den ukrainischen Präsidentschaftswahlen der Sergei-Prokofjew-Flughafen schließlich geschlossen und besetzt worden war, erkannten nun auch die letzten aus Levs Freundeskreis, wie ernst und gefährlich die Lage inzwischen geworden war. Es entwickelten sich in und um die Stadt heftige Auseinandersetzungen.
Im Laufe des Jahres 2014 wurde der Vorort Spartak, in welchem Lev wohnte und der sich zudem in nächster Nähe zum Flughafen befand, zerstört. Auch das Haus seiner Familie blieb nicht davon verschont. In wenigen Wochen hatten sie ihre gesamte Existenz, und all das, was sie sich bisher aufgebaut hatten verloren.
Levs Eltern und seine Schwester Emilia flüchteten schließlich aus Donezk und zogen zu ihren nächsten Verwandten nach Kiew. Lev hingegen blieb in der Stadt und zog in eine kleine Wohnung oberhalb seiner Autowerkstatt, die sich im Donezker Ortsteil Leninsky befand. Die Werkstatt selbst, die er zusammen mit seinem Bruder geführt hatte, wurde letztendlich von ihnen aufgegeben und geschlossen. Levs Bruder zog es derweil nach Mariupol.
Es war eine schwierige Zeit für Lev. Nicht nur, dass er alles verloren hatte was er sich ein Leben lang aufgebaut hatte. Es war auch die Tatsache, dass es seine Familie zerrissen hatte. Lev brachte es trotz all dem nicht über das Herz, die Stadt zu verlassen. Donezk war seine Heimatstadt gewesen. Er hatte zu viele Erinnerungen an diese Stadt, als um sie nun einfach hinter sich zu lassen.
Aus der Millionenstadt Donezk und seinen Vororten flüchteten letztendlich über einhunderttausend Zivilisten. Die Stadt veränderte ihr Gesicht.
Viele Geschäfte und Läden hatten geschlossen. Die Straßen glichen der einer Geisterstadt. Auch die Versorgung mit Lebensmitteln und Trinkwasser stellte für viele Menschen die geblieben waren nun ein Problem dar. Vor allem die Alten und Kranken, die die Stadt sowieso nicht mehr verlassen konnten, waren nun auf fremde Hilfe von außerhalb angewiesen. Letztendlich waren es die Verwandten und Freunde, die Hilfspakete in die Stadt schickten. Hatte man keine Beziehungen oder Bekannte nach Außerhalb, so sah es schlecht für einen aus.
Lev hingegen fand immer einen Weg, wie er an das nötigste kommen konnte. So erzählte er es mir zumindest immer.
Er hatte ein paar gute Freunde vor Ort, die sich ebenfalls dazu entschlossen hatten, die Stadt nicht zu verlassen. Gemeinsam schlugen sie sich so durch den Alltag in der vom Krieg gezeichneten Stadt. Es war ein Alltag ohne geregelte Zeiten, ohne geregelte Arbeit und ohne eine bessere Perspektive.
Ich sprach Lev stets meinen vollen Respekt über diesen eisernen Willen aus, und bot ihm selbstverständlich Hilfe an, sofern das hier von Deutschland aus überhaupt möglich war.
Außer ihm Geld zu schicken konnte ich allerdings nicht viel tun. Und Geld wollte er nicht. Damit könne er dort sowieso nichts anfangen. Für Lev war es Hilfe und Ablenkung genug, wenn wir regelmäßig miteinander schreiben konnten.
Und so versprachen wir uns es auch gegenseitig.
Die nächste große Schlagzeile, die über die Fernsehbilder in Europa flimmerte, war der Abschuss des Pasagierflugzeuges MH-17, der sich ganz im Osten der Ukraine nahe der Stadt Tores ereignet hatte.
Spätestens durch diesen Zwischenfall waren immer mehr Augen auf den Konflikt gerichtet. Denn nun war auch Europa betroffen. Jetzt schien es, war auch die Sicherheit der Staatsbürger aus anderen Ländern nicht mehr garantiert, sofern deren Linienflug über das Kriegsgebiet führte.
Es war schon zynisch die Stimmen der Menschen aus der Mitte der Gesellschaft zu hören. Bis dahin interessierte es die Menschen im Westen kein bisschen, dass es im Osten der Ukraine einen Krieg gab. Doch kaum konnte man nicht mehr beruhigt und sorglos in den Urlaub nach Thailand fliegen, war die Aufregung groß. Nun war der Krieg auch für einen kurzen Moment im Westen angekommen. Es war schlimm genug, dass für diese Erkenntnis überhaupt Menschen ihr Leben verloren hatten.
Lev hatte mir über den seit inzwischen Monaten andauernden Konflikt schon lange vor diesem Vorfall berichtet.
Er schickte mir Bilder und Videos von zerstörten Häusern und ausgebrannten Autos. Er schickte mir die Bilder vom Leid der Bevölkerung und vom Leid seiner selbst. Er schickte mir auch Berichte über die ersten Todesopfer aus seinem Bekanntenkreis.
Es war schrecklich einfach nur dazusitzen und zuzusehen. Es war ein Gefühl der Machtlosigkeit, aber auch ein Gefühl der Wut, nichts dagegen ausrichten zu können.
So ging der Konflikt und die Zerstörung letztendlich weiter. Es schien, als hätte man sich damit arrangiert, dass es im Donbass einen Krieg gab.
Mittlerweile war es Januar 2015.
Levs Berichterstattungen und Aussagen gaben mir zusehends zu Denken. Denn es waren nicht die Art von harmlosen Bildern und Berichten, die es in der Tagesschau zu sehen gab.
Außerdem machte Lev mittlerweile einen sehr labilen Eindruck. Er schien, als wäre er kurz davor durchzudrehen. Die erneuten schweren Kämpfe zeichneten ihn und hatten ihn beinahe um den Verstand gebracht. Die Tatsache, dass mit einem Mal alles weg und anders sein kann, nagten an ihm.
Er war mittlerweile an einem Punkt angelangt, an dem er Donezk ebenfalls vorübergehend verlassen wollte. Zumindest so lange, bis etwas Ruhe eingekehrt war.
Doch zu seinem Bruder nach Mariupol wollte er keinesfalls gehen. Dort war die Situation ähnlich bescheiden. In Kiew bei seiner Schwester und den Eltern wollte er sich auch nicht blicken lassen. In der Enge und der kleinbürgerlichen Atmosphäre würde er erst recht verrückt werden. Außerdem käme es ihm so vor, als renne er vor seiner Verantwortung davon und würde sich vor ihr verstecken.
Lev wollte nichts weiter als eine kurze Auszeit von allem. Zeit um wieder zu sich zu kommen und sich zu erholen. Und vor allem brauchte er Zeit, um von den enormen Problemen und Erlebnissen einen Abstand zu erhalten. Abstand und Ablenkung.
In der Ukraine würde er diese nicht bekommen. Alles dort erinnerte ihn an den Konflikt und an seine verlorene Heimat. Die Situation war schwierig.
Ich schrieb mit Lev über unsere alten Zeiten in Ostpolen und machte den Vorschlag, warum er nicht für ein paar Wochen zu seinem Onkel in die alte Datsche fahren würde. Die Zeit in der Natur würde ihm sicher gut tun und er würde in erster Linie viel Ruhe vor allem haben.
Lev hingegen hielt die Idee für unpassend. Ruhe wäre in dieser Situation ebenso falsch und unerträglich für ihn.
Auch in der Ruhe würde er verrückt werden, wenn er keine Menschenseele zum erzählen hätte. Was er braucht ist Abstand und Ablenkung. Aber keine Ruhe. Wenn er beispielsweise alleine daheim war, drehte er den Fernsteher so laut auf, dass man ihn bis hinunter auf die Straße hören konnte. So sehr mied er die Ruhe.
Lev wirkte von Tag zu Tag verzweifelter.
Letzten Endes machte ich ihm den Vorschlag, ob er sich nicht darüber freuen würde, einmal nach Deutschland zu Besuch zu kommen. Er könne dann auch einmal sehen, wie das Leben hier in Heidelberg so wäre. So, wie er mir vor einem Jahr noch sein „altes“ Donezk gezeigt hatte. In Heidelberg hätte er zudem genügend Abstand und Ablenkung vom Konflikt daheim.
Lev freute sich über meinen Vorschlag und die Einladung, reagierte dennoch verhalten. Er würde den Besuch zu einem späteren Zeitpunkt gerne in Angriff nehmen. Warum er so distanziert reagierte, bei all den großen Problemen in Donezk, konnte ich bis heute nicht nachvollziehen.





























