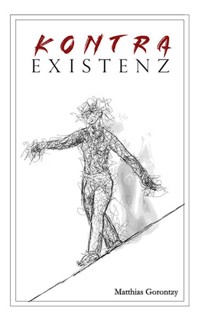
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Tim ist auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespräch bei dem renommierten Unternehmen Kirke Enterprises, das ihm eine vermeintlich rosige Zukunft in Aussicht stellt. Aber etwas lässt ihn schwanken. Er steht an einem inneren Scheideweg zwischen Wollen und Sollen, Vergangenheit und Zukunft, zwischen konstruierten Wahrheiten und seiner Suche nach einem höherem Sinn. Eine innere Odyssee beginnt...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Kontakt
Social Media
instagram.com/matthiasgorontzy/
facebook.com/matthiasgorontzy/
Website
matthiasgorontzy.de
Impressum
© 2019 Matthias Gorontzy
Cranachstr. 67, 45147 Essen
ISBN: 9781697998924
Umschlaggestaltung und Satz: Frau Scheel (www.frauscheel.de)
KAPITEL I
Kant ist ein arschloch
Der Mensch verbringt durchschnittlich 6,2 Jahre vor dem Fernseher. Jahre! Man lasse sich das auf der Zunge zergehen. Nehmen wir an, ein kleiner Junge wird geboren. Er wird bis zu seiner Einschulung also nichts anderes machen, als Fernsehen. Er wird nicht die Welt entdecken, in Pfützen springen, sein Umfeld zum Strahlen bringen, Freunde finden. Nein, er wird Fernsehen. Wenn man sich dann vor Augen hält, dass er wahrscheinlich im Gegenzug dafür nur etwa 4239 mal Sex haben wird, ist das schon eine traurige Bilanz. Sagen wir ein Akt dauert durchschnittlich, mit ein wenig Vor– und Nachspiel, 30 Minuten. Dann hat der arme Junge gerade mal etwa 88,31 Tage Sex in seinem Leben, sieht aber 6,2 Jahre fern. Wenn man sich überlegt, was man allein in einer Stunde im Fernsehen vorgesetzt bekommt, hat man sich am Ende seines Lebens, nach 6,2 Jahren Fernsehen, soviel Unsinn in die Rübe gebuttert, dass man wohl freiwillig die Augen schließt.
Na ja, vielleicht hat man ja auch einen Großteil der 26.838 Flaschen Bier in diesen 6,2 Jahren konsumiert, um sich zu betäuben und das Ganze zu ertragen. Aber mal ehrlich, während wir vielleicht gerade die 2780. Rolle Klopapier von unseren durchschnittlich 3651 im Leben anbrechen oder das erste von zwei Jahren vor dem Spiegel beenden: ist das alles? Gerät ein älterer Herr vielleicht eines Morgens mit seiner Sonntagszeitung auf dem Klo ins Grübeln: Oh, das ist schon meine 3645te Rolle, jetzt wird es langsam eng?
Beschreiten wir gedankenlos diese vermeintlich perfekt geplanten, statistisch erfassten und idealisiert normierten Bahnen und das war es dann? Ich meine mal ehrlich, wenn man in unserer Zeit, in der man idealer Weise stets jung, dynamisch, flexibel, mobil und vor allem belastbar sein sollte und dies mindestens 8 Stunden am Tag, abzüglich der spärlichen Wochenenden und lächerlichen Urlaubstage, mindestens 235 Tage im Jahr und man dann noch die 6,2 Jahre Fernsehzeit und alles weitere abzieht, dann bleibt nur ein Bruchteil von dem übrig, was ich heute als leben bezeichnen würde. Ein Hauch, ein Vorbeihuschen eines Augenblicks gemessen daran. Und so wird es einem dann vermutlich irgendwann auch vorkommen, eines Morgens mit der Sonntagszeitung und der vielleicht 3645ten Rolle Klopapier in der Hand.
„Die Fahrscheine bitte“, riss der Schaffner mich aus meinen Gedanken.
„Den Fahrschein“, wiederholte er mit etwas Nachdruck und sah mich fast schon genervt an.
Ich kramte hektisch in der Brustinnentasche meiner Jacke und suchte mein Ticket. Als ich es herauszog, fiel allerlei Papier auf den Boden. Kontoauszüge, kleine Notizen, Rabattmarken des Cafés, in dem ich regelmäßig verweilte und eine verblichene Nummer von einem Mädchen, das ich längst vergessen hatte. Ich streckte ihm genervt mein Ticket entgegen, auf dem ich aussah, als hätte man mir für das Lächeln eine Pistole an die Schläfe gehalten. Der Schaffner nickte und schob unbeholfen weiter seinen Wagen vor sich her, der mit Kaffee, allerlei Snacks und sogar Bier beladen, viel zu breit für den schmalen Gang war, der zudem auch noch, wie immer, mit einer Vielzahl von Taschen und Koffern zugestellt war.
Ich sammelte meine heruntergefallenen Sachen auf und steckte sie zurück ins Dunkel meiner Tasche. Die Frau mittleren Alters, die mir gegenüber saß, blickte kurz von ihrem Buch auf. Mittsommerträume stand in geschwungenen Buchstaben darauf.
Die „Brigitte“ auf ein paar hundert Seiten gestreckt, meckerte ich in Gedanken und zog die Augenbrauen zusammen. Ohnehin hielt sie es doch nur in der Hand, um bloß nicht bemerkt oder gar angesprochen zu werden, dachte ich. Oder sie hatte die Lesefertigkeit eines Grundschülers bei der Geschwindigkeit, wie sie die Seiten umblätterte. Lieber stur auf ein paar Seiten Papier starren, als sich Blicken stellen zu müssen oder gar mehr.
Die Welt ist voller Soziopathen, vor allem da, wo es die meisten Menschen gibt. Haben wir so sehr Angst vor der vernichtenden Meinung anderer? Entscheidet sie im Endeffekt über unser Menschsein, über Sein oder Nichtsein womöglich?
Ich stellte mir vor, dass ich entscheiden müsste, dass ich urteilen müsste über diese Frau, die schon seit knapp fünfzig Minuten krampfhaft versuchte, so wenig von mir wahrgenommen zu werden wie möglich und jedes Mal demonstrativ umblätterte, wenn sie einen meiner Blicke bemerkte.
Ich fragte mich, was sie so ängstlich machte. Ob sie etwas zu verbergen hatte? Außer ihr verletztes und gedemütigtes Menschsein vielleicht?
Ich sah mich auf einem viel zu großen Richterstuhl sitzend und auf sie herabblickend, wie sie dasaß, auf einem viel zu kleinen Stuhl, immer noch ihr Buch in der Hand und hoffend, ich würde sie vielleicht nicht bemerken. Nur ab und an ängstlich aufschauend, um zu kontrollieren, ob ich noch da war, ein Urteil gefällt oder sie mit etwas Glück ihrer Unscheinbarkeit überlassen hatte, versteckt hinter vielleicht knapp 500 Seiten beschriebenen Papiers.
Würde ich über ihr Sein entscheiden? Vielmehr über das etwas zu Sein, etwas darzustellen? Ich musste urteilen, um ihretwillen. Denn würde ich denn nicht nur durch mein Urteil, egal wie es ausfiel, erst ihr Dasein sichern und ihr einen Platz zuweisen, eine Nische kreieren, in der sie sich dann gefälligst in ihrer Rolle zu bewähren hatte? Gründet sich alles, was über unsere einfache Existenz hinaus geht, nur durch das Urteil anderer Menschen, machen sie uns letztendlich allein zu dem was wir sind? Ich fühlte Ekel in mir aufsteigen, aber gleichzeitig auch ein tiefes Mitleid.
Ich beschloss, mir etwas die Beine zu vertreten, um mich nicht, wie so oft, noch weiter gedanklich hoch zu schaukeln. Ich ließ mein spärliches Gepäck zusammen mit meiner Sitznachbarin in dem kleinen Abteil zurück und lief langsam den Gang hinunter. Wobei diese Art der Fortbewegung eher einem Taumeln oder Schlingern wie auf einem Schiff glich, da, neben dem Geruckel der Bahn, auch mir die zahlreichen Gepäckstücke zu schaffen machten. Ich blieb eine Weile an einem Fenster stehen. Der Zug entfernte sich mehr und mehr von Hamburg, vom Haus meiner Eltern, von meinen Freunden, meiner Heimat. Bis München war es noch eine lange Fahrt und ich noch so verworren darüber, was mich dort erwarten würde. Nachdenklich schaute ich hinaus. Die Landschaft flog vorbei und nur die Ferne erlaubte einen längeren Blick in die Welt, die der Zug passierte.
Ich war immer schon jemand gewesen, der es liebte, in die Weite zu sehen, den Horizont abzusuchen. Ich wusste nicht einmal nach was, aber es gab mir ein Gefühl der Ruhe. Vielleicht liebte ich auch deshalb das Meer so sehr, weil es das Einzige war, was einem zumindest ein Gefühl von Unendlichkeit, von Grenzenlosigkeit geben konnte. Wo sich doch sonst alles so eng, so begrenzt und vergänglich anfühlte. Auf dem Meer war das anders. Der Blick fällt in alle Richtungen in die Weite, nichts von den Belangen der Welt hat hier Bedeutung. Ich verband eine unglaubliche Sehnsucht damit, eine Faszination und Anziehung, als sei etwas da draußen, als könne ich irgendwann sehen, was ich suchte, wenn ich nur lange genug hinausblickte. Ich bildete mir manchmal ein, wenn ich mich möglichst nah ans Ufer wagte, auf den äußersten Vorsprung eines Felsens, könnte ich vielleicht den letzten Meter machen, um die Erdkrümmung zu überlisten.
Doch die Brandung war stark an diesen Plätzen und Mut und Ausdauer begrenzt. So zogen sich die meisten Menschen, wie ich selbst auch, im Laufe ihres Lebens wieder mehr ins Landesinnere zurück, an vermeintlich sicherere Orte. Und auch wenn ich immer noch nicht sehen konnte, konnte ich den Blick nie ganz abwenden. Ein Teil von mir schien immer dort zu stehen, hin und her gerissen zwischen der Faszination der wilden Freiheit und den Geschichten von einem sicheren Hafen. Aber dieser Teil schien dort so tief verwurzelt, dass mein eigenes inneres Meer stark in Aufruhr geriet, wenn mich Müssen und Sollen auf der anderen Seite zu weit davontrugen und ich förmlich innerlich verzweifelt hinaus schrie: Hey, wartet! …Ich bin immer noch hier, auf dem Felsen der ersten Brandung und suche den Horizont ab!
Schon immer zog es mich hinaus. Schon als ich noch ganz klein war, steckte der Aufbruch tief in mir. Wenn meine Eltern geplant hatten, mit uns in den Urlaub zu fahren oder irgendwo Verwandte zu besuchen, Hauptsache weiter weg als der kleine Kiosk am Ende der Straße, der damals das Ende meiner Heimatwelt markierte, so war ich der erste, der um sechs Uhr in der Früh den großen Koffer in das Schlafzimmer meiner Eltern schleifte und zuerst schon einmal mich selbst einpackte. Es konnte einfach nicht schnell genug gehen.
Als ich gerade auf meinem kleinen Rädchen fahren konnte, war es schwer, mich von abenteuerlichen Expeditionen in die Nachbarschaft abzuhalten, wenn man mich ein, zwei Momente zu lange aus den Augen ließ.
Einmal spielte ich an einem schönen Sommertag auf dem Hof hinter unserem Haus und planschte abwechselnd in einem dieser orangenen Kinderpools oder schraubte an meinem Fahrrädchen, wie ich es bei meinem Opa gesehen hatte. Natürlich tat ich dies unter den Augen meiner Mutter, die mich vom Küchenfenster aus beobachtete, während sie das Mittagessen vorbereitete. Aber selbst das Abgießen der Nudeln dauerte einen Hauch zu lange und ich witterte meine Chance. Als meine Mutter hinauskam und nach mir rief, erhielt sie keine Antwort.
Es dauerte eine Weile bis unsere 82–jährige Nachbarin, die von ihrem Adlerhorst im dritten Stock natürlich alles beobachtet hatte, die Treppen nach unten genommen hatte und meiner Mutter lachend verkündete: „Sie suchen ihren Sohnemann? Der fährt mit nacktem Hintern die Straße runter!“
Und so war es auch. Ich sah die Gelegenheit, nutzte sie und fand, dass es sowieso eine super Idee war, doch mal eben beim Kiosk vorbei zu sehen. Die Tatsache, dass ich dabei wirklich nur ein Hemd trug und in der Eile die Hose wohl vergessen hatte, störte mich herzlich wenig. Allgemein schien ich von Hosen in dem Alter nicht viel gehalten zu haben, was eine ganze Fotoreihe über mehrere Jahre belegt. Meine Mutter sah das leider weniger so wie ich und nahm die Verfolgung auf. Kurz vor dem Büdchen holte sie mich ein und ich hatte nur wenig Verständnis dafür, warum ich mein Vorhaben wegen einer fehlenden Hose abbrechen sollte. Aber Mamas Wort war nun einmal Gesetz. Letztendlich wäre mein Plan wohl spätestens dann gescheitert, wenn ich in die Hosentasche hätte greifen wollen, um zu bezahlen.
Meine späteren Trips und Reisen, die den kleinen Kiosk dann endgültig zu einem verblassenden Punkt in der Erinnerung an diese kleine Welt machten, waren dann zumindest grundsätzlich etwas besser geplant. Aber viel hatte sich nicht verändert. Ich wollte immer los, Neues entdecken. Als würde ich einem permanenten Ruf aus der Ferne folgen, der offensichtlich meinen Namen kannte. Was bei mir als Kind noch einfache unreflektierte Impulse auslöste, wuchs über die Jahre zu einem Fernweh und einer Sehnsucht heran, die manchmal viel zu groß für mich allein wirkte. Ich war dankbar für jedes kleinste Verlassen der engen Bahn, die wir Tag für Tag durch unseren Alltag zogen. Für jeden Blick über den Tellerrand, jeden neuen Impuls, der mich meiner großen Frage, wenn auch nicht immer sofort in einem klaren Sinnzusammenhang, innerlich näher zu bringen schien.
Ich war für mein Alter schon viel herum gekommen, weil ich nicht nur jede Gelegenheit nutzte, sondern bei Zeiten auch jeden schwer verdienten Euro investierte und eigentlich nahezu immer mit dem Rucksack reiste. Hier spürte ich den Puls des wahren Lebens und saugte jeden Moment in mich auf. Ich liebte es, Menschen zu begegnen, die völlig anders waren, die mich heraus rissen aus meinem Mikrokosmos, in dem ich immer wieder gefühlt versumpfte, je länger ich mit der Gleichförmigkeit des Alltags trieb. Von ihren Träumen, Hoffnungen und Ängsten zu hören, davon, wie sie die Welt sahen, war das, was mich inspirierte und mit Lebendigkeit erfüllte. Man entdeckt völlig neue Welten, wenn man abseits der ausgetretenen Pfade reist. Es gibt so viel mehr, als wir erahnen, aber dafür musste man sich auf den Weg machen.
Dabei musste ich immer wieder an meine längere Reise durch Asien denken. Einmal landete ich auf den so genannten 4000 Islands in Laos. Die 4000 Islands sind eine Vielzahl von kleinen Inseln, die sich im Laufe der Zeit im südlichen Mekongdelta gebildet haben und teilweise bewohnt sind. Da die Menschen dort erst seit drei Jahren vor meinem Besuch ans Stromnetz angeschlossen wurden, lebten sie dort noch in sehr einfachen Verhältnissen und der stetige Ansturm an Touristen war ihnen noch weitestgehend erspart geblieben. Hier wurde mir zum ersten Mal wirklich bewusst, wie falsch wir mit so Vielem liegen und dass man wirklich anders leben kann. Die Menschen dort hatten nicht viel und lebten vor allem von dem, was der Fluss ihnen schenkte und dem, was sie auf ihren Feldern anbauten. Ich habe in diesen Tagen, neben Reis, vor allem Fisch, kleine Bananen, Mangos und Früchte gegessen, die ich bisher nicht einmal kannte. Ich habe in meinem ganzen Leben wahrhaft niemals offenere und freundlichere Menschen getroffen. Und ich spreche nicht von der Freundlichkeit, wie man sie in einem guten Restaurant erwartet. Diese Leute hatten eine Freundlichkeit, die förmlich aus ihnen herausschien, die so echt war, so authentisch, dass es fast schien, als könne sie Materie annehmen. Und auch, wenn ich mich so gut wie gar nicht unterhalten konnte, denn fast niemand konnte auch nur ein paar Worte Englisch, so fühlte ich mich nie allein und habe rückwirkend das absurde Gefühl, ich hätte lange angeregte Konversationen geführt.
Eines Abends etwa saßen einige junge und alte Männer zusammen und spielten ein Kartenspiel. Sie winkten mich heran und wollten, dass ich mitspiele. Aber die wenigen Worte Englisch und auch die intensivsten Versuche von Zeichensprache reichten leider nicht aus, um mir die Regeln wirklich näher zu bringen. Nachdem ich eher ratend einige Karten abgelegt hatte und das Grinsen der Mitspieler immer breiter geworden war, beschloss man, dass ich dann wenigstens einen mit ihnen trinken müsse. Das konnte ich, da war ich sicher. Schon der erste Schluck der klaren Flüssigkeit, die man wie einen Schnaps herunterkippte, brannte mir gefühlt die Speiseröhre weg, was natürlich, in Hinblick auf mein Gesicht, erneut für Ausgelassenheit sorgte. Ich beruhigte mich damit, dass alle dies offensichtlich nicht zum ersten Mal tranken und noch sehen konnten und auch sonst keine sichtbaren Ausfälle hatten. Nach dem Dritten musste ich dann aber doch einmal, so gut es ging, nachfragen, was genau das denn sei.
Der junge Mann, der schon so beherzt versucht hatte, mir die Spielregeln zu erklären, sagte schließlich: „Snake Whiskey!“
Ich nickte, guckte aber weiter fragend, da ich auf mehr als den Namen gehofft hatte. Dies wurde sogleich erkannt und eine riesige Glasflasche unter dem Tisch hervor geholt. Daraufhin verzichtete ich auf weitere Fragen, weil neben der klaren Flüssigkeit eine riesige Königskobra in der Flasche konserviert war. Mein Gesicht sorgte allerdings erneut für umfassende Erheiterung.
Ich habe an dem Abend noch so einiges gelernt. Zum Beispiel wie es ist, tausende Kilometer von daheim unter freiem Himmel mit völlig fremden Menschen zu trinken, die kein Wort von dem verstehen, was du sagst und dich dabei trotzdem zu fühlen, als wärst du unter geliebten Freunden.
Als ich an diesem Abend etwas angeheitert zurück in mein bescheidenes Quartier lief, kam ich an den Obstständen des kleinen Marktes vorbei, die immer noch prall gefüllt waren, obwohl alles schlief. Der einzige Dieb in dieser Nacht war eine Kuh, die sich über die saftigen Mangos freute. So schön und zugleich absurd mir die Zeit dort vorkam, so sehr zeigte sie mir, dass mein innerstes Gefühl des Misstrauens unserer Lebenswelt gegenüber begründet war.
Es lag ein unendlicher Friede in dieser Einfachheit und machte mir bewusst, wie wenig ich eigentlich brauchte, um glücklich zu sein. Vielmehr, was ich alles nicht brauchen konnte dafür. Einfach zu sein, bewusst da zu sein, dieses Gefühl lag da draußen in der Welt.
Wenn mich daheim der Wahnsinn des Alltags bei Zeiten übermannte, erinnerte ich mich darum oft an meine Reisen und an das, was ich dort alles erfahren durfte.
Manchmal sehnte ich mich dann zurück zu einem meiner Lieblingsorte, an dem eines Abends etwas mit mir geschah, dass ich nie richtig verstehen konnte, aber niemals vergessen sollte. Dieser Ort befand sich auf einer kleinen Insel vor der Küste Thailands. Sie war nicht ganz so verlassen wie die 4000 Islands, aber dennoch abgelegen genug, um die Stille zu hören. Ich wohnte in einer kleinen Bambushütte direkt am Strand, die ich von einer alten thailändischen Lady gemietet hatte und die eine gute Viertelstunde Fußmarsch von allem anderen entfernt lag. Sie war umgeben von Palmen und kleinen knochigen Bäumen, die zu Recht den Namen Strandgardienen trugen. Der Boden war um die Hütte herum und die wenigen Meter bis zum Strand von feinem, weichem Strandgras bedeckt und nur hier und da lagen ein paar heruntergefallene Kokosnüsse. Ich konnte mir das Paradies, wenn es so etwas geben sollte, nicht anders vorstellen.
Eines Abends, als die Dämmerung sich schon fast zur Nacht neigte, zog ein Gewitter auf. Ich stand im Meer, während es wie ein tropisches Ungetüm hinter den vom Dschungel bedeckten Hügeln aufzog. Zunächst schien alles noch stiller zu werden, wie bei der besagten Ruhe vor dem Sturm. Es war nahezu windstill, nur die ungewohnt hohen Wogen erhoben und senkten sich in einer faszinierenden Gleichmäßigkeit um mich herum und verrieten, dass ein mächtiger Wind sie in der Ferne angestoßen haben musste. Langsam kamen erste, leicht kühle Böen auf und strichen über mein Gesicht. Ich war hellwach mit all meinen Sinnen und doch wie in einer Trance. Über den Hügeln fingen Blitze an zu zucken und erhellten in überwältigenden und bizarren Formen die schon fast verschwundene Dämmerung. Mit ihnen grollte der Donner, noch etwas zurückhaltend, aber langsam immer näher heran. Der Wind wurde etwas stärker und wie plötzlich angestellt, setzte der Regen ein. Ein warmer, faden-artiger Regen, der sich in die Gleichmäßigkeit der Wellen einfügte. Ich spürte, wie er an mir herunter rann und sich dem Meer anschloss. Und plötzlich geschah es. Es war, als würde die Zeit stoppen, als würde sich alles verlangsamen und in eine andere Sphäre schwappen. Als würde das Meer meinen Atem und der Regen die Gleichmäßigkeit meines Herzschlages annehmen. Und auf einmal war es so, als würde da draußen für einen Moment alles einen Sinn machen, als wäre ich wahrhaftig ein Teil von allem und alles ein Teil von mir. Ohne denkbare Antworten, ohne Erklärung, ohne, dass ich den Schlüssel dazu hätte erfassen können.





























