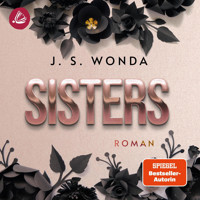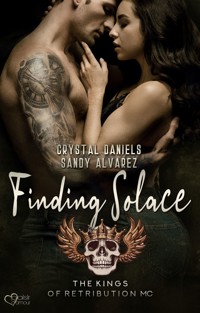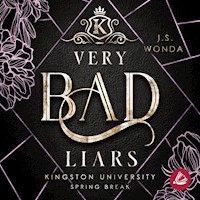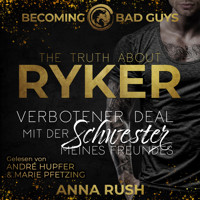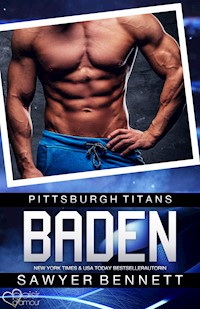Kopfgefickt
Im nächsten Leben
Miro Lippoldt
Copyright © 2024 Miro Lippoldt
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlaggestaltung: inspirited books Grafikdesign: www.inspiritedbooks.at
Impressum
Miro Lippoldt
Heiligenstädter Moos 8
93333 Neustadt an der Donau
⚠️ Triggerwarnungen befinden sich auf der letzten Seite ⚠️
WIDMUNG
Für alle, die mehr Wolken sehen als Sonnenschein.
Für alle, die glauben, sie haben keine Hoffnung verdient.
Für alle, die denken, es wird nie besser.
Gebt dem Leben eine Chance.
Gebt euch selbst eine Chance.
Kapitel 1: Linus – Wolken
Jetzt
Ich hoffe nicht mehr, dass wir uns wiedersehen. Bedeutet das, dass ich über ihn hinweg bin?
Oder, dass ich die Hoffnung verloren habe?
Es ist seltsam. Kurz nach meinem Suizidversuch, genau vor einem Jahr, zwei Monaten und vierzehn Tagen, stand ich hier oben und habe mich gefragt, ob das alles Sinn ergibt. Ob ich es schaffen werde. Ich habe mir eingeredet, Hilfe anzunehmen und in diese Klinik zu fahren.
Und jetzt sieh mich an.
Ich bin stolz auf mich.
Noch immer gibt es dunkle Tage, doch die grauen Wolken ziehen vorüber.
Manchmal schneller, manchmal langsamer.
Ab und zu schweben sie eine Weile über mir und rühren sich nicht.
Aber sie ziehen weiter.
Jedes Mal.
Kurz nachdem ich aus der Klinik zurückkehrte, feierte ich meinen neunzehnten Geburtstag. Ich war noch immer hoffnungslos, doch ich habe gelernt, mich an den kleinen Freuden im Leben festzuklammern. Nun werde ich in ein paar Tagen schon zwanzig Jahre alt.
Und ich bin froh, dass ich das alles aufgeschrieben habe – diese Reise, die nach meinem Suizidversuch begonnen hat. Ich darf nicht vergessen, was ich geschafft habe.
So kann ich immer darauf zurückblicken – vor allem in den Nächten, in denen ich wieder aufgeben will.
Heute ist eine dieser Nächte, in denen ich mich frage, ob es nicht doch besser wäre, wenn ich tot wäre.
Deshalb lese ich noch mal meinen Journal-Eintrag, den ich geschrieben habe, als ich wieder kurz vor dem Aufgeben war.
Damals
Okay, wie mache ich das?
Ähm … vielleicht starte ich mit Hey Sonnenschein? Zu cheesy? Zu … intim? Keine Ahnung. Ich vermisse dich. Ich will, dass du etwas hast, das dich daran erinnert, dass du das Richtige getan hast, als du mir das Leben gerettet hast. Vielleicht wird dich das hier nie erreichen. Entweder schicke ich es nie ab oder … du verbrennst es, sobald du es als Brief erhältst. Fakt ist, wir werden uns nie wiedersehen. Vielleicht funktioniert diese ganze Therapie-Scheiße nicht.
Vielleicht bin ich schon tot, falls du das hier jemals liest. Fuck, man. Warum schreibe ich das? Du verdienst etwas Besseres. Ich habe es dir nie gebeichtet, aber es tut mir so unendlich leid.
Falls es dich interessiert: Ich schreibe meine Erfahrung auf, und das hier wird hoffentlich irgendwann als Beweis dafür dienen, dass du mein Leben gerettet hast – nicht nur in dieser Nacht, sondern, dass du mir eine tatsächliche Zukunft geschenkt hast. Dass es etwas gebracht hat, mich zu retten. Nicht dafür, dass ich mich bei der nächstbesten Gelegenheit doch umbringe. Falls das geschieht … falls Mama dir diese Briefe gemeinsam mit einer Einladung zu meiner Beerdigung überbringt, dann sieh diese als Beweis dafür, dass ich es versucht habe. Für dich.
Das alles verdanke ich dir.
Diese Chance.
Diese Hoffnung.
Hinter all den grauen Wolken verbirgt sich Sonnenschein. Das weiß ich. Ich spüre es nur noch nicht. Vielleicht kann ich es nach dem Klinikaufenthalt glauben und fühlen.
Im nächsten Leben machen wir es besser, oder? Bitte sag mir, dass wir uns dann wiederfinden und endlich ein Happy End bekommen. Dann wird ein Kuss die Zeit einfrieren und uns wird die Unendlichkeit geschenkt. Für dieses Leben habe ich mir die Chance verbaut.
Denn vor sechs Wochen habe ich versucht, mir das Leben zu nehmen.
Vor sechs Wochen habe ich meiner ersten Liebe, dir, gesagt, ich will dich nie wiedersehen.
Vor sechs Wochen habe ich versprochen, Hilfe anzunehmen.
Es ist seltsam, das aufzuschreiben.
Diese Nacht hätte mein Ende sein sollen. Stattdessen ist sie jetzt gerade mal der Anfang dieses miserablen Lebens. In den letzten sechs Wochen habe ich dich kein einziges Mal zu Gesicht bekommen. Du bist nicht vor meinem Haus aufgetaucht, weil ich behauptet habe, dass ich dich nie wieder treffen will. Ich musste mich auskurieren und Mama hat mich nicht allein rausgelassen.
Die Erde dreht sich und das Leben geht weiter. Ich hingegen stecke seit dieser Nacht in einer Zeitschleife fest, welcher ich nicht zu entkommen vermag. Geht es dir genauso?
Das ist der Grund, warum ich das alles aufschreibe. Es soll helfen, habe ich gelesen. Damit sich das hier weniger anfühlt wie ein Fiebertraum. Damit ich vielleicht darauf zurückblicken und erkennen kann, was ich geschafft habe – was auch immer ich da sehen soll. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, gesund zu sein. Glücklich. Oder zumindest okay.
Ich habe Mama vorhin um einen Ausflug zu meinem Ruheort gebeten, um etwas Frieden und frische Luft zu erhaschen. Ein letztes Mal, bevor ich mich für einige Wochen in dieser Klinik auf die Therapie einlasse.
Die Wolken hängen tief, sie sind zum Greifen nah – ich strecke mich nicht, denn das würde stechende Schmerzen in meinem Brustkorb nach sich ziehen. Ich hätte nie geglaubt, dass eine Rippe während einer Reanimation tatsächlich brechen kann. Wäre das nicht geschehen, könnte ich die Wolken vielleicht wegschieben und den Sonnenschein auf meinen Schultern spüren.
Und wäre ich nicht so dämlich gewesen, dich aus meinem Leben zu verbannen, würde es vermutlich genügen, wenn du neben mir sitzen würdest. Die Vögel zwitschern nicht. Es ist kalt geworden und der Matsch unter mir ist gefroren.
Alles ist grau und dunkel. So ist es im Winter eben, würde Mama jetzt sagen. Aber genauso sieht es in mir aus. Warum kann niemand akzeptieren, dass ich einfach so bin?
Ich will mich strecken, denn der Schmerz befreit mich. Und ich verdiene es – da sind Riot und ich uns einig. In diesem Moment lasse ich es sein, denn Mama steht hinter mir. Ihr Griff um meine Schultern verfestigt sich und ihre Massage ist wohl Folter für meine versuchte Flucht vor dem Leben. Sie bohrt ihre Finger in meine Muskeln und ich wünsche mir deine federleichte Berührung.
Ohne Begleitung spazieren zu gehen ist mir untersagt. Bis hierher, zu meinem Platz auf dem Berg, kann ich ohnehin nicht allein laufen. Nicht mit einer langsam heilenden Rippe und einem nach Wochen immer noch schwachen Körper.
Mama hat mich mit dem Auto hergebracht, nachdem wir eine halbe Stunde diskutiert haben. Nun wacht sie über mich wie ein Geier über Aas. Mann, ich wünschte, die Insekten würden meinen Körper zerfressen, würden mich zurück in die ewige Schleife des Lebens geleiten. Vielleicht wird es mir im nächsten Leben besser gehen. Den Gedanken schüttele ich ab. Ich habe nur dieses eine Leben. Diese eine Chance.
Stattdessen kicke ich gegen die Steine, die am Boden festgefroren sind. Mit den Fingern kratze ich das Eis von der Bank unter mir. Unter meinen Fingernägeln sammelt es sich und schmilzt langsam. Ich will leben. Ich will leben. Ich will leben, rede ich mir ein.
›Willst du nicht. Willst du nicht. Willst du nicht‹, hält Riot dagegen. ›Du bist es nicht wert.‹
Mama quasselt permanent, tritt immer wieder neben mich, ohne ihre Hände von mir zu nehmen. Sie beugt sich von hinten über die Bank und sieht mich an, als verrate mein Ausdruck meine – hoffentlich unausgesprochenen – Gedanken, Gefühle und die als nächstes geplante Sünde. Ich hoffe, ich habe nicht wieder laut gedacht.
Die Vögel, die keine Zuflucht im Süden suchen, zwitschern im Schutz der Baumkronen. Der Wind wirbelt meine Haare umher. Tief atme ich ein. Die Kälte schmerzt in meinem Hals. Alles schmerzt irgendwie. Die Taubheit hat mich noch nicht verlassen – nur nachts, wenn ich auf den Schlaf warte, verabschiedet sie sich für ein paar Stunden und lässt mich mit einem gebrochenen Herzen zurück. Manchmal erlaubt es mir sogar, Tränen zu vergießen. Alles ist mir lieber, als nichts zu fühlen.
Und da sind wir wieder beim Thema. Leo hat letztens, als ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, gefragt: »Willst du wirklich sterben oder willst du nur, dass der Schmerz aufhört?«
Ja, verdammt noch mal, ich will leben. Ich will mit dir zusammen sein, Ruben, und nicht ununterbrochen Riots Stimme hören. Ich will mit dir Händchenhalten, ohne mich widerlich zu fühlen. Ich will mir nachts nicht überlegen, ob ich mir den Schwanz abschneiden sollte. Ob schwul zu sein nicht vielleicht doch eine Entscheidung ist.
Während die Vögel zwitschern und Mama quasselt und ich sie ausblende, ist es still. Riot sagt kein Wort mehr, hat keins übrig, ohne wie eine kaputte Schallplatte zu klingen. Er hat alles herausgeschrien, alles erreicht.
Mein Leben liegt in Schutt und Asche. Ich bin am Leben.
Das ist das Problem.
Seit ich nach meinem Suizidversuch vor einigen Wochen in einen wahllosen Zug gestiegen bin, ist Mama anhänglich. Sie lässt mich nicht mehr allein aus dem Haus, außer zum Rauchen. Im Badezimmer und in meinem Zimmer hat sie die Schlösser entfernen lassen und sie fragt mich ständig, ob es mir gut geht.
Ob es mir wirklich gut geht und ob es mir wirklich, wirklich gut geht.
Und jetzt redet sie wieder einmal davon, dass die Leute in der Klinik mir helfen werden. Als ich sie vorhin gebeten habe, mich hierherzubringen, war es nicht das, was ich meinte. Also hebe ich den Finger an meine Lippen und Mama verstummt. Für zwei Sekunden und ein halbes Einatmen meinerseits.
»Was brauchst du, mein Schatz?« Hastig lehnt sie sich wieder vor. Ihre Stirn ist in Falten gelegt, ihre Augen strahlen Besorgnis aus. Sie umfasst meinen Arm, als würde ich jeden Moment losstürmen und mich über die Leitplanke in den Abgrund stürzen. Ihre Brüste hängen über die hölzerne Rücklehne. Ihre lockigen Strähnen kitzeln meinen Nacken und der Geruch ihres Parfüms brennt in meiner Nase. Tief atme ich ein. Vielleicht bewahrt die eisige Luft mein Blut davor, überzukochen?
Ich hasse es, dass sie mich neuerdings »Schatz« nennt. Keineswegs bin ich ein Schatz – höchstens ein Wrack, das den Schatz tief in sich trägt. Das Wertvolle in mir wurde bereits vor Jahren entwendet. Und ich blieb zurück als widerlicher Müll in einer Welt voller Diamanten.
Den Finger drücke ich fester auf meine Lippen und Mama verstummt abermals. Natürlich nicht, ohne sich sieben Mal zu entschuldigen.
Genau hier habe ich vor wenigen Wochen auf den Tod gewartet. Genau hier hast du auf mich eingeredet. Genau hier hast du mich zum letzten Mal geküsst und bist Zeuge meiner Tat geworden. Wurdest gezwungen, zu realisieren, dass alles noch viel, viel schlimmer war, als wir beide es uns eingestanden haben. Wie es dir wohl damit geht? Hast du mich schon vergessen, oder denkst du auch immerzu an mich?
Während die Hoffnungslosigkeit an mir knabbert, klammere ich mich an die Erinnerung und die schönen Momente. Ich will über die vereiste Leitplanke vor mir streichen. Sicher ist sie glatt und rutschig. Ich will mir vorstellen, meine Fingerkuppen seien Ski und meine Hand ein Stuntfahrer.
Aber mir fehlt die Kraft und Mama würde es sowieso nicht zulassen. Ihre Angst, mich zu verlieren, regiert sie, seit ich ihr ein Leben ohne mich zugemutet habe.
Also gebe ich mich zufrieden mit dem Geruch der Kiefern, dem Gesang der Vögel und dem Blick auf die Rinder, die in der Ferne des Tals unter uns ihr Dasein fristen, wie ich es mache. Du hattest recht: Meine Aufmerksamkeit auf die kleinen Dinge im Leben zu richten, hilft. Ich würde diese Einsicht gerne mit dir teilen und dir danken. Aber dafür ist es nun zu spät. Ob du diese Zeilen je lesen wirst?
›Hast du schon etwas Nützliches getan?‹, fragt Riot.
Fast zucke ich zusammen. Wie konnte ich ihn vergessen? Ich runzele die Stirn.
Riot sitzt nicht in der Schwärze meines Kopfs auf dem Sessel, wie sonst. Stattdessen steht er vor dem Abgrund hinter der Leitplanke und stützt die Ellenbogen darauf ab. Sein Kopf ruht auf dem Metall, als sei auch er müde. Als sei das alles ein lästiger Job, den wir gemeinsam erledigen müssen.
Seh ich aus, als wäre ich dazu in der Lage?
Sofort bereue ich meine Antwort. Ich habe mir vorgenommen, nicht mehr zu reagieren. Wenn ich Riot nicht loswerden kann, muss ich ihn wenigstens wie das behandeln, was er ist: ein Hirngespinst, eine Erfindung, ein dummer Gedanke, den ich loslassen muss. Aber so einfach ist das nicht.
Genauso wenig fällt es mir leicht, dich aus meinem Kopf zu verbannen, Sonnenschein.
›Du lebst noch.‹ Er zuckt mit den Schultern. ›Und du scheinst das mit dem Gesundwerden ernst zu meinen – was auch immer das heißen soll. Wenn du etwas Nützliches tun willst, solltest d…‹
Mich umbringen, jaja. Halt die Fresse. Gedehnt seufze ich.
»Ist alles in Ordnung, Schatz?«, fragt Mama und streicht mir durch die Haare. Für einen Moment lasse ich die Vorstellung zu, dass es deine Hand auf meinem Kopf ist.
Riot springt über das Geländer und plumpst neben mir auf die Bank.
›Ja.‹ Ein Grinsen umspielt seine Lippen. ›Es wird langweilig in deinem Schädel. Glaubst du, ich will hier sein?‹
Ich werde dich bald los, sage ich innerlich. Wenn diese scheiß Therapie hilft, zumindest.
Der Druck auf meine Schultern verstärkt sich. Ich muss wieder laut gedacht haben.
»Natürlich wird die Therapie helfen. Willst du doch nicht in die Klinik?« Ihr Klang trägt Panik in meine Ohren und bringt mein Herz zum Rasen. Ich hätte ihr nie sagen sollen, dass ich in diese Klinik will. Dass ich mich jeden Tag umentscheide, nagt an ihrer mentalen Gesundheit.
»Ich versichere dir, es wird dir helfen. Und wenn nicht, dann hast du es wenigstens versucht.« Mit jedem Wort nimmt die Furcht ihre Stimme mehr ein. Eilig tritt sie um die Bank herum. Sie fällt neben mich und streichelt meinen Unterarm – so sachte, dass es nervt. Ich schaue auf ihre Hand, wieder zurück, dann in die Ferne.
»Ich bin nicht aus Glas, Mama. Und ich bin kein Baby, das verreckt, wenn du nicht da bist.«
Ein Japsen verrät, was ich schon weiß: Das Thema Tod sollte ich nie mehr ansprechen. Sanft streiche ich über Mamas Handrücken. Eine Entschuldigung rollt über meine Lippen.
Sie sollte in diese Klinik, nicht ich. Ich brauche das nicht, mir kann sowieso keiner helfen. Jeden Tag schwanken meine Gedanken zwischen Klinik und nicht Klinik, zwischen Leben und Tod, zwischen einer falschen Hetero-Zukunft und der Treue zu mir selbst.
»Wir sollten zurückfahren. Du bist schon kalt und solltest dich ausruhen. Zuhause lasse ich dir ein Bad ein. Danach können wir einen Film ansehen. Die Dino-Doku, die du früher so gern angesehen hast, zum Beispiel«, schlägt sie in fragendem Ton vor.
Die haben wir schon dreimal angeschaut diese Woche. Trotzdem bejahe ich. Irgendwie ist es ganz nett. Früher habe ich jeden Tag Dinosaurier-Dokumentationen angesehen, bis ich eingeschlafen bin. Dad hat immer mitgeschaut und mir erklärt, wie die Dinosaurier heißen. Ich konnte die Namen nie aussprechen. Einen Tag vor meinem Outing hat er mit mir noch so eine DVD eingelegt und uns mit Chips und Cola versorgt.
Hätte ich damals gewusst, dass es das letzte Mal sein würde, hätte ich es mehr genossen. Besser zugehört. Ein Foto geschossen oder es aufgeschrieben. Keine Ahnung. Aber hätte ich gewusst, wie beschissen es mir heute gehen würde, hätte ich mich nie geoutet.
Mama hilft mir auf, als wäre ich ein alter Mann, der seinen Gehstock verloren hat.
»Es ist schon sechs Wochen her, Mama. Mir geht’s gut.«
In ihrem Blick liegt Mitleid. Den genervten Ton sollte ich nächstes Mal weglassen.
Der einzige Weg, mich davon abzuhalten, ihren Fängen zu entfliehen und mein Dasein von nun an im Wald zu fristen, ist das Bild von mir selbst als alter Mann, der seinen Gehstock verloren hat. Es erinnert mich an dich – zu oft habe ich einen Opa imitiert, um dich von deiner Angst abzulenken.
Und doch bringt die Vorstellung eine Seite in mir hervor, die ich seit langer Zeit vermisse. Wie ein Jucken im Gehirn, ein Virus, das mich infiziert hat.
Ich bin am Leben. Und ich kann glücklich sein, während ich traurig bin, meine Tage beschissen laufen und ich den Sinn nicht verstehe. So wie du immer gesagt hast, Sonnenschein. Ich begutachte den Smiley auf meinem Handgelenk, den du einst gezeichnet hast – jeden Tag ziehe ich die Linien nach. Mit jedem Mal wird der Smiley ein bisschen mehr zu meinem eigenen, weil ich deine Striche nie perfekt nachmalen kann. Mein Mundwinkel zuckt gegen meinen Willen. Ein warmes Gefühl huscht durch meine Brust.
Ich bin am Leben.
Der Wunsch nach Veränderung, der mich treibt, mich an kleinen Freuden festzuklammern. Dem Rascheln der Blätter im Herbst, dem Geruch von frisch gemähtem Gras im Spätsommer. Dem Sommer, in dem ich mit dir über die Wiesen getobt bin. Dem Fingerskifahren auf einer vereisten Leitplanke vor einem Abgrund, während Mama der Panik verfällt und ich zwischen Leben und Tod mit den Fingern balanciere, den Stunt meistere und von der Menge gefeiert werde. Ist das der Sinn von alldem?
Im selben Moment, in dem mein Hintern unsanft auf den Beifahrersitz plumpst, bereue ich, mich einfach fallen gelassen zu haben. Schmerz zieht sich durch meinen Brustkorb. Es fühlt sich nicht mehr befreiend an. Ebenso wenig die in Minutenschnelle aufgeheizte Karre, die meine Finger gleichzeitig erfrieren und verbrennen lässt. Sie kribbeln unangenehm und es fühlt sich an, als koche mein Blut.
Wie soll ich bei dieser Hitze Ski fahren?
Im Kampf gegen die Verbrennung strecke ich die Hand trotz Mamas Protest aus dem Fenster und spiele einen Windsurfer. Wenn die Kälte überhandnimmt, halte ich die Hand vor die Heizung und wiederhole den Vorgang.
Die endlosen Sommernächte mit Leo und Timo schießen in meinen Kopf. Um die Stimmung zu lockern und Mama zu verstehen zu geben, dass ich in diesem Moment nicht darüber nachdenke, aus dem fahrenden Auto zu springen, drehe ich den Kopf, um ihr davon zu erzählen. Stumm erwidert sie den Blick. Und beginnt zu summen.
Wie immer krame ich in meinem Gedächtnis nach dem Songtitel, doch finde nichts. Zu wertvoll ist der Moment – endlich gibt Mama nichts Sorgsames von sich. Also lausche ich dem Lied meiner Kindheit und drehe mit dem 10-jährigen Timo Runden im Pool. Die Kindheitserinnerung um Leo verschlägt uns in den Skatepark, wo er mich anfleht, ebenfalls auf ein Skateboard zu hüpfen und loszurollen.
Hätten wir uns früher kennengelernt, wenn ich mich darauf eingelassen hätte, Sonnenschein? Ich kann nicht anders, als die Was-wäre-wenn-Fragen zuzulassen. Vielleicht hättest du meinen Dad durchschaut und gesehen, dass ich mich nicht outen sollte. Vielleicht hättest du nie angefangen, dich selbst zu verletzen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht …
Die gedankliche Flucht in ein Paralleluniversum ist das Einzige, das mich bei Verstand hält. Eines, in dem mein Seelenverwandter den Namen meines Ex-Freunds trägt, in dem wir eine Zukunft haben können.
Hättest du verhindern können, dass Dad mich in das Camp schickt? Hättest du unsere Zukunft retten können?
Auf den letzten Gedanken folgt das Wort »Versager«, nicht von Riot, sondern von mir selbst. Ich konnte uns nicht retten.
›Deshalb willst du doch zur Therapie‹, sagt Riot in fragendem Ton. Doch als ich mich umschaue, ist niemand da – weder im Auto noch in der Umgebung, und in meinem Kopf bleibt alles schwarz.
Glaubst du, ich kann uns retten?, frage ich in die Leere, niemanden und jeden, mich selbst, Riot, dich … ich weiß es selbst nicht.
Es spielt keine Rolle. Eine Antwort bekomme ich nicht.
Letztendlich bin sowieso ich derjenige, der die Lösung kennt.
»Mama.«
Sie verstummt. Erst jetzt merke ich, dass wir bereits in unserer Einfahrt stehen. Mamas Hand ruht auf dem Türgriff, aber sie bewegt sich keinen Millimeter, als fürchte sie, mich zu verschrecken. Langgezogen blase ich die Luft aus meinen Nasenlöchern.
»Ich gehe in diese Klinik.« Eine wegwischende Handbewegung später füge ich an: »Und wenn ich mich noch mal umentscheide, zwing mich einfach.«
Kapitel 2: Ruben – Erwachsen
Jetzt
TIERE FÜHLEN. TIERE VERMISSEN. TIERE WOLLEN LEBEN.
In roter Schrift ist es an die Scheunenwand auf dem Hof geschmiert. Ein anderer Schriftzug von letzter Woche an der Stallwand lautet ähnlich. Ich hoffe, dieser Text hier wurde mit anderer Farbe geschrieben, denn den an der Stallmauer bekomme ich seit Wochen nicht entfernt.
Mein Magen verknotet sich. Das Unbehagen quittiere ich mit einem Augenrollen. Der Boden ist glatt, das Gras vereist. Unter jedem meiner Schritte zerbricht eine Eisschicht. Vanti öffnet das Maul und stupst den Ball zu meinen Füßen. Müde hebe ich ihn auf, werfe ihn so weit ich kann und wiederhole den Vorgang, bis wir in der Hofmitte ankommen. Dazu müssen wir vorbei an modrigem Holz, zerrissenen Planen und verschiedenstem Metallschrott auf einem Haufen. Mehr rote Farbe sticht mir ins Auge. Seit Monaten kritzelt jemand Graffitis an die Wände von umliegenden Höfen. Dieses Mal ist es unsere Stallwand.
Siggie tritt aus dem Stall und versetzt mich in Panik. Für einen Moment schließe ich die Augen. Kein Grund, unruhig zu sein. Er ist nicht mein Alter. Trotzdem finden meine Finger den Weg zueinander und krampfen ineinander.
»Schlumpf.«
Der harsche Ton stoppt mich. Gleichzeitig bringt der Spitzname mein Herz zum Rasen. Gänsehaut überkommt mich.
»Hast du irgendetwas ausgeplaudert?«
Verwirrt schüttele ich den Kopf. Vanti lässt den Ball vor mir fallen. Ich hebe ihn auf und werfe ihn gegen die Stallmauer. Der Ball prallt ab, Vanti fängt ihn aus der Luft und bringt ihn zurück. Ich ignoriere ihn und starre Siggie an, ohne in seine Augen zu sehen. Mit jedem Schritt, den er nähertritt, fließt mehr Hitze durch mein System. Verbrenne ich?
»Was ist das dann?« Mit Wucht drückt er einen Brief gegen meine Brust. »Kontrolle wegen Verdacht auf Verstoß gegen das Tierschutzgesetz.«
Schnaubend dreht er ab. Ich presse das Papier an mich. Mit scharfem Blick macht er kehrt und starrt in meine Seele, als könne er die Wahrheit darin finden.
Ja, ich habe schon oft darüber nachgedacht, ihn zu verpetzen. Überall liegt Schrott und Müll, Zäune sind schief, im Stall stehen spitze Schrauben aus den Wänden. Tiere verletzen sich oder werden krank. Er tut nichts dagegen. Eher verschlimmert er die Lage noch, indem er …
»Heißt: Irgendjemand hat uns verpfiffen. Bis morgen muss der ganze Müll hier weg und der Stall gesäubert sein. Der Prüfer vom Veterinäramt könnte jederzeit auftauchen.« Siggie tritt näher und ich weiche zurück. Seine Falten verschwinden, als die Anspannung in seinem Gesicht nachlässt. Sein Blick wird weich. Vorsichtig greift er nach dem Brief.
»Bitte. Schaffst du das?«, fragt er kaum hörbar. Ich nicke überschwänglich, hebe den Ball auf und mache mich gemeinsam mit Vanti auf den Weg zum Haus.
Ich habe ihn nicht verpetzt. Ich wollte, aber ich habe es nicht getan. Das könnte ich ihm niemals antun.
»Ach ja …«, schreit er mir plötzlich hinterher. Ich stoppe abrupt.
Ein weiterer Wutausbruch?
»Im Stall stehen ein paar Schrauben raus. Mach etwas drüber, damit man sie nicht sieht.«
Stumm nicke ich, verdrehe die Augen und setze meinen Weg fort.
Warum das Problem verstecken, statt es zu beheben? Diese Frage sendet Bilder von Linus durch meinen Kopf. Sofort verspüre ich den Drang, seine alten Sprachnachrichten zu hören – jedoch habe ich Linus’ Nummer während einer meiner Ich-muss-ihn-vergessen-Momente blockiert. Okay, die Chats sind trotzdem noch abrufbar und nur einen Klick weit entfernt, aber … trotzdem. Sowieso, wir werden uns nicht wiedersehen, erst recht nicht miteinander sprechen oder uns küssen.
Hat er sein Problem gelöst? Oder tut er wieder so, als wäre er hetero? Bei dem Gedanken, dass Linus mit einer Frau schläft, die er nicht liebt – nicht lieben kann –, dreht sich mein Magen.
Als ich spätabends nach Hause fahre, begrüßt mich die Dunkelheit. Meine Gedanken schweifen zu Jan. Hätte er mir Ratschläge zur Führerscheinprüfung gegeben?
Meinen Führerschein habe ich erst vor Kurzem bekommen. Timo hat mir wenig hilfreiche Tipps gegeben. »Wenn du nicht weißt, wie schnell du fahren darfst, fahr einfach dreißig«, hat er zum Beispiel gemeint.
Fakt ist, ich darf Auto fahren. Ich bin erwachsen. Die Tatsache bringt mein Herz zum Rasen, als müsse ich mich von nun an beeilen, meine Träume zu verwirklichen und alles hinzubiegen. Als wäre meine gesamte Jugend vorbei. Zwanzig Jahre alt werde ich dieses Jahr. Es fühlt sich an, als wäre mein Leben vorbei. Als dürfte ich nie mehr auf einer Schaukel schwingen, einen Kinderfilm anschauen oder über das Wort »Penis«lachen. Ich bin erwachsen.
Ich rausche an kahlen Bäumen vorbei, Vanti schläft auf dem Rücksitz. Timo hat mir Geld zugesteckt, damit ich mir ein Auto leisten kann. Seine Eltern wissen davon nichts, denn das Geld war ursprünglich für ihn. Monatelang wollte er mich überreden, es anzunehmen. Letzten Endes habe ich ihm geholfen, sein Zimmer aufzuräumen, sein Auto zu waschen und die Garage auszuräumen. Dafür hat er mich sehr großzügig bezahlt. Ich habe das Geld immer wieder in seinem Zimmer versteckt, aber er hat es stets gefunden und mir wieder aufgezwungen. Irgendwann habe ich es behalten und er hat – entgegen meiner Vermutung – kein Wort darüber verloren. Das ist eines der wenigen Dinge, über die Timo keine Scherze macht oder allgemein gern redet: Geld.
Mit jeder Minute prasseln größere Regentropfen auf die Windschutzscheibe. Die Scheibenwischer verschmieren den Dreck über das Glas. Während meiner Aufräumarbeiten auf dem Hof hat es begonnen, auf mich niederzuregnen. Durchfroren und nass sitze ich also auf dem Fahrersitz. Meinen gelben Regenmantel habe ich ausgezogen.
Ist es schon nach Mitternacht?
00:24 Uhr am 06. Januar, verrät mein Handy. Meine Organe rutschen nach unten, die Glieder scheinen schwer. Atmen ist fast unmöglich mit einer zugeschnürten Kehle.
Es ist so weit. Linus’ Geburtstag. Er ist jetzt zwanzig Jahre alt. Erwachsen. Wir sind keine Kinder mehr. Unsere Jugendliebe ist ein für alle Mal Geschichte.
Mein Mundwinkel zuckt. Die bunt verpackte Kiste in der Mittelkonsole wollte ich Timo geben, damit er sie als sein Geschenk ausgibt und Linus überreicht. Es ist eine Kleinigkeit, nichts Besonderes. Es ist nicht meine Aufgabe, meinem Ex-Freund ein Geburtstagsgeschenk zu geben. Trotzdem mache ich es. Es bringt mir ein bisschen Frieden. Letztes Jahr habe ich damit begonnen und ich bin mir nicht sicher, wie lange ich es noch tun werde.
Glücklicherweise hat Timo seinen Mund gehalten, das Geschenk tatsächlich als seines verkauft, ohne das Geheimnis auszuplaudern.
Fast hätte Linus seinen Geburtstag nicht erlebt. Es ist bereits der Zweite, den er ohne meine Rettung nicht gefeiert hätte.
Ist er immer noch in Therapie?
Timo redet nicht mehr über ihn und zu Leo habe ich keinen Kontakt. Seufzend wische ich mir übers Gesicht, verschmiere dabei Matsch über die Wange und setze den Blinker.
Ich wollte über ihn hinwegkommen. Es ist jetzt über ein Jahr her. Das ist doch nicht normal. Warum denke ich noch an ihn? Denkt er manchmal an mich?
Ein verbittertes Lachen entkommt meiner Kehle.
Ich war für ihn nur ein Test. Kopfschüttelnd lenke ich in die Straße zu meiner Rechten. Mittel zum Zweck. Was wollte er damit erreichen?
Die Fragen rotieren in meinem Kopf.
Jeden Tag aufs Neue stelle ich sie mir, doch die Antwort bleibt abermals aus.
Mein Blick gleitet gen Himmel, Jan scheint im Bild des Monds auf mich herab und bringt leuchtende Sterne mit sich. Gelbes Licht von Straßenlaternen lenkt meine Aufmerksamkeit zurück auf die Straße. Hastig bremse ich. Vanti rutscht lautstark nach vorne, doch der Anschnallgurt hält ihn. Der Ruck drückt meinen Körper in den Gurt. Ich habe das Ortsschild übersehen. Für eine Sekunde presse ich die Lider aufeinander.
Konzentrier dich, befehle ich mir selbst.
Die Häuser von Waldenstädten wirken trostlos. Nur in wenigen brennt noch Licht. Die Bar am Stadtrand leuchtet in verschiedenen Farben. Durch die Tür drängen sich Menschen hinein und heraus. Ob Linus …
»Konzentrier dich auf die Straße.« Jan lächelt auf mich hinab, in meiner Vorstellung zumindest.
»Sorry.« Mit den Augen auf die Straße gerichtet, bemerke ich lediglich Fußgänger und Fahrradfahrer sowie die leeren Bänke am Rand des Parks. Ein Blitz zuckt über den Himmel. Neben der Panik, die in mir aufkommt, verspüre ich Mitleid mit denjenigen, die dem Gewitter schutzlos ausgeliefert sind. Am liebsten würde ich sie alle mitnehmen und nach Hause bringen. Jan hätte es getan.
Trotzdem fahre ich an ihnen vorbei. Bis eine vertraute Figur in meinem Sichtfeld auftaucht. Sie starrt mich an, folgt der Bewegung meines Autos mit den Augen. Blonde Strähnen lugen unter der Kapuze hervor und kleben an der Stirn.
Das Geburtstagskind.
Nein.
Es kann nicht…
Oder… Sicher hat er mein Auto irgendwo geparkt sehen. Hat sich das Nummernschild gemerkt. Er weiß, dass ich es bin. Hat vielleicht jedes vorbeifahrende Auto begutachtet, in der Hoffnung, mich zu finden.
Nein. Nein. Nein. Nein.
Das ist lächerlich. Hör auf damit.
»Konzentrier dich auf die Straße, Kleiner«, erinnert mich Jan lächelnd.
Linus denkt nicht mehr an mich.
Linus hält nicht Ausschau nach mir.
Linus wird nie wieder Teil meines Lebens sein.
Trotzdem wandert mein Fuß zum Bremspedal. Ich bin zu weit weg, um Linus’ Blick zu erkennen. Wahrscheinlich hat er mich nicht einmal bemerkt, oder bei der Person handelt es sich um einen Fremden. Ich bilde mir das alles nur ein.
Trotzdem schaue ich in den Seitenspiegel und sehe, wie die Person stehen bleibt. Dann ist es zu spät. Selbst im Rückspiegel schrumpft die Person rasch und ist kurz darauf außer Sichtweite.
Der Donner erschüttert mein Inneres. Hinter mir fährt niemand, keiner kommt mir entgegen. Ein Kampf mit mir selbst beginnt, den ich nicht gewinnen kann.
Es ist gefährlich, bei Gewitter herumzulaufen, ist das finale Argument, das mich zum Stehenbleiben bringt.
Trotz des Unbehagens und meinem rasenden Herzen wende ich. Zu meinem Glück läuft Linus noch immer auf derselben Straße. Auf seiner Höhe stoppe ich das Auto abrupt.
Er ist es. Wasser tropft von seinen Strähnen auf seine Nase. Die Hände hat er in den Hosentaschen vergraben. Er hat sich kaum verändert, ist immer noch so wunderschön wie damals. Plötzlich wird mir heiß und am liebsten würde ich ihn in meine Arme schließen, gleichzeitig will ich das Gaspedal durchtreten und davonrasen.
Aber ich bleibe.
Ein Blick genügt, um Linus zum Einsteigen zu bringen. Hastig schalte ich das Radio an, um seltsame Stille zu vermeiden. Vanti hopst quietschend und schwanzwedelnd auf dem Rücksitz herum und bettelt um Aufmerksamkeit. Linus verwehrt sie ihm.
»Hi«, flüstert er. Ein Schwall Erinnerungen schlägt mir ins Gesicht. Linus’ Eigengeruch, vermischt mit Schweiß und der Note seines Parfüms, das er noch immer benutzt, und einem modrigen Aroma, der dem eines nassen Hundes gleicht. Sorry, Vanti.
Ich lege den ersten Gang ein. Linus schnallt sich an. Erst dann fahre ich los.
»Wie geht’s dir?«, stammelt er.
»Wie geht es dir?« Aus dem Augenwinkel beobachte ich ihn. Er beäugt mich mit müden Augen, aber er lächelt. »Ich hab zuerst gefragt.«
Mein Kiefer verspannt sich. Ich drücke fester auf das Gaspedal. Wir nehmen Geschwindigkeit auf. Ich beiße mir auf die Unterlippe. In derselben Tonlage wiederhole ich meine Frage.
»Viel besser als damals. Dir?«, gibt Linus sich geschlagen. Er schaut sich um, als habe er den Wagen noch nie von innen gesehen – hat er ja auch nicht.
Ich unterdrücke ein Lächeln, beim Zucken meines Mundwinkels gelingt mir das jedoch nicht. Erleichterung bringt mich fast zum Lachen. Er ist am Leben. Ich wusste es, aber … jetzt sehe ich es. Ich rieche es. Ich fühle es.
Und ich bin der Grund, warum er sein Leben beenden wollte.
»Und wie geht es dir?«, fragt Linus erneut.
»Beschissen.«
Das Lächeln weicht aus seinem Gesicht. Die Stirn legt er in Falten, die Augenbrauen zieht er zusammen. Er rutscht auf dem Sitz hin und her und dreht sich zu mir. Seine Hand landet auf der Rücklehne des Fahrersitzes.
»Was ist los?«
Ich verdrehe die Augen und stelle das Radio lauter. Jetzt interessiert es ihn, wie es mir geht?
Eine Minute verharrt er, bevor er sich abwendet und aus dem Fenster schaut. Er sieht zu, wie unsere Zeit verstreicht, wie die Häuser vorbeiziehen, wie ein Blitz über den Nachthimmel zuckt. Noch einmal rechts abbiegen, dann links und schon ist unsere erste und letzte gemeinsame Fahrt beendet.
Je näher wir Linus’ Haus kommen, desto langsamer rollt das Auto über den Asphalt. Als hätte mein Fuß plötzlich jegliche Kraft verloren.
»Ich verstehe, dass du mich hasst und ich nehms dir nicht übel«, wispert er, ohne mich anzusehen.
Fick dich. Mein Herz hämmert gegen meine Brust und bereitet mir Schmerzen. Da ist er wieder – dieser plötzliche Wutausbruch, den ich nicht verhindern kann.
Linus legt die Hand an den Türgriff, noch bevor wir anhalten. Das wars. Wir sind da. Ich will, dass er geht. Gleichzeitig nicht.
»Ich hasse dich nicht.« Meine Stimme gleicht einem Windhauch. Verbittert lache ich. »Glaub mir, ich habs versucht.«
Linus nickt. Seine Hand wandert zum Rücksitz, sein Oberkörper folgt. Er ist mir so nah. Sein Geruch steigt mir in die Nase. Ich beobachte, wie er Vanti vorsichtig über den Kopf streicht und den Abschied mit einem Kuss auf seine Stirn beendet.
Mit hängendem Kopf steigt er aus. Er lehnt sich nach unten, um mich anzusehen. Ich erwidere den Blick, ohne ihm in die Augen zu sehen.
»Wenn du was brauchst, lass es mich wissen. Wenn du Fragen hast, werde ich sie dir beantworten. Egal, worum es geht. Ach ja, und … danke fürs Heimfahren.«
Mit diesen Worten wirft er die Tür zu und schlüpft durch das Gartentor vor seinem Haus.
Und schon ist unsere Lebensparallele wieder vorbei. Unsere Zeitstrahle trennen sich nun wieder, werden sich nie wieder kreuzen und immer weiter voneinander entfernen.
Bis wir die Stimme des jeweils anderen vergessen.
Bis wir uns in neue Menschen verlieben und die Zukunft, die wir uns gemeinsam aufbauen wollten, als kindischen Traum abstempeln.
Bis sich nur noch ein bitterer Geschmack auf unsere Zungen legt, wenn wir an unsere Jugend zurückdenken.
An den dummen jugendlichen Leichtsinn.
Dumme jugendliche Fehler.
Dumme Jugend.
Ich bin erwachsen.
Linus ist erwachsen.
Um ein Haar wäre er für immer achtzehn geblieben.
Und ich glaube, ein Teil von mir wird immer achtzehn bleiben – wie in einer Zeitschleife stecken geblieben – und diese eine Nacht auf ewig erleben. Dieser Teil von mir wird Linus immer hinterherrennen und ich darf ihn nicht gewinnen lassen.
Schließlich bin ich kein dummer Jugendlicher mehr, der an die wahre Liebe und Seelenverwandtschaft glaubt. Früher war ich es. Gott, die Zeit nach seinem Suizidversuch war so ein Chaos.
Ich muss immerzu an die Vergangenheit denken. Noch immer stecke ich in der Zeitschleife fest. Aber ich glaube, es ist gut so. So gewinnt nicht wieder dieser jugendliche Teil in mir, der Linus hinterherrennt, nur, weil er mich heute so angesehen hat. Vielleicht kann ich über all das hinwegkommen, wenn ich es in meinem Kopf noch mal abspielen lasse …
Damals
Angst ist, wie wenn ich rund um die Uhr Glas halte. Aber sobald ich aufhöre, mir bewusst zu sagen, dass ich es nicht fallen lassen darf, wird es durch meine Finger gleiten und in eine Millionen Stücke zerspringen.
Natürlich fange ich an, mir über all die Dinge Gedanken zu machen, die mich dazu bringen könnten, es fallen zu lassen. Was, wenn ich ausrutsche? Was, wenn mich jemand anrempelt? Was, wenn. Was, wenn. Was, wenn ...?
»Positiv bleiben« ist keine Option. Sobald ich aufhöre, mir bewusst zu sein, dass ich mir keine Sorgen machen muss, kehrt die Angst zurück und sorgt dafür, dass sich mir der Magen umdreht. Mich ständig zu zwingen, mir keine Sorgen zu machen, ist anstrengend.
Und deshalb kreist derselbe Gedanke jeden Tag in meinem Kopf: Du bist tot.
Ich schniefe. Zumindest fühlt es sich so an, als wärst du es. Und es ist meine Schuld. Wäre es anders gelaufen, wenn wir uns nie kennengelernt hätten?
Der Geruch von Maissilage brennt in meiner Nase. Unter mir pikst das Heu in meine Haut, im Gegensatz dazu ist Vantis Fell seidenweich. Wir liegen im Stall auf einem Heuballen und schauen einer Spinne dabei zu, wie sie eine Fliege verspeist. Etwas drückt sich in meinen Rücken und ich taste danach. Ein getrockneter Matschklumpen.
Die Fingernägel kralle ich in meine Haut und ziehe sie über meinen Arm. Tiefe Furchen bleiben zurück. Linus’ Worte hallen in meinem Kopf wider, das Knacken seiner Rippen ebenso.
Siggie taucht in meinem Blickfeld auf. Ich tue so, als bemerke ich ihn nicht. Er räuspert sich und meine Ausrede zerbröselt wie der Matschklumpen in meiner Hand. Ich sehe ihn an und atme tief durch, bevor ich ihm in den benachbarten Stall folge.
Sanft legt er mir die Hand an den Rücken und schenkt mir ein Lächeln.
»Das schaffst du schon, Schlumpf«, murmelt er und klopft mir auf die Schulter. So nennt er mich schon, seit ich klein bin, aber ich habe diesen Kosenamen eine Weile nicht mehr gehört. Vielleicht, weil Linus so oft mit auf dem Hof war.
Wir betreten den Stall und meine Brust zieht sich zusammen.
Almana liegt flach im Stroh und atmet schwer. Ihre Augen sind eingefallen, das Fell stumpf und dreckig. Als sie geboren wurde, war ich der Erste, den sie gesehen hat. Nun soll ich der Letzte sein.
Siggie drängt mir das Bolzenschussgerät auf und stößt mich nach vorn. Ich klettere über das Gatter – so langsam ich kann. Ich könnte es aufmachen und durchschlüpfen, aber es ist verrostet und kaputt, weshalb es sich nicht richtig öffnen lässt.
Tränen brennen in meinen Augen, das Atmen fällt mir schwer. Ich knie mich neben Almana und setze den Apparat an ihrer Stirn an. Meine Finger zittern. Eine Träne kullert über meine Wange und tropft an meinem Kinn hinunter auf Almana.
»Komm schon, Schlumpf. So schwer ist das doch nicht.« Siggie versucht, geduldig zu klingen und mich nicht zu drängen, aber mit jedem Tier, das ich töten soll, verliert er die Geduld und den sanften Ton ein kleines bisschen mehr. Seit Monaten will er, dass ich hier mehr Verantwortung, mehr die Führung, mehr schwierige Aufgaben übernehme. Aber ich schaffe es nicht, ein Tier zu töten. Verdammt, seit ich das erste Mal zusehen musste und er mich gezwungen hat, das Fleisch zu zerschneiden, bin ich nicht einmal mehr in der Lage, Fleisch zu essen.
»Ich kann das nicht.« Den Kopf schüttele ich vehement, Tränen laufen links und rechts über meine Wangen.
Siggie seufzt langgezogen und tritt gegen das Tor, bevor er sich abwendet.
»Ich ... es tut mir leid.« Meine Finger finden Almanas Fell. Sie reagiert nicht. »Ich ...« Keine Ahnung, was ich überhaupt sagen will. Es spielt keine Rolle. Meine Kehle ist so eng, dass ich kaum Luft bekomme. Kein weiteres Wort bringe ich heraus.
Hastig klettere ich über das Gatter und halte Siggie das Bolzenschussgerät hin. Er nimmt es nicht an, macht lediglich eine wegwischende Handbewegung.Er will sie so liegen lassen? Wie lange noch?
Sie liegt schon seit drei Tagen, weil sie sich verletzt hat und nicht aufstehen kann. Am liebsten würde ich ihm das Teil entgegenschleudern. Vorsichtig lege ich es zu Boden und starre darauf. Grummelnd hebt er es auf, öffnet das Gatter mit einem starken Ruck und schlüpft in die Box. Reglos bleibe ich stehen, mein Blick klebt an der nun leeren Stelle. Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie er den Apparat ansetzt.
»Wieder ein paar Tausend Euro in den Sand gesetzt«, brummt er. Es ist nicht meine Schuld, dass ihr Bein verletzt ist. Warum lässt er es so klingen, als sei ihr Schicksal meine Schuld?
Meine Hand ballt sich automatisch zur Faust. Nichts kann ich dagegen tun, dass die Wut mich einnimmt, während ich kein Wort herausbekomme, obwohl ich schreien will. Als er Almana eine Kugel ins Gehirn jagt und ihr zum Abschluss einen Tritt gibt.
»Das ist kein Produkt, sondern ein Lebewesen. Eins, das Gefühle hat, so wie du und ich«, will ich ihm entgegenschleudern, doch der Kloß in meinem Hals blockiert jeglichen Ton.
Almana muss es nicht ertragen – nicht mehr –, aber ich schon. Es fühlt sich an, als hätte er mir dasselbe angetan.
»Es tut mir leid«, bringe ich hervor, als Siggie mir das Bolzenschussgerät gegen die Brust drückt.
»Irgendwann musst du es tun. Wenn du den Hof übernimmst, musst du den ganzen Scheiß selbst übernehmen – nicht nur das Kuscheln.«
Wenn. Warum erwartet jeder, dass ich dieses Drecksloch will? Niemand hat mich je gefragt.
Sein Blick wird weich. »Ich weiß, dass das eine große Verantwortung ist und dass du ein Angsthase bist. Aber genauso gut weiß ich, dass du das hinbekommst.«
Ich husche zurück in den Stall und schlängele mich durch einen Parcours aus Brettern mit Nägeln, Metallschrott und Brennnesseln sowie Disteln, die zwischen Pflastersteinen emporragen.
Ein bisschen Sicherheit finde ich im Heubodenversteck. Mein Gehirn kramt eine Erinnerung an Linus hervor und zeigt sie mir, als wolle es sagen »Schau mal, willst du noch trauriger sein?«
Ich streiche über die Mulde neben mir – diesen Platz hat Linus damals als seinen auserkoren. Hier haben wir uns Geheimnisse erzählt, haben uns geküsst, haben uns gehalten.
Wie es ihm wohl geht? Den Drang, ihn zu kontaktieren, unterdrücke ich. Seinen Instagram-Account zu suchen ist sinnlos – schon vor einigen Wochen hat er mich blockiert und auf anderen Plattformen finde ich ihn nicht mehr.
Trotzdem gebe ich seinen Account-Namen in der Suchleiste ein und die Enttäuschung packt mich, als keine Ergebnisse angezeigt werden.
Gedämpftes Murmeln lenkt die Aufmerksamkeit zurück in die Wirklichkeit. Leises Fluchen dringt näher. Ein Klopfen. Licht fällt in den winzigen Raum und macht die Staubteilchen sichtbar, welche durch die Luft tanzen.
Siggie klettert durch die Luke und lässt sie krachend zufallen. Er plumpst in die Mulde neben mir – Linus’ Mulde. Mein Kiefer verspannt sich. Jede seiner Bewegungen beobachte ich genauestens.
»Schlumpf. Du schaffst das schon irgendwann. Kommst sowieso nicht drum herum.« Er schaut sich um – er war noch nie hier oben – und kratzt sich am Kinn. »Hab deinen Freund schon lange nicht mehr gesehen.« Er sagt es in diesem Ton, der mich wissen lässt, dass er es weiß – dass Linus nicht nur ein Freund war.
Ich habe es Siggie nie erzählt. Auch nicht, dass Linus und ich uns getrennt haben. Ich ringe mich zu einem Lächeln durch.
»Ihm geht’s gut.« ... hoffe ich.
Siggie erhebt sich ächzend und deutet mir, ihm zu folgen. Vor der Scheune bleibt er stehen und sagt: »Er, – Linus heißt er, oder? – ist ein netter Bursche. Könnte dir auf dem Hof sicherlich besser helfen als ein Weib. Schade, dass er nicht mehr kommt. Aber so langsam solltest du jemanden finden. Ich bin kein junger Hüpfer mehr. Dann musst du das alles machen. Bis dahin solltest du jemanden haben, der dich hier unterstützt.« Er tritt gegen einen Reifen, der seit Monaten hier herumliegt.
»Aber bei dem Saustall ist es wahrscheinlich besser, wenn niemand vorbeikommt. Du musst dich besser um den Hof kümmern, wenn es deiner werden soll.«
Dem Drang, die Augen zu verdrehen, widerstehe ich.
Erst als ich Stunden später zu Hause ankomme und ungesehen in mein Zimmer verschwinde, werfe ich wieder einen Blick auf mein Handy. Warum weiß ich nicht, schließlich habe ich niemanden mehr, der mir Nachrichten schreibt. Timo und Leo haben sich seit Linus’ Versuch nicht bei mir gemeldet – und ich mich nicht bei ihnen.
Ich will wieder Linus’ alte Sprachnachrichten anhören, um in Trauer zu versinken. Doch noch bevor ich auf seinen Chat tippen kann, ploppt eine Nachricht auf.
Joelx69x folgt dir jetzt, lese ich und klicke auf das Instagram-Profil. Joelx69x hat weder Abonnenten noch folgt er jemandem. Ich schicke eine Abo-Anfrage. Einen einzigen Beitrag hat Joel gepostet.
Ein Klopfen an der Tür verleitet mich, das Telefon wegzulegen. Ein angewidertes Schnauben verlässt Moms Kehle. Die matschigen Pfotenabdrücke auf dem Boden umgeht sie.
»Du musst wischen.« Als sie das Bett begutachtet, runzelt sie die Stirn und schüttelt den Kopf. Unter Vanti, der am Fuße des Bettes schlummert, klebt eine Mischung aus Matsch und Blättern im Bettlaken.
Mom öffnet den Mund und atmet hörbar ein. Sie zählt bis zehn. Aus ihrem Mund kommen lediglich kaum hörbare Worte, die man mit lautem Atmen verwechseln könnte. Aber sie hat mir schon oft empfohlen, zu zählen, weil es helfen soll, sich zu beruhigen, deshalb bin ich mir ziemlich sicher, dass sie zählt. Beim Bett angekommen setzt sie ein Lächeln auf, das nicht unechter sein könnte. Ihr Hintern landet auf einer sauberen Ecke des Betts direkt neben mir.
»Du solltest wieder zur Therapie.«
Blitzartig schießt mein Puls in die Höhe. Noch bevor ich protestieren kann, ergreift sie das Wort.
»Es ist jetzt sechs Wochen her, dass …« Sie legt die Hand an meinen Rücken. »Vielleicht solltest du es mit Frauen versuchen, wenn du mit Männern kein Glück hast, was?«
Ich bemühe mich, zu lachen.
Aus Mitleid.
Um Stress zu entgehen.
Um okay zu wirken.
Damit ich nicht zu dieser scheiß Therapie muss. Aber ich bringe lediglich ein erheitertes Schnauben heraus. Und gebe auf. Sie ist fake. Ich aber nicht. Will ich nicht. Ich schüttele den Kopf.
»Ich brauche keine Therapie.« Ohne sie anzusehen, falle ich auf die Seite und klammere mich an Vanti. »Er ist meine Therapie.«
»Rubär, ich kenne dich.«
Ich will kotzen. Rubär. In meinem Kopf mache ich Würgegeräusche. Täte ich das laut, würde sie anfangen zu heulen.
Mom erhebt sich und entwirrt die Leinen auf dem Haufen in der Ecke. »Du bist völlig neben der Spur, seit … Du redest kaum noch. Genauso warst du damals, als Jan gestorben ist.«
Ich weiß nicht, was ich sagen will, soll, muss.
»Vielleicht brauchst du noch einen Hund.« Mom lacht, doch es klingt verbittert. Nach Janniks Tod hat sie mich zum Schulpsychologen geschickt und mir Vanti zur seelischen Unterstützung geschenkt. Als ersetze das meinen großen Bruder.
»Ihr könntet einfach aufhören, so beschissene Eltern zu sein. Vielleicht bräuchte ich dann keinen Hund oder Therapie, um zu funktionieren.« Ich bin drauf und dran, aus dem Fenster zu klettern, denn Mom wird mir sicher den Weg durch die Tür versperren. In mir brodelt so viel Wut, dass ich nicht weiß, wohin damit. Ich weiß nicht, wann sie aus mir herausbricht, und ich habe keine Ahnung, wie ich mit ihr umgehen soll. Sie zu unterdrücken funktioniert nicht mehr. Wenn ich eins von Linus gelernt habe, dann, dass Emotionen ein Segen sind.
Nichts zu fühlen muss beschissen sein. Manchmal, wenn es ihm richtig schlecht ging, hat er einfach ins Leere gestarrt und war eine Hülle seiner selbst. Allein der Gedanke an diesen Linus lässt mich erschaudern.
Ab und zu konnte ich eine andere Seite von ihm herauskitzeln. Eine lustige, die einen alten Mann gespielt hat, der seinen Gehstock verloren hat. Ich wünschte, es wäre mir häufiger gelungen. Ich hoffe, Linus findet zu dieser Version seiner selbst zurück. Auch wenn ich es niemals miterleben werde.
Mom lässt die mit Matsch panierten Leinen fallen und verlässt wortlos den Raum. Das Schluchzen aus der Küche eine Minute später ist nicht zu überhören. Der Drang, auf meiner Gitarre zu zupfen, holt mich ein. Hauptsache, ich muss sie nicht mehr ertragen. Das schlechte Gewissen bringt mich dazu, stumm sitzen zu bleiben und zu lauschen.
Mom erklärt meinem Alten, was geschehen ist.
Schritte donnern durch den Flur und ich bleibe wehrlos sitzen.
Als der Alte ins Zimmer stürmt, als interessiere ihn Moms Weinen tatsächlich, bleibe ich regungslos sitzen.
Und selbst als das Geschrei in meinen Ohren schmerzt und mein Alter meinen Arm packt und mich in die Küche zerrt, wehre ich mich nicht.
Da Vantis tiefer Schlaf mich davon abhält, ihn mir zu schnappen und in den Wald zu fliehen, rolle ich auf dem Weg zum Skatepark durch die Straßen.
Vorhin hat mein Alter herumgebrüllt, wie immer. Hat ein Glas zerdeppert und es mich aufräumen lassen, wie immer. Wurde still und wandte sich seiner Zeitung zu, als Mom sich beruhigte, wie ... wie immer?
Es war wie eine Show, realisiere ich. Warum habe ich das nie gemerkt? Selbst Jan hat Standpauken immer mit einem breiten Grinsen und »Showtime« vorhergesagt.
Mit dem Blick auf den Boden gerichtet ziehe ich im Skatepark meine Runden. Bekannte Stimmen dringen in meine Ohren und leiten mich zu ihnen. Leo sitzt oben auf der riesigen Rampe. Timo lungert unten, schiebt das Skateboard die Rampe hoch und schnappt es wieder, als die Schwerkraft es zu ihm zurückbringt. Leo schaut mich an und blickt sofort weg.
Eine Schockwelle setzt meine Ängste frei. Dreh um, dami… Scheiße, Timo hat dich gesehen. Meine Hand fliegt in die Höhe und ich winke übertrieben. Hitze schießt in meine Wangen. Meine Beine tragen mich zu ihnen.
Sie haben keinen Bock auf dich, sage ich mir selbst. Hassen sie mich, weil ich für Linus’ Suizidversuch verantwortlich bin?
Leos kaltem Ausdruck und dem fehlenden Blickkontakt nach zu urteilen, sind sie sich dessen bewusst. Nicht einmal, als er die Hand hebt, um mich zu grüßen, sieht er mich an.
Ich drehe ab. Mir fällt keine Ausrede ein, also gehe ich wortlos. Timo jedoch ruft mir nach und ich mache kehrt.
Er kommt mir entgegen und zieht mich in eine feste Umarmung. Leo rutscht die Rampe hinab. Er hält mir die Faust hin, als Timo und ich uns lösen. Und dann starren wir uns an. Keiner sagt etwas. Nicht einmal die Vögel singen ein Lied. Kein einziges Auto rauscht über die Straße. Nicht einmal der Wind bringt die Äste zum Rascheln.
Bin ich plötzlich taub geworden? Ich begutachte ihre Lippen, doch nichts bewegt sich. Und ich fühle mich wie damals, als ich noch ein Kind war. Früher, als ich Linus gerade erst kennengelernt habe. Als ich Timo und Leo im Schulklo begegnet bin. Keine Ahnung, was ich sagen soll. Die Hilflosigkeit überrumpelt mich. Mein Fluchtinstinkt pflanzt mir endlos viele, aber lediglich schlechte Ausreden in den Kopf. Als hätte das Selbstbewusstsein, das ich durch Linus’ Hilfe erlangt habe, mich verlassen. Als hätte es Linus nie gegeben.
Vielleicht bin ich schon vor langer Zeit verrückt geworden und Linus hat nie existiert?
»Wir müssen reden.« Leos Schultern hängen, gleichzeitig wirkt er angespannt. Mit den Fingern tippt er nacheinander auf jedes einzelne Glied seiner Silberkette. Das Skateboard rollt er unter seinem Fuß hin und her.
Es ist schon kalt draußen und die Bäume haben ihre Blätter verloren. Trotzdem wird mir heiß, weil diese Situation so unangenehm ist. Kurzerhand schlüpfe ich aus meiner Jacke und dem Pullover, um irgendwas anderes zu tun, als dumm herumzustehen.
Es sind Timos weit aufgerissenen Augen und sein entsetzter Laut, die die vergangenen Stunden zurück in mein Gedächtnis bringen. Nach der Standpauke meines Alten bin ich ins Badezimmer, habe eine Rasierklinge genommen und …
Es ist zu spät, um es zu verstecken, eine Ausrede zu erfinden oder zu flüchten. Er zerrt meinen Arm zu sich und inspiziert ihn.
Leo schaut auf und starrt den blauen Fleck an meinem Oberarm an.
»Das ist doch eklig«, sagt Timo in traurigem Ton, »hör auf, das zu machen. Sonst musst du zu Linus in die Klapse.« Er gluckst und es ist mir peinlich, dass er das tatsächlich ausgesprochen hat.
Leo legt den Kopf in den Nacken. Die Hände reibt er aneinander, steckt sie in die Jackentaschen und seufzt langgezogen.
»Tut mir leid.« Timo wirft mir einen mitleidigen Blick zu. Ich winke ab, entziehe mich seinem Griff und werfe mir Pullover und Jacke über den Arm. Abermals zieht Timo mich in seine Arme. »Danke, dass du ihn gerettet hast«, flüstert er und legt sein Kinn auf meiner Schulter ab, wofür er sich herunterbeugen muss.
Ob sie sich die Schuld daran geben? Ich wage es nicht, die Frage auszusprechen. Und obwohl es sich seltsam anfühlt – fast schon, als würde ich Linus betrügen –, drücke ich mich an Timo, als er loslassen will. Denn seit sechs Wochen habe ich niemanden umarmt – außer Vanti und den Teddybären, den Linus mir hinterlassen hat. Der Druck von Timos Körper an meinem gibt mir den Mut, meine Gedanken auszusprechen.
»Wir müssen mal wieder etwas unternehmen.« Nervosität bringt mich zum Lachen. »Vanti vermisst euch.«
Timo stimmt übermäßig freundlich zu.
Leo schnappt sich sein Skateboard, entfernt sich einige Meter und dreht sich energisch zu mir. Die Augenbrauen zieht er zusammen und ich weiß nicht, ob er verwirrt oder wütend ist.
»Willst du jetzt Timo rumbekommen, wo Linus weg ist?« Er schielt zu Timo und an mir vorbei Richtung Straße. Murmelnd packt er Timo und zieht ihn mit sich.
»Linus kommt irgendwann wieder«, sagt der.
»Er tut Linus nicht gut. Wann kapierst du das endlich?«, wispert Leo.
Sollte ich das hören? Ist es ihm egal, dass es mir wehtut?
Ich schaue zu, wie sie verschwinden. Plötzlich trällern die Vögel wieder ihre Lieder, Autos dröhnen durch die Straßen und der Wind lässt die Äste zittern. Das Ziehen in meiner Brust vermittelt, dass ich abhauen sollte.
Und so ist mein letzter Zufluchtsort zunichtegemacht.
Kapitel 3: Linus – Lügen
Jetzt
Ich fühle gar nichts. Das Handyklingeln ignoriere ich. Fünf Mal kreischt das Telefon, bevor Ruhe einkehrt. Augenverdrehend ziehe ich es aus der Tasche und schreibe Mama, dass es mir gut geht. Sie macht sich Sorgen, wie immer. Aber es hat sich schon gebessert. Langsam vertraut sie mir wieder. Seit Hannah ausgezogen ist, ist es allerdings wieder etwas schlimmer geworden. Keine Ahnung warum.
Hannah ist mit ihrem Freund zusammengezogen, weil sie so näher an der Arbeit wohnt. Na ja, … und vermutlich, weil sie gern mit ihrem Freund leben möchte. Hah. Ich konnte ihn noch nie leiden. Er kam nur ein einziges Mal zu uns nach Hause, sonst war Hannah immer bei ihm. Erst dachte ich, sie schämt sich für uns, aber einmal habe ich gehört, wie sie sich darüber beschwert hat, dass er nie zu uns kommt. Er ist so wenig Teil meines Lebens wie Dad. So wenig, dass ich mir seinen Namen kaum merken kann. Nico? Nikolas? Nick … Niklas. So heißt er. Glaube ich. Wie auch immer. Ruben war nach einem Monat öfter bei mir als Niklas in all den Jahren mit Hannah.
Das Schlimmste ist, dass nicht nur Hannah weg ist, sondern auch Mama. Ich bin ständig allein zu Hause. Vielleicht hat sie keine Lust mehr, sich um mich zu kümmern und flüchtet sich in die Arbeit. Sie ist seltener daheim und hat sich einem Buchclub angeschlossen. Wobei ich nicht glaube, dass sie tatsächlich Teil einer Lesegruppe ist, weil sie kaum liest und nie ein Buch dabeihat.
Mit den Fingern greife ich an die Kette, die aus meiner Hosentasche hängt. Daran befestigt ist eine Uhr – mein Geburtstagsgeschenk. Golden schimmert sie im Licht der Straßenlaterne, unter der ich auf einer Bank sitze. Abgesehen von dem hell erleuchteten Schotterweg ist der Park düster. Im Nebel verschwinden die Bäume. Die, die ich ausmachen kann, wirken wie Monster – ich fürchte mich nicht. Schließlich sind sie in der Erde verwurzelt und somit unfähig, an mich heranzukommen.
Seit ich aus der Klinik zurückgekehrt bin, gehe ich hier in Waldenstädten weiterhin zur Therapie. Die Therapeutin, Susanne, habe ich auf der Liste gefunden, die Ruben mir damals gegeben hat. Nach meiner Sitzung gehe ich stets spazieren – Mama weiß das. Jedoch ist diese nun fünf Stunden her und ich bin noch immer nicht zurück. Aber sie ist sowieso nie zu Hause, also muss ich es auch nicht sein. Nur weil sie jetzt zufällig da ist, will sie wieder über mein Leben bestimmen? Plötzlich ist es ihr nicht mehr egal, wo ich mich herumtreibe? Sie erinnert mich nicht einmal mehr daran, meine Antidepressiva zu nehmen, verdammt. Dann wüsste sie, dass ich sie nicht mehr nehme.
Silhouetten von Menschen ziehen durch die Straßen, Scheinwerfer durchbrechen den Nebel und der Mond blitzt hin und wieder durch die Wolken.
Seit Wochen denke ich über die Begegnung mit Ruben nach. Im vergangenen Jahr haben wir uns ab und an gesehen, doch nie interagiert – nicht einmal in die Augen haben wir uns geschaut. Als seien wir Fremde.
In der Ferne schlendert ein Paar händchenhaltend über die Wiese. Jemand führt seinen Hund Gassi. Mit jedem Schritt dieser Person in meine Richtung schallt das Knirschen des Kieses lauter in meinen Ohren. Ich begutachte die Uhr und streiche darüber. Mein Finger stoppt bei der Gravur: J. K.
Ich schaue nicht auf, als der oder die Fremde an mir vorbeiläuft und den Hund davon abhält, mich zu begrüßen. Stattdessen starre ich auf den Sekundenzeiger und wünsche mir, weniger Zeit verschwendet zu haben.
Die Präsenz verschwindet nicht. Das Knirschen der Steinchen verstummt, ebenso das Klappern der Hundemarke. Lediglich das Wimmern des Hundes besteht.
Ich teile das Leid. Ich will dich genauso gerne begrüßen. Die Person setzt sich.
Die Verwirrung hält mich davon ab, mich zu rühren. Unzählige Bänke gibt es auf diesem Weg, warum also lässt sich jemand neben mir nieder? Ist es nun so weit?
Wird meine Vermutung wahr werden? Wird meine Sexualität – die Homophobie – nun doch zu meinem Tod führen?
Vorsichtig schiele ich nach rechts, ohne den Kopf zu drehen. Zwei Hände kämpfen im Schoß miteinander, die Füße schieben Kies hin und her. Und ein schwarz-weißer Engel lässt sich nach dem Blickkontakt nicht mehr davon abhalten, sich loszureißen und mich mit wackelndem Hintern anzuspringen – der Besitzer hält ihn nicht davon ab, sondern lässt die Leine achtlos fallen.
Sonnenschein.
Lachend gehe ich auf die Knie, die Kälte des Bodens durchströmt meinen Körper binnen weniger Sekunden. Avantis eisblaue Augen starren in meine. Das Gesicht vergrabe ich in dem weichen Fell. Es dauert einen Moment, bis wir uns beruhigen. Stille kehrt ein.
»Hi.« Rubens Stimme gleicht der eines Engels. Ein Wort – so leise, dass ich fürchte, es mir einzubilden. Ich schaue auf. In seinen Augen flackert ein Leuchten. Wirr lugen seine Haare unter der Kapuze hervor und verdecken seine Stirn.
Nicht eine Sekunde überlege ich, zu flüchten. Riot beobachtet mich stumm.
»Hi«, sage ich lächelnd.
Ruben erwidert den Blick für einen Moment, bevor wir beide wieder auf den Boden starren.
»Darf ich dich etwas fragen?«
Ohne zu zögern, nicke ich. Nervosität fließt durch meine Venen. Ich bereite mich darauf vor, zu weinen. Und auf das Hämmern in meiner Brust. Aber Rubens Frage bringt mich zum Lächeln und mein Herz zum Höherschlagen – ohne Schmerzen.
»Geht’s dir wirklich besser?« Er klingt besorgt, aber hoffnungsvoll.
»Ja«, antworte ich ehrlich.
»Bist du noch in Therapie?«
Auch diese Frage bejahe ich. Es folgen keine weiteren. Die Uhr umfasse ich fester, als Rubens Blick darauf gleitet.
»Danke für die Uhr. Du hättest mir nichts schenken müssen.«
Er bleibt stumm.
»Ich weiß, dass zumindest ein Teil in dir mich hasst, aber …«
Er unterbricht mich. »Ich …«
Auch ich falle ihm ins Wort. »Bitte lass mich ausreden. Ich würde dir gern zeigen, wer ich jetzt bin und dir geben, was du verdienst. Aber ich weiß, dass das nicht möglich ist, weil …« Die Luft verwandelt sich in Dampf, als ich zittrig ausatme. »Weil unsere Zeit vorbei ist.« Ein blasser Funke irrt durch mein System – die Hoffnung, dass wir doch noch Zeit haben, noch eine Chance, irgendetwas.
Ruben zuckt mit den Schultern und auf gewisse Weise macht es mich glücklich. Schulterzucken ist einfach … er.
»Alles hat irgendwann ein Ende, weißt du noch?« Er gluckst, doch es klingt merkwürdig, ist gar kein Ausdruck der Verzweiflung. Ein Schluchzen vielleicht.
»Die Uhr hat Jan mir hinterlassen, damit ich nie vergesse, dass alles endet. Daran hat er mich schon erinnert, bevor er gestorben ist, weil ich die Uhr so toll fand. Aber ich will, dass du sie hast.« Er kramt einen Zettel aus seiner Tasche, lässt ihn in meinen Schoß fallen und erhebt sich. Ohne zurückzublicken setzt er sich in Bewegung. Avanti folgt ihm zögerlich, aber schaut immer wieder zu mir zurück. Nach kurzer Zeit verschwinden die beiden im Nebel.
Mein Herz schmerzt. Ich wage es nicht, den Zettel aufzufalten. Vorsichtig streiche ich die Falten glatt, als sei das Papier ein Geheimnis, das ich hüten muss. Ist es vielleicht auch – niemandem kann ich davon erzählen, denn jeder sieht Ruben als eine Bedrohung. Als jemanden, der die Bombe zünden wird. Als Auslöser dafür, dass alles von vorn beginnen wird und als jemanden, der mich letztendlich doch das Leben kosten wird.
Mama und Hannah haben es nur subtil angesprochen. Timos Blick, wann immer Rubens Name fällt, sagt schon genug. Seine Glieder verspannen sich, wenn wir an Rubens Haus vorbeigehen, und er schielt zur Tür, um sicherzugehen, dass er nicht da ist. Er wird still oder quasselt ohne Punkt und Komma, bis wir am Haus vorbei sind. Vielleicht hat er Angst, dass Ruben heraus stürmt, ihm in die Arme fällt und ihn küsst. Keine Ahnung, was zwischen ihnen läuft. Ich weiß nur, dass sie noch Kontakt haben.