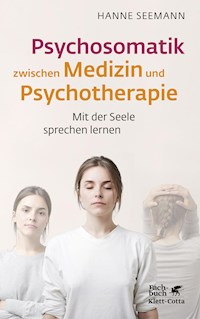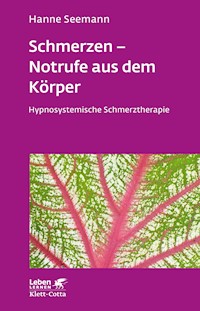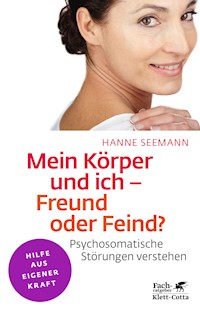17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Fachratgeber Klett-Cotta
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Migräne, Entspannungsmigräne, Spannungskopfschmerz - etwa 20% aller Schulkinder leiden darunter. Weil es sich um eine "funktionelle", also eine nicht-organische Erkrankung handelt, ist der Besuch bei Kinder- oder Facharzt meist vergeblich. In diesem Buch erfahren Eltern und alle, die mit Kopfschmerzkindern zu tun haben, aus der Feder einer Psychosomatik-Expertin: - was Heranwachsende mit Kopfschmerzen ausdrücken - was sie brauchen, um entspannen zu können - was getan werden kann, damit die Störung nicht mehr auftritt - welche Übungen sich am besten bewährt haben und Kindern Spaß machen. Dauer-Medikation ist meistens keine Lösung, die Krankheit will verstanden werden Dieses Buch richtet sich an: - Eltern von "Kopfschmerzkindern" - LehrerInnen - KinderärztInnen - Kinder- und Familienpsychologen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 172
Ähnliche
HANNE SEEMANN
Kopfschmerzkinder
Was Eltern, Lehrer und Therapeuten tun können
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Besuchen Sie uns im Internet: www.klett-cotta.de
Klett-Cotta
© 2013 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Titelbild: © artenot – Fotolia.com
Gesamtgestaltung: Weiß-Freiburg GmbH – Graphik & Buchgestaltung
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Printausgabe: ISBN 978-3-608-86038-2
E-Book: ISBN 978-3-608-10568-1
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Schnelleinstieg
Immer mehr Kinder leiden unter Kopfschmerzen
Primäre und sekundäre Kopfschmerzen
Am häufigsten: Spannungskopfschmerz und Migräne
Der Migräneanfall – eine »Funktionsstörung«
Das Migräne-Hirn
Das Spannungskopfschmerz-Hirn
Schneller sein als die Migräne
Auszeit – Selbstvertrauen – Mut zum Rückzug: Übungen
Das Kopfschmerzkind und seine Familie
Das Kopfschmerzkind und seine Lehrer
Hilfreiche Strategien – Entspannungsübungen
Bücher, Hinweise und Adressen
Inhalt
Vorwort
1. Einführung
2. Migräne und andere Kopfschmerzarten – was Eltern, Lehrer und Therapeuten wissen sollten
3. Migräne und Spannungskopfschmerz – Unterschiede und Ähnlichkeiten
Migräne – Begleitstörungen und Aura
Wozu ist Migräne da?
Migräne-Auslöser
Kopfschmerzen sind Schutz-Signale
Ist Migräne heilbar?
Das Migräne-Hirn
Das Spannungskopfschmerz-Hirn
4. Primäre Kopfschmerzen – besonders Migräne
Erwartungserregung und ihre Folgen
Sensibilität – eine Schwäche oder eine Stärke?
Sei schneller als deine Kopfschmerzen!
Schutz und Sicherheit braucht das Kind
Sorgen, Wut und Aggressionen – wohin damit?
Selbstvertrauen, Mut und Kraft
Für Ausgleich sorgen
Lerne wählen!
Voran in die Zukunft!
5. Das Kopfschmerzkind und seine Familie
Fürsorge und Autonomie
Der Umgang mit dem eigenen Körper
Das familiäre Reizmilieu
Leistungsorientierung und was sonst noch Druck macht
6. Das Kopfschmerzkind und seine Lehrer
7. Direkte und indirekte hilfreiche Strategien
Die Krankengeschichte (Anamnese)
Direkte Strategien zur Bewältigung akuter Schmerzen
Mein Körper und ich
Entspannungsübungen
Abschließende Gedanken
Zitierte Literatur
Nützliche Hinweise und Adressen
Vorwort
Wenn man erwachsene Kopfschmerzpatienten fragt, wann ihre Kopfschmerzen begonnen haben, so sagen sie sehr oft: »So ungefähr mit 11 Jahren.« Wir wissen aber, dass das Übel meist schon viel früher angefangen hatte, dass aber die Erinnerung nur bis dorthin zurückreicht und auch die Eltern erst relativ spät aufmerksam geworden sind. Wir werden sehen, dass manche Bauchschmerzen im frühen Kindesalter schon auf eine Migräne hinweisen und dass manche Kinder mit Asthma oder Neurodermitis später Migräne entwickeln, die dann die früheren Störungen ersetzt.
Gleichzeitig ist bekannt, dass etwa die Hälfte der Kopfschmerzkinder die Schmerzen in ihr Erwachsenenalter mitnehmen, wenn sie keine Beratung erhalten.
Wenn wir also versuchen, schon früh die Weichen so zu stellen, dass diese Kinder für sich eine Lebensweise entwickeln können, die sie vor Kopfschmerzen zumindest weitgehend bewahrt, so haben sie etwas für ihr weiteres Leben gelernt. Kinder sind in ihren Lebensweisen noch viel flexibler als Erwachsene, die in das Netz ihrer Gewohnheiten schon fest eingesponnen sind und ihm kaum entkommen können.
Früher habe ich immer sehr betont, dass die Therapie in die Hände von erfahrenen und ausgewiesenen Therapeuten gehört und dass Eltern bei ihren eigenen Kindern die Finger davon lassen sollten – Lehrer auch. Diese Meinung vertrete ich immer noch – bin aber mittlerweile zu der Ansicht gekommen, dass diese Kinder, wie auch alle anderen Menschen mit funktionellen Störungen, eigentlich keine Therapie benötigen. Was sie selbst und ihr näheres soziales Umfeld aber brauchen, ist eine gute Beratung, damit sie die Kopfschmerzen in ihrer Funktion verstehen, und Anleitung, was man tun kann, um sie zu vermeiden, d.h., ein weitgehend kopfschmerzfreies und – psychosomatisch gesehen – störungsfreies Leben zu finden.
Dieses neue Buch ist eine veränderte Fassung des gleichnamigen Buches von 2002, das aus einem Forschungsprojekt am Uniklinikum Heidelberg unter Mitarbeit meiner damaligen Kolleginnen Jutta Schultis und Babett Englert hervorgegangen ist. Nun, nach 10 Jahren weiterer therapeutischer Erfahrungen mit Kopfschmerzkindern und in der ambulanten Beratung von Eltern und Lehrern, die mit diesen Kindern zu tun haben, fasse ich die wichtigsten Inhalte des früheren Buches zusammen; besonders die Teile, die sich im Umgang mit Kopfschmerzkindern praktisch am besten bewährt haben. Die Kinderzeichnungen wurden ebenfalls diesem Buch entnommen.
Zuerst einmal kommt es darauf an zu verstehen, was das ist: Migräne, Entspannungsmigräne, Spannungskopfschmerz oder gemischte Formen, und was die Kinder dabei durchmachen. Als Zweites enthält das Buch viele Anregungen und praktische Tipps, Geschichten und Übungen, die für Kinder und Jugendliche hilfreich sein können, wenn sie Kopfschmerzen haben – oder noch besser: um Kopfschmerzen zu vermeiden. Denn diese Kinder bringen eine besondere Konstitution mit auf die Welt – und wenn sie es schaffen, zu ihrem angeborenen Naturell die passende Lebensweise zu finden, ist es nicht nötig, Kopfschmerzen zu haben.
Zielgruppe dieses Buches sind also Kopfschmerzkinder – obwohl alles, was hier gesagt und empfohlen wird, auch auf Erwachsene zutrifft.
In diesem Sinn wünsche ich allen Leserinnen und Lesern, seien es Kinder, Jugendliche, Eltern, Lehrer oder Therapeuten, ein paar Aha-Erlebnisse und guten Gewinn.
Heidelberg, im Frühjahr 2013
1. Einführung
Kopfschmerzen im Kindesalter werden immer häufiger. Vor etwa 50 Jahren berichtete eine bahnbrechende schwedische Studie, dass 45% der untersuchten Kinder bis zu 14 Jahren an Kopfschmerzen litten, 4,5% davon an Migräne. Ende der 70er-Jahre stellten finnische Forscher einen Anstieg der Kopfschmerzen bei 14-jährigen Schülern auf 69% fest. Auch einige neuere Untersuchungen aus den Niederlanden und Italien bestätigen den Trend, wonach die Kopfschmerzhäufigkeit bei Kindern ansteigt. In einer von Raimund Pothmann 1999 durchgeführten Erhebung an Schulkindern in der Stadt Wuppertal und Umgebung stellte sich heraus, dass im Alter von 8–9 Jahren bereits 83% der Schüler Kopfschmerzerfahrungen hatten, eine Rate, die im Alter von 15–16 Jahren auf 93% anstieg (Pothmann 1999).
Wir können also von Kopfschmerzen als einer fast allgemein bekannten Alltagserfahrung sprechen. Sie gehören quasi zum Leben dazu und werden von Eltern und den Kindern als Belastungszeichen gewertet, worauf mit Pausen, Ruhe, Bewegung, frische Luft – je nachdem, was individuell hilft – reagiert wird. Man geht deswegen nicht gleich zum Arzt, nimmt vielleicht eine Tablette ein und beunruhigt sich nicht weiter.
15% aller Kinder zwischen 8–16 Jahren haben behandlungsbedürftige Kopfschmerzen von mittlerer bis starker Intensität, ca. 5% leiden unter Migräne. Aber auch schon kleine Kinder können starke Kopfschmerzen entwickeln. Entgegen einer lange geltenden, aber irrigen Meinung, auch von Neurologen, kann Migräne schon bei Kindern unter einem Jahr auftreten. Das ist nicht verwunderlich, wenn man von einer angeborenen Disposition ausgeht. So frühe Schmerzen sind dann aber schwierig zu diagnostizieren.
Da später bei vielen der betroffenen Kinder der Kopfschmerz bis ins Erwachsenenalter hinein bestehen bleibt, erscheint es wenig sinnvoll abzuwarten, ob sich die Schmerzen »auswachsen« werden. Denn man weiß ja nicht, bei wem und unter welchen Bedingungen sie das tun.
Wir wissen auch nicht, warum die Häufigkeit von Kopfschmerzen bei Kindern seit Jahren zunimmt. Wenn wir aber sehen, dass immer früher die kognitiven Fähigkeiten von Kindern schwerpunktmäßig gefördert werden – dass die Kopf-Arbeit schon früh im Kindesalter und danach immer stärker betont wird und ausgleichendes emotionales und körperliches Spiel ohne Leistungsanspruch mehr und mehr auf der Strecke bleiben –, dann wundert es eigentlich nicht, dass so mancher Kinds-Kopf sich dagegen wehrt und wehtut. Da hilft nur eine Pause! Am besten hinlegen, die Augen zumachen und sich zurückziehen. Denn mit Kopfschmerzen lässt sich schlecht denken.
Es ist schade, wenn schon Kinder immer wieder in Situationen geraten, die nach Rückzug verlangen. Denn Kinder wollen und sollen »hinaus« in die Welt. Insofern ist es nicht übertrieben zu sagen, dass Kopfschmerzen, ganz besonders die Migräne, einsam machen. Kopfschmerzen werden oft nicht ernst genommen, weil sie unsichtbar sind und unsichtbar machen: Wenn die Kopfschmerzen da sind, ist das Kind nicht da – weil es sich selbst wegräumt, vielleicht schläft, vielleicht still vor sich hin leidet und wartet, bis die Kopfschmerzen wieder weg sind –, dann taucht das Kind wieder auf und ist wieder da. Außerdem sind die »normalen« Kopfschmerzen nicht lebensgefährlich in dem Sinne, dass man daran sterben könnte – allerdings sind sie dennoch lebensgefährdend, weil sie einem das Leben ganz schön ruinieren und vermiesen können. Wie und warum Kopfschmerzen entstehen, das schauen wir uns in den folgenden Kapiteln einmal genauer an.
2. Migräne und andere Kopfschmerzarten – was Eltern, Lehrer und Therapeuten wissen sollten
In der offiziellen Kopfschmerzklassifikation werden mehr als 100 verschiedene Formen unterschieden, die sich – vor allem für die Forschung – differenzialdiagnostisch benennen lassen. Ärzte kennen diese Klassifikation, benutzen sie aber nicht in dieser Differenziertheit. Sie unterscheiden zunächst einmal zwischen primären und sekundären Kopfschmerzen – und wegen dieser wichtigen Unterscheidung lässt man Kopfschmerzen unbedingt ärztlich abklären – immer dann, wenn sie neu auftreten, wenn sie sich deutlich verändert haben oder im Zusammenhang mit einer Erkrankung wie Meningitis oder in sehr seltenen Fällen einem Tumor oder einem eher banalen Ereignis, z. B. einer Gehirnerschütterung, stehen könnten. Dann nämlich könnte es sich um sekundäre bzw. symptomatische Kopfschmerzen handeln, deren Ursache geklärt und behandelt werden muss. Auch bei akut auftretenden Kopfschmerzen mit Fieber und Nackensteifigkeit, einem Krampfanfall oder sehr heftigem und plötzlichen Beginn der Kopfschmerzen sollte man zum Arzt gehen. Doch kann auch ein Migräneanfall so heftig und beängstigend sein, dass eine neurologische Abklärung für Eltern und Kind eine Beruhigung darstellt. Denn Neurologen wissen und können erklären, dass zum Beispiel Seh-, Hör- und Riechstörungen, Gefühlsstörungen in Armen und Beinen bis hin zu Taubheit und Lähmungserscheinungen Vorboten eines Migräneanfalls sein können – sogenannte Aura-Symptome.
Manche Kinder haben Kopfschmerzen in der Schule, weil sie schlecht sehen – dann müssen sie zum Augenarzt. Bei Erkältungen, Wachstumsschüben, Infektionskrankheiten, Nebenhöhlenentzündungen oder Kreislaufstörungen treten Kopfschmerzen häufig auf und vergehen wieder, wenn die Erkrankung oder die Regulationsstörung abklingt.
Es kommt allerdings gar nicht selten vor, dass nach dem Ausschluss eines Krankheitsbefundes Eltern so weit beruhigt sind, dass sie danach ganz vergessen, was der Anlass des Arztbesuches war. Wenn dann das Kind weiterhin unter Kopfschmerzen leidet und wenn man diese Kopfschmerzen schon oft in ähnlicher Form erlebt hat und sie gut kennt, ist das Problem mit dem Arztbesuch und einer beruhigenden Diagnose noch nicht gelöst! Dann muss weiter überlegt werden, und zwar in therapeutischer Richtung.
Wenn Psychotherapeuten wegen Kopfschmerzen konsultiert werden, sollten aber auch sie immer zuerst danach fragen, ob das Kind ärztlich untersucht ist.
Man weiß, dass es sich bei 95% aller Kopfschmerzen um primäre bzw. idiopathische Kopfschmerzen handelt, also keine weitere Krankheitsursache im Spiel ist. Von ihnen wird ab jetzt die Rede sein.
Die beiden häufigsten Formen sind die Migräne und der Kopfschmerz vom Spannungstyp, kurz Spannungskopfschmerzgenannt. Bei jüngeren Kindern handelt es sich oft noch um eine Mischform beider Typen, und es kommt sogar vor, dass Spannungskopfschmerzen in Migräne übergehen und umgekehrt. Man geht davon aus, dass bei beiden Kopfschmerzformen die zugrunde liegende Konstitution des zentralen und des vegetativen Nervensystems ähnlich sensibel ist, die Ausformung der Symptomatik sich jedoch unterschiedlich gestaltet – wobei die Reaktion bei Kindern noch nicht so festgelegt bzw. noch flexibler ist als später im Erwachsenenalter, wenn die Gewohnheitsbildung als Antwort des Körpers – in dem Fall des Kopfes – auf Belastungen sich in einer weitgehend gleich bleibenden Symptomsprache verfestigt hat.
Für das Verständnis des Kindes, was in seinem Körper vor sich geht, für den kurzfristigen Umgang mit den Kopfschmerzen und die Medikamentenwahl ist es nützlich, die beiden Haupttypen, also Migräne und Spannungskopfschmerzen, zu unterscheiden – auch, damit der Schmerz einen Namen hat, z.B. für Entschuldigungen in der Schule.
Die Ursachen und die grundlegende – also lebensbestimmende – Therapie sind jedoch die gleichen, wie wir auch in unserem Forschungsprojekt herausgefunden haben (Seemann et al. 2002).
Deshalb werde ich die beiden Schmerzformen zunächst unterscheidend beschreiben und danach zu allgemeinen therapeutischen Überlegungen und praktischen Ratschlägen übergehen.
3. Migräne und Spannungskopfschmerz – Unterschiede und Ähnlichkeiten
Der Migräne-Kopfschmerz tritt meist einseitig und pulsierend auf. Vorausgehend oder begleitend sind Übelkeit mit oder ohne Erbrechen und eine Überempfindlichkeit gegenüber Licht und Geräuschen. Das deutlichste Unterscheidungskriterium gegenüber dem Spannungskopfschmerz ist die Schmerzverstärkung bei körperlicher Aktivität, weshalb man sagt: Treppensteigen verschlimmert. Die Kinder spüren jeden Schritt bis in den Kopf. Bücken verstärkt den Schmerz ebenfalls wie alle schnellen Bewegungen.
Bei Spannungskopfschmerzen kann dagegen Bewegung, besonders draußen in der frischen Luft, lindernd sein. Kopfschmerzen vom Spannungstyp sind ziehend, dumpf, drückend und ziehen oft vom Nacken aus über den ganzen Kopf nach vorne in die Stirn. Der Spannungskopfschmerz naht schleichend heran, baut sich langsam auf, wie wenn sich da etwas zusammenbraut. Da dieser Kopfschmerz anfangs oder auch über lange Zeit hinweg mäßig stark sein kann, ist es möglich, sich durch Konzentration auf etwas anderes von ihm abzulenken. Wenn der Schmerz beginnt, ist es ratsam, nach draußen zu gehen, bewusst zu atmen, sich zu bewegen, den Blick zu weiten und zu entspannen. Wenn ein Kind längere Zeit unbeweglich und »steif« dasitzt oder wenn es die Aufforderung »sitz gerade« befolgt und dabei den Kopf stark nach vorne abknicken muss, um in sein Schulheft zu schauen, ist das für Spannungskopfschmerzen eine passende Gelegenheit, in Erscheinung zu treten. Dann ist Bewegung angesagt. Wenn der Kopfschmerz andauert und schlimm wird, ziehen die Kinder sich gern zurück und legen sich hin. Das ist klug.
Spannungskopfschmerzen sind vielen Menschen vertraut und leichter verständlich als die Migräne. Klar sollte jedoch sein: Wenn Spannungskopfschmerzen chronisch geworden sind – bei mehr als 15 Kopfschmerztagen im Monat –, sind sie schwer zu behandeln – also chronifizierende Kopfschmerzen nicht auf die leichte Schulter nehmen! Hinzu kommt, dass Spannungskopfschmerzen meist gut auf gängige Schmerzmittel ansprechen und die Betroffenen gar nicht merken, dass sie davon regelmäßig – also zu häufig und zu viel – einnehmen. Dann nämlich kann der Spannungskopfschmerz in einen Schmerzmittel-Kopfschmerz übergehen, und es entsteht ein schleichender Teufelskreis, dem man nur durch einen totalen Schmerzmittelentzug entkommen kann.
Die Migräne hat die Eigenschaft, meist sehr schnell, ja überfallartig zu kommen, sodass man ebenso schnell reagieren muss. Wir werden im therapeutischen Teil dem Kind sogar raten, noch schneller zu sein als seine Migräne und ihr nach Möglichkeit zuvorzukommen und zu entrinnen.
Die Migräne ist ein oft dramatisches und auf den ersten Blick unverständliches Ereignis, das aus dem normalen Rahmen des Alltagslebens herausfällt. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung ist Migräne nicht einfach ein Synonym für starke Kopfschmerzen, es handelt sich dabei um ein sehr komplexes, viele Körperfunktionen betreffendes Geschehen. Da die dabei auftretenden Symptome vielfältig und uneinheitlich sind bzw. bei jedem Menschen anders kombiniert sein können, fällt es auch routinierten und aufmerksamen Ärzten und Eltern schwer, genau festzustellen, woran das Kind leidet. Hinzu kommt, dass die Migräneformen in der frühen Kindheit sich oft gar nicht im Kopf abspielen, sondern im Bauch – die sogenannte Bauch-Migräne –, und, wie man weiß, ist Bauchweh, auch in Form von Koliken, ein sehr häufiges und unspezifisches Symptom im Kindesalter.
Es ist nützlich, sich einmal klarzumachen, was im Organismus eines Menschen abläuft, wenn er einen Migräneanfall bekommt, und mit welchen Besonderheiten das Nervensystem eines Menschen ausgestattet ist, der eine Veranlagung zu Migräne hat.
Zunächst einmal sehen wir, dass es sich bei der Migräne um ein Anfallsgeschehen handelt. Ein Migräneanfall hat Vorläufer (Prodrome), dann kommt der eigentliche Ausbruch mit Schmerzen, oft auch Übelkeit und Erbrechen, der Rückzug mit Tiefschlaf, danach das Abklingen und vollständige Verschwinden aller Symptome – und dann ist alles wieder gut. Es bleibt kein Schaden und keine Zerstörung zurück, so dramatisch die Ereignisse auch gewesen sein mögen!
Migräne – Begleitstörungen und Aura
Für den Migräneablauf typisch sind vorausgehende Begleitstörungen wie Licht- und Geräuschempfindlichkeit, d.h., Licht wird heller, Geräusche werden lauter empfunden und stören erheblich, Gerüche, die sonst im Hintergrund sind, treten deutlich hervor und verursachen Ekelgefühle – z.B. schlechte Luft in Räumen oder abgestandener Zigarettenrauch im Auto. Manchmal müssen Kinder erbrechen, worauf es ihnen etwas besser geht. Wenn sie danach einschlafen können, wachen sie einige Stunden später wieder auf, fühlen sich erholt und sind um den eigentlichen Migräne-Anfall herumgekommen.
Nicht selten treten auch »seltsame« und beunruhigende Begleiterscheinungen auf wie visuelle Halluzinationen, Lähmungen der Gliedmaßen, sehr unangenehme Geruchsempfindungen oder unwillkürliche vegetative Reaktionen wie andauerndes Gähnen, Harndrang, Hitze- oder Kältegefühle, Gesichtsblässe oder -rötung und anderes. Die »seltsamen«, weil unmotivierten Phänomene werden, wenn sie der Migräne vorausgehen, Aura genannt. Für die meisten Betroffenen, seien es nun Kinder, ihre Eltern oder erwachsene Migränepatienten, sind Auraphänomene etwas, was sie ängstigt. Nehmen wir zum Beispiel die visuellen Veränderungen der Umgebung in den Blick, so ist es durchaus irritierend, wenn bei einer sogenannten Halbseitenblindheit nur noch die eine Hälfte der Realität sichtbar ist, die andere Hälfte total fehlt. Oder wenn in einem Verkehrsschild oder einem Text leere Stellen, also Löcher, auftauchen. Ein Schulkind kann dann nicht aus einem Buch vorlesen, es kann auch nicht mit dem Fahrrad fahren, keine Straßenschilder erkennen – ein normaler Umgang mit der räumlichen Umgebung ist dann nicht möglich. Wenn sich ein Mensch in einer Auraphase befindet, so ist die »Verzerrung« der Realität für ihn absolut realistisch. Er kommt nicht darauf, dass die Wirklichkeit »eigentlich« anders aussieht, obwohl er weiß, dass dies gerade eine Migräneaura ist – das hat er schon oft erlebt.
Die visuellen Halluzinationen, z.B. bunte Sternchen, helle Flecken, farbige Blitze und kreisende Bewegungen, dauern nicht allzu lang an und vergehen nach 20–40 Minuten wieder, bevor der Kopfschmerz einsetzt. Selten einmal gibt es auch sogenannte »isolierte Auren«, die ganz ohne nachfolgende Kopfschmerzen auftreten und nicht so leicht als Aura zu deuten sind.
Andere vorausgehende Phänomene wie Stimmungslabilität, Hautüberempfindlichkeit oder leichtes Fieber werden nicht so leicht als Vorboten der Migräne erkannt. Ärzte und Psychotherapeuten sollten die Vielfalt von Auraphänomenen zuordnen können und ihre kleinen Klienten und deren Eltern beruhigen. Auraerscheinungen deuten nicht auf eine psychische Störung hin, was man möglicherweise vermuten könnte, da ja auch Halluzinationen auftreten, sondern auf eine vorübergehende Funktionsstörung des Zentralnervensystems – wie denn überhaupt der gesamte Migräneanfall als solche verstanden werden muss.
Die Vielfalt der Phänomene, die bei Migräneanfällen auftreten, einschließlich Auraerscheinungen, ist sehr eindrucksvoll bei Oliver Sacks (2004) beschrieben – ein Buch, das sich zu lesen lohnt! Auch Alice im Wunderland, besonders der Band Alice hinter den Spiegeln, steckt voller überraschender Wahrnehmungsverzerrungen, was vielleicht darauf schließen lässt, dass sich sein Autor Lewis Carrol mit der Migräne-Aura auskannte. Das soll aber nicht heißen, dass er Migräne hatte: Viele moderne Werke der bildenden Kunst haben Ähnlichkeiten mit Auraphänomenen und werden von Migränepatienten ihren eigenen Aurabildern zugeordnet, was einfach heißt: Unser Nervensystem ist hochgradig bildfähig, sei es in den Träumen, unter Drogen, in der Fantasie. Es muss ständig eine gewisse Arbeit investieren, um seine innere Ordnung und unsere gemeinsam geteilte Weltsicht aufrechtzuerhalten. Wenn es das z.B. wegen Überforderung nicht mehr hinbekommt, wie bei der Migräne, dann entstehen solche Wahrnehmungsverzerrungen wie in der Aura.
Hier kann nicht auf alle vorkommenden Aura-Phänomene eingegangen werden, die häufigsten sind:
Halluzinationen
(Sie bezeichnen ein Erleben, das fälschlicherweise für die Realität gehalten wird – auch Träume sind Halluzinationen.)
Optische Halluzinationen, z.B. leuchtende Helle, leuchtende Sterne, Blitze, Funken, Kräuseln, Wellenbewegungen, geometrische Figuren, die durch das Gesichtsfeld wandern in Schwärmen oder einzeln. Komplexe Skotome, z.B. das Flimmerskotom oder das negative Skotom, bei dem der Patient in einem Segment seines Gesichtsfeldes teilweise oder völlig blind ist. Optische Halluzinationen werden von den Patienten sehr oft in sinnvolle Bilder verwandelt bzw. als solche gedeutet.
Taktile Halluzinationen, z.B. ein Vibrieren im Bereich der Zunge und des Mundes, den Händen, seltener den Füßen, die sich ausbreiten können. Sie können auch in negativer Form als Taubheitsgefühle auftreten.
Andere Halluzinationen, z.B. besondere Gerüche, selten auch seltsame Geschmacksempfindungen, häufiger Déjà-vu-Gefühle oder Empfindungen von Bewegungen des eigenen Körpers, die nicht stattgefunden haben.
Veränderungen von Wahrnehmungsschwellen,
z.B. starke Aufhellung des Sehens, Nachbilder von blendender Helligkeit, leise Geräusche erscheinen überwältigend laut, leichteste Berührungen werden als unerträglich heftig empfunden.
Veränderungen des Erregungsniveaus
von Bewusstsein und Muskeltonus z.B. als eine sehr wache, angespannte und vigilante Phase, oft gefolgt von einer lethargischen Phase, also großer Trägheit, bis zum Bewusstseinsverlust.
Veränderungen von Stimmung und Affekt
im Sinne »aufgezwungener« Affektausbrüche dramatischer Art, z.B. Angst oder auch große unmotivierte Freude sind eher selten. In weniger dramatischer Form kommen Stimmungsschwankungen während des Migräneanfalls häufig vor.
Komplexe Störungen höherer integrativer Funktionen
entwickeln sich meist aus den einfacheren Phänomenen, z.B. Liliput-, Gulliver-, Zoom-, Mosaik- und Filmillusionen, Sprech- und Sprachstörungen, traum- und albtraumartige Zustände.
Auraphänomene treten oft zeitlich nacheinander auf, vermischen sich miteinander, sind meist komplexer, als die genannten Begriffe vermuten lassen, und sind für die Betroffenen schwer in Sprache zu fassen. Detaillierte Beschreibungen von Auraphänomenen finden sich bei O. Sacks (2004).
Eine Besonderheit sei aber abschließend noch einmal betont: Es gibt auch isolierte Auren von wenigen Minuten Dauer als einzige Manifestation einer Migräneattacke, ohne dass sich anschließend Kopfschmerzen oder vegetative Störungen wie Übelkeit und Erbrechen einstellen, also Migräne ohne Kopfschmerzen. Auch eine heftige Bauchschmerz- oder Fieberattacke kann ein Migräneäquivalent sein.
Deshalb ist es nützlich, die Funktion der Anfallsdynamik ganz allgemein zu beschreiben, weil dann verständlich wird, was der Körper mit der Migräne bezweckt, und weil man daraus etwas für den Umgang mit ihr schlussfolgern kann.