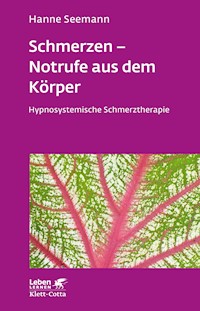19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Psychosomatische Störung – alles ist Kommunikation Nicht wenige Menschen leiden unter teils heftigsten ungeklärten Schmerzen, chronischer Erschöpfung, Magen-, Darm- und Atemstörungen oder anderen Symptomen. »Ohne Organbefund« heißt es dann nach einer oft jahrelangen Odyssee durch das Gesundheitssystem. Warum tut uns der Körper so etwas an? Hanne Seemann, Expertin für Psychosomatik seit mehr als 30 Jahren, hat eine einleuchtende, noch viel zu wenig beachtete Erklärung: Über solche Störungen kommuniziert unsere Seele mit uns. Wenn der Mensch und seine Lebensumstände, sei es der Beruf, die Beziehung, der Wohnort o.a. nicht mehr zusammenpassen, wenn Wünsche, Sehnsüchte, Lebensziele hartnäckig verleugnet und nicht gelebt werden, dann spricht sehr oft der Körper zu uns. Wie sich Betroffene selbst auf die Spur kommen oder kluge Fachleute ihre PatientInnen darin unterstützen können, zeigt dieses lebenskluge Buch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 213
Ähnliche
Hanne Seemann
Psychosomatik zwischen Medizin und Psychotherapie
Mit der Seele sprechen lernen
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2022 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Weiß/Freiburg GmbH
unter Verwendung einer Abbildung von Victor Koldunov/Adobe Stock
Gesetzt von Eberl & Koesel Studio, Altusried-Krugzell
Gedruckt und gebunden von CPI Clausen & Bosse GmbH, Leck
ISBN 978-3-608-98664-8
E-Book ISBN 978-3-608-11958-9
PDF-E-Book ISBN 978-3-608-20594-7
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Vorwort
1
Einleitung: Man tut, was man gelernt hat
2
Psychosomatische Symptome sind etwas ganz Normales – jeder kennt sie
3
Jeder tut, was er kann – der langwierige Weg durch das therapeutische Versorgungsystem
4
Jeder tut, was er gelernt hat – was können Psychotherapeuten und was tun sie demzufolge?
5
Verhaltenstherapie und andere Psychotherapieformen – bezogen auf Psychosomatik
6
Der Körper als Objekt oder Subjekt?
Therapieverfahren und ihre Beziehung zum Körper
7
Der Körper ist ein individuelles Subjekt
8
Die psychosomatische Störung: Alles ist Kommunikation
9
Wer spricht zu wem?
10
In der Praxis: Mit dem Körper sprechen!
11
Die Seele und ihr Körper: Der beseelte Leib
12
Seel-Sorge statt Psychotherapie – im Ernst?
Das bio-psycho-soziale Modell um die spirituelle Dimension erweitern!
Über Sehnsucht nachdenken
Die Seele und ihre Orte
Die Sehnsucht nach dem Tod
13
Der Lebensbogen – wann spricht die Seele besonders laut?
Kindheit
Jugendliche
Erwachsene
Die Lebensmitte
Alt werden und sterben
14
Praxis: Der Zeitfaktor in Therapie und Beratung – langwierig oder punktuell?
15
Die seelische Berührung als Schlüsselerlebnis
16
Und am Ende: Bleiben Sie gesund!
Bücher zum Weiterlesen
Man tut, was man kann
Für Eva
Vorwort
Wenn Patienten mit schon lange bestehenden psychosomatischen Störungen bei mir nach einem Behandlungstermin anfragen, dann haben sie entweder eine Überweisung oder eine Empfehlung zur Psychotherapie. Da ich niedergelassene psychologische – also nicht ärztliche – Psychotherapeutin bin, denken sie, sie wären bei mir vielleicht am richtigen Platz – falls wir etwas miteinander anfangen können, was wir nach ein oder zwei Probesitzungen wissen würden.
Da ich mich auf Psychosomatik spezialisiert habe, also ausschließlich Menschen mit psychosomatischen Störungen behandle, sind sieverwundert und irgendwie auch enttäuscht, wenn ich sage, dass ich keine Probesitzungen mache und auch keine fortlaufende Psychotherapie anbiete, sondern nur eine einzige Beratungssitzung – die allerdings ungefähr zwei Stunden lang dauert und die sie selbst bezahlen müssen. Ich habe eine Privatpraxis. Wenn dann ein solcher Patient sagt: »Ja, gut, wenn das reicht!?« Sage ich: »Das werden wir dann sehen.«
Die meisten meiner Patienten kommen auf Empfehlung von früheren Patienten oder einer bestimmten Ärztin, die mich kennt. Oder sie haben ein, zwei Bücher gelesen oder meinen Psychosomatik-Vortrag gehört und sagen: »Ich glaube, jetzt habe ich endlich verstanden, was ich habe, können wir einen Termin ausmachen?«
Wenn eine Patientin oder ein Patient fest davon überzeugt ist, eine ›richtige‹ Psychotherapie zu benötigen und ich, auf Nachfrage, bestätige, dass ich tatsächlich Psychotherapeutin bin, kommen natürlich alle gern erst mal zu diesem einen ominösen Beratungstermin herbei – denn den bekommen sie innerhalb einer Woche, während sie sich vorher schon mehrere Abfuhren und sehr lange Wartezeiten bei Psychotherapeuten eingehandelt haben und froh sind, dass sich zunächst mal schnell jemand um sie kümmert. Ich sage dann: »Kommen Sie mal her – und am Ende der Sitzung entscheiden wir gemeinsam, wie es weitergehen soll.«
Patienten mit diagnostisch erhärteten psychischen Störungen, die einen Namen haben, nehme ich nicht an und wünsche ihnen Glück auf ihrer Suche nach einem Psychotherapeuten – wohin die psychischen Störungen auch gehören.
Die psychosomatischen Störungen nicht.
Die gehören in eine sachkundige psychosomatische Beratung – und die wirkt schnell. Sie muss auch schnell greifen, weil hier Not am Mann, der Frau oder dem Kind ist und weil sich diese Art von Störungen durch therapeutische Fehlversuche verschlimmern. Diesen Menschen geht es schlecht, ihr Leben stagniert und ihre Zukunft ist blockiert. Weil sich aber in ihrem Inneren schon seit einiger Zeit eine lebenswichtige Veränderung angebahnt hat, die gewissermaßen schon in den Startlöchern sitzt und darauf wartet, loszulaufen, kommt die Veränderung sehr schnell in Gang – in einer Sitzung eben –, wenn man den richtigen Impuls setzt und die Richtung findet, wo es hingehen soll: in das passende eigene Leben.
Bei psychischen Störungen braucht es eine mehr oder weniger langdauernde psychotherapeutische Begleitung: also Psychotherapie.
Die Störungsbilder – psychische oder psychosomatische – auseinanderzuhalten und entsprechend therapeutisch zu handeln, darum geht es auf den folgenden Seiten.
Und ob Sie, verehrte Leser, zu den angesprochenen Patienten gehören oder zur Zunft der therapeutisch Tätigen – ich hoffe, dass Sie einen Gewinn aus der Lektüre ziehen und sich zukünftig weniger häufig verirren mögen – in Ihrem Leben und in Ihrer Arbeit.
St. Leon-Rot, im März 2022
P. S.: An dieser Stelle schon gleich mal eine Anmerkung, weil der Leserin und dem Leser schon aufgefallen sein dürfte, dass ich nicht gendergerecht schreibe und spreche. Deshalb hier explizit: Mit »der Mensch« meine ich natürlich immer auch »die Menschin«, mit »der Körper« immer auch »die Körperin«. »Die Psyche« oder »die Seele« meint nicht, dass Männer sowas nicht haben, obwohl diesbezügliche Gerüchte kursieren.
1 Einleitung: Man tut, was man gelernt hat
Wenn jemand im Laufe seines Lebens oder zum Ende hin sagt: »Ich habe getan, was ich konnte«, so zeugt das zumindest von Bemühen und gutem Willen. Und ob es nun viel oder wenig, gut oder schlecht war – mehr kann nicht verlangt werden.
Das gilt für viele Lebenssituationen, und es gilt auch für Ärzte und Psychotherapeuten, an die sich Menschen mit einer psychosomatischen Störung um Hilfe wenden.
Und, was tun wir? Eben das, was wir können, und das ist zunächst einmal das, was wir gelernt haben. Für die noch jungen und angehenden Ärzte und Psychotherapeuten trifft das im Besonderen zu – und, um es gleich zu sagen: Über Psychosomatik haben wir alle so gut wie nichts gelernt. Daher kommt die mehr oder weniger große Hilflosigkeit, mit der Ärzte und Psychotherapeuten – ebenso wie die betroffenen Patienten – psychosomatischen Störungen gegenüberstehen.
Es gibt auch viele psychosomatische Kliniken und Ambulanzen, wohin sich Patienten mit psychosomatischen Störungen wenden können. Weil dort aber keiner sagen will: »Davon verstehe ich zu wenig«, tut eben jeder, was er kann. Der Hausarzt überweist an einen oder mehrere Fachkollegen zur Diagnostik, und der Psychologe tut auch, was er gelernt hat: Psychotherapie.
2 Psychosomatische Symptome sind etwas ganz Normales – jeder kennt sie
Bevor ein Mensch den langwierigen und oft frustrierenden Weg durch das therapeutische Versorgungssystem antritt, hat er meistens schon so manche psychosomatische Störung erlebt und bewältigt.
Auch ein ansonsten gesunder Mensch, welchen Alters auch immer, bekommt hin und wieder körperliche Symptome, die ihn stören. Er überlegt, was denn da mit seinem Rücken oder Magen, seiner Haut oder seinem Kopf los sein könnte. Und er denkt darüber nach, denn, wie gesagt, die Symptome stören ihn. Das ist nämlich ihr Sinn und Zweck: auf sich aufmerksam zu machen. Darauf komme ich später noch ausführlich zurück.
Erst einmal kurz gesagt: Wenn dieser Mensch bemerkt, dass sein Rücken ihm weh tut, weil er zu viel gesessen, zu schwer getragen oder gehoben hat oder weil er sich mal wieder geärgert hat, ohne reagieren zu können – also zum Beispiel zu schreien, zu fluchen oder wegzugehen –, wenn er also diese Zusammenhänge bemerkt, dann hat der Mensch eine gute Chance, solche Belastungen künftig zu vermeiden. Wenn er sie nicht vermeiden kann, weiß er wenigstens, was sein Rücken ihm sagen will, und geht zu seinem Physiotherapeuten, der ihm ein paar Dehnübungen zeigt, die er allmorgendlich machen muss. Daraufhin gehen die Symptome wieder weg – meistens.
Ähnlich bei Kopfschmerzen, die sich bei psychischen Belastungen aufbauen, meistens im Laufe des Tages – wogegen sehr oft Kopfschmerztabletten gut helfen, was wiederum zum Problem werden kann, wenn sich nach und nach ein Medikamenten-Kopfschmerz entwickelt. Bei Migräne weiß die betroffene Frau – sehr oft sind es Frauen, die als Erwachsene Migräne haben –, dass sie ihre Migräne pünktlich am Wochenende bekommt, und nimmt sich vorsorglich schon mal nichts vor. Es kann auch sein, dass die Migräne-Attacke bei übermäßigem Stress, oft auch bei abrupten Wechselsituationen des Luftdrucks oder der eigenen Hormonlage kommt, und dagegen ist nur schwer etwas auszurichten.
Viele ganz unterschiedliche körperliche Symptome als Reaktion auf eine Tätigkeit, eine innere Gefühlslage oder Lebenssituation, die der Körper als unbekömmlich erkennt, könnte man hier aufzählen – der Körper hat viele Funktionen und Orte, womit er protestieren kann.
Hauptsache, der betroffene Mensch bemerkt die Störung, macht sich ein paar Gedanken darüber und sorgt dafür, dass die Störung wieder verschwindet: Das nennt man Gegenregulation zur Wiederherstellung eines bekömmlichen funktionellen Gleichgewichts.
Eine Störung ist darüber definiert, dass ein normales Funktionieren unterbrochen wird und ein »Licht« aufleuchtet. Es wird also aus dem Körper ein Signal gesendet, und zwar so, dass es auffällt, und so entsteht das, was man eine »psychosomatische Störung« nennt.
Es kann sich aber auch um eine körperliche Erkrankung handeln – so leicht und auf den ersten Blick lässt sich das nicht unterscheiden. Wenn der betroffene Mensch dieses Signal allerdings kennt und zuordnen kann, wie eben gesagt, dann weiß er: Es ist psychosomatisch. Dafür braucht es keine medizinische Diagnostik.
Psychosomatische Symptome, welcher Art auch immer, sind etwas völlig Normales – und insofern nicht professionell therapiebedürftig! Sie sind sehr oft die einzige Möglichkeit des Körpers, zu signalisieren, dass er mit »irgendetwas« nicht zurechtkommt und seinen nächsten Angehörigen, also den Menschen, der mit ihm zusammenlebt, um Unterstützung bitten muss. Der Körper hat nur diese Symptomsprache zur Verfügung – aber weil er sich nicht verbal ausdrücken kann, wie es sich gehören würde, also hochdeutsch, wird er oft nicht verstanden.
Ganz so ist es allerdings nicht: Bevor der Körper sich mit stark störenden Symptomen »meldet«, hat er natürlich noch andere, allerdings leisere Töne auf Lager: Das sind die Gefühle und Stimmungen – die aber oft nicht bis zum Empfänger durchdringen, weil der anderweitig zu beschäftigt ist. Und, weil viele Menschen es nicht gewohnt sind, auf ihren Körper zu hören – außer er schreit laut und hört nicht damit auf.
Der Mensch, der ja mit seinem Körper schon lang und auf Dauer zusammenlebt, sollte »eigentlich« wissen, dass sein Körper normalerweise gut funktioniert, dass er sich auf ihn weitgehend verlassen kann, dass sein Körper ihn überall hin begleitet und ihm gehorcht, das heißt, »zu Diensten« ist. Es ist aber – im Normalgang – eine hierarchische Beziehung: Der Mensch ist der Herr im Hause und sagt an, wohin es gehen soll und was gemacht wird.
Es ist wichtig, sich diesen Sachverhalt vor Augen zu führen, damit man eine angemessene Einstellung zum eigenen Körper bekommt. Dass sich der Körper auch den absurdesten Unternehmungen des Menschen unterwirft und mitgeht – man hört ja so manches über Extremsportarten und Expeditionen in gefährliche Gegenden –, ist an sich schon erstaunlich, dass er aber seinen Menschen in Notsituationen niemals im Stich lässt – also, wenn es ums Überleben geht –, zeigt uns, dass er ein guter Freund ist.
Das ändert sich offensichtlich, wenn er mit einer körperlichen Krankheit oder einer psychosomatischen oder psychischen Störung aufwartet, die von seinem Menschen über einen längeren Zeitraum nicht richtig beantwortet wird – da wird der Körper herrisch, kehrt die Hierarchie um und übernimmt das Kommando.
Was tun, wenn das der Fall ist?
3 Jeder tut, was er kann – der langwierige Weg durch das therapeutische Versorgungsystem
Eine schwerwiegende körperliche Erkrankung bringt man zu einem entsprechenden Arzt, eine psychische Störung zu einem Psychotherapeuten – wohin geht man mit einer psychosomatischen Störung?
Vernünftigerweise zuerst einmal zu einem Arzt, denn die Symptome sind körperlicher Natur, man spürt sie im Körper, und sie fühlen sich fast immer an wie eine körperliche Erkrankung.
Der Patient beschreibt also seine Beschwerden, der Arzt erhebt, wenn er sich dafür die Zeit nimmt, eine Anamnese und gibt dem Symptom einen Namen: Magenbeschwerden, Rückenschmerzen, umherwandernde Schmerzen – vielleicht Fibromyalgie?, Energieverlust – etwa Burn-out?, Niedergeschlagenheit und anhaltende Lustlosigkeit – depressive Verstimmung?, wiederkehrende Hals- oder Blasenentzündungen – banale Erkältungszeichen? und so weiter.
Für einen Hausarzt ist so etwas täglich Brot. Und was tut er? Das, was er über solche Beschwerden gelernt hat, also das, was er kann. Hausärzte des alten Schlags sind an ihren Patienten nah dran, sie kennen sie und oft auch ihre Familien- und Lebensumstände. Sie können deshalb auch leicht Zusammenhänge zwischen wiederkehrenden Beschwerden und den aktuellen Lebensumständen ihrer Patienten sehen und entsprechend unterscheiden: Hier handelt es sich um eine körperliche Erkrankung mit diagnostiziertem körperlichem Befund oder aber um eine psychosomatische Störung, bei der kein Befund erhoben werden kann, der das Ausmaß und die Hartnäckigkeit der Symptome erklären könnte. Wenn der Hausarzt Letzteres erkennt, dann berät er seinen Patienten so, dass der auch die entsprechenden Zusammenhänge sehen kann. So werden die psychosomatischen Beschwerden wieder »normalisiert« und verschwinden, wenn eine gute Lebensordnung erneut gefunden wurde.
Es kann aber sein, dass beide – Arzt und Patient – es nicht dabei bewenden lassen wollen und eine Behandlung aufnehmen. Dafür gibt es so einige Gründe. Z. B., dass der Patient etwas Greifbares erwartet – ein Rezept –, und auf Seiten des Arztes, dass er für eine Beratung, die naturgemäß Zeit kosten würde, zu wenig honoriert wird und lieber kurzerhand etwas verschreibt.
Auch dann, wenn ein Arzt seinen Patienten und dessen Lebensumstände gut kennt, wird er vielleicht dazu neigen, eine körperliche Untersuchung vorzunehmen, wird eine Diagnose stellen und eine Therapie vorschlagen. Bei Magenschmerzen zum Beispiel einen Säurehemmer oder eine Magenspiegelung, bei Verspannungen Muskelrelaxantien, bei Kopfschmerzen etwas aus den vielfältigen Angeboten an Schmerzmitteln, bei Schlafstörungen ein Schlafmittel, bei depressiven Verstimmungen ein Amitryptilin, und so weiter.
Eine psychosomatische Störung entzieht sich sehr schnell und nachhaltig diesem Procedere.
Das ist nämlich schon der erste Systemfehler, der dem Patienten mit psychosomatischen Störungen begegnet. Da es einfacher ist, ein Medikament zu schlucken, als sein Leben zu verändern, greift der Patient vielleicht lieber dazu. Seine Symptome reagieren kurzfristig auf die verordnete Therapie – z. B. Medikamente und Physiotherapie –, langfristig nicht. Sie bleiben beharrlich da, werden häufiger, oft auch schlimmer, und das frustriert sowohl den Patienten wie auch seinen Arzt, der deshalb den nächsten Schritt macht: Er zieht einen oder mehrere Fachkollegen hinzu.
Wenn ich sage: »Jeder tut, was er kann«, so ist dieses Vorgehen durchaus regelkonform und genau das, was ein Arzt gelernt hat. Er hat in der Regel nicht gelernt, eine körperliche Erkrankung von einer psychosomatischen Störung zu unterscheiden und geht deshalb den sicheren Weg der organischen Diagnostik, um nichts zu versäumen oder zu übersehen. Das ist gut und richtig.
Es gibt allerdings – wie gesagt – Hausärzte, die ihre Patienten so gut kennen, dass sie sehr schnell erkennen und entscheiden, wo eine fachärztliche Abklärung nötig ist und wo ein Rat, die Lebensführung betreffend, angebracht wäre.
Manche Hausärzte tun beides quasi gleichzeitig, und das ist optimal. Sie sagen: »So, wie Sie das schildern, sind Ihre Beschwerden wahrscheinlich psychosomatischer Natur. Aber zur Sicherheit lassen wir das beim Neurologen, Orthopäden, Enterologen, Kardiologen etc. abklären. Dann sehen wir weiter.«
Eine Erkrankung gehört ärztlich behandelt, eine psychosomatische Störung muss an den Patienten zurückverwiesen werden: Dafür ist er selbst zuständig, braucht aber Beratung.
Der Hausarzt als Vertrauensperson für den Patienten könnte also die Funktion übernehmen, die der Patient gegenüber seinem eigenen Körper einnehmen sollte, was er aber in dieser besonderen Situation, die ihn ängstigt, nicht kann.
Der Hausarzt als die nächstliegende professionelle Instanz hat zwar meistens in seinem Medizinstudium nichts oder sehr wenig über Psychosomatik gelernt – außer über Symptombilder, die zu kennen ihm aber bei der Behandlung nicht weiterhilft. Seine ärztlichen Erfahrungen haben ihn gelehrt und überzeugt, dass er sich für den Patienten Zeit nehmen muss, um sich klarzuwerden, in welcher Lebenslage der gerade feststeckt. Dann kann er vielleicht einen Zusammenhang zu dessen Beschwerden herstellen.
Auch wenn er dies tut, kann es sich der Hausarzt oft nicht leisten, auf weiterführende Fachdiagnostik zu verzichten, denn die meisten Patienten verlangen danach – zur Sicherheit und weil auch sie nicht in die psychosomatische Richtung denken wollen, denn dann müssten sie selbst etwas tun bzw. ändern. Sie lassen sich lieber behandeln – es ist also eine Frage der Zuständigkeit.
Viele Hausärzte fühlen sich allerdings nicht so recht zuständig, ihre Patienten zu beraten, weil sie zu Recht denken, das hätten sie nicht gelernt. Sie denken, sie müssten dafür Psychologie studiert haben – wissen aber nicht, dass Psychologen über diese Problemfelder auch nicht viel gelernt haben und in einer ähnlichen Situation sind wie sie selbst.
Um es noch einmal zu sagen: Für psychosomatische Beschwerden ist der davon betroffene Mensch selbst zuständig – es ist eine Frage seiner eigenen Lebensführung. Bis dahin, das heißt, bis jemand das verstanden hat und als eigene Aufgabe annehmen kann, ist manchmal ein weiter Weg. Und zwar deshalb, weil die Zuständigkeiten im Medizinsystem genauestens geregelt sind und weil es sich bei psychosomatischen Störungen vordergründig um ein medizinisches Problem zu handeln scheint.
Ist der Mensch erst im Medizinsystem gelandet, wo medizinische Behandlung nicht greift, wird dem Patienten gesagt: »Organisch ist alles in Ordnung bei Ihnen; das ist sicher psychisch – suchen Sie sich einen Psychotherapeuten.«
Das Umherirren im Gesundheitssystem kann Monate bis Jahre dauern, was an sich schon anstrengend und belastend ist. Und die Patienten sind währenddessen ihre Beschwerden nicht losgeworden – im Gegenteil. Soll man dafür jemandem einen Vorwurf machen? Ganz gewiss nicht. Denn man kann jedem einzelnen Fachdiagnostiker und Therapeuten, der sich während dieser Zeit um den Patienten bemüht hat, unterstellen, dass er sein Bestes getan hat.
Er hat getan, was er konnte.
Die einzelnen Professionen – die ärztlichen und die psychotherapeutischen übrigens auch – sind zunehmend spezialisiert, bestens und langwierig ausgebildet und wenden das an, was sie gelernt haben.
Mehr kann man nicht verlangen.
Wenn Fachärzte konsultiert werden, die keinen körperlichen Befund diagnostizieren, der die vorhandenen Symptome erklärt, dann kann es schon passieren, dass so ein Arzt sagt: »Sie dürften eigentlich überhaupt keine Schmerzen in Ihrem Bein haben – da ist nichts!«
Woraufhin der Patient denkt, man unterstelle ihm, dass er simuliere: »Ich bilde mir das doch nicht ein!?« Denn die Schmerzen hat er ja trotzdem weiterhin, und nun fühlt er sich auch noch allein gelassen.
Dass keine körperlichen Befunde erhoben werden können, gilt auch nicht immer. Bei vielen schweren und chronischen Schmerzzuständen zum Beispiel, die ursächlich nicht abgeklärt werden können, stellt man doch muskuläre Verspannungen fest, auch solche, die Nerven einklemmen, oder einen allgemein verspannten Körpertonus, der nicht variiert.
Das hat aber keinen Krankheitsstatus und läuft in der Diagnostik unter »funktionelle Beschwerden« – was seltsamerweise nicht ernst genug genommen wird. Man bekommt vielleicht Muskelrelaxantien verschrieben oder Betablocker, wenn es sich um eine funktionelle Rhythmusstörung handelt. Wenn die natürlichen Rhythmen eingeschränkt oder abgeflacht sind oder wenn sich kaum mehr etwas schwingend bewegt, bekommen die Patienten die Diagnose »Depressive Verstimmung« und erhalten Antidepressiva. Fast immer bekommen sie Psychopharmaka verschrieben, die sie meist nur kurzzeitig einnehmen – ohne es ihrem Arzt zu sagen –, weil die Nebenwirkungen die positiven Effekte überwiegen. Da nützt es auch nichts, wenn man ihnen sagt, dass sie Geduld haben müssen, bis sie eine Wirkung spüren – besonders bei den Antidepressiva. Die Patienten bringen die Geduld nicht auf. Sehr oft sind die betroffenen Patienten aber schon zufrieden, wenn sie hören, dass keine gravierende körperliche Krankheit hinter ihren Symptomen steckt.
Ich erinnere mich noch gut an mein Forschungsprojekt über Kopfschmerztherapie bei Kindern und Jugendlichen, in dem ein Teil der Kinder mit Migräne in die Neurologie geschickt wurde, wo eine intensive Analyse der Hirntätigkeit während der Migräne-Attacke und im Intervall untersucht wurde. Denn wie man weiß, unterscheiden sich manche Hirnfunktionen bei Menschen mit Migräne von denen, die keine Migräne haben. Das wollten sich die Forscher genauer ansehen.
Letztendlich wurde den Eltern mitgeteilt, dass ihr Kind Migräne habe, was sie vorher schon wussten, aber nun professionell bestätigt bekamen. Woraufhin die meisten von ihnen mit ihrem Kind nach Hause gingen, ohne eine weiterführende psychotherapeutische Beratung nachzufragen. Sie waren über Medikamente informiert worden. Aber obwohl sie wussten, dass sie ihrem Kind »eigentlich« kein Medikament geben wollten, waren sie doch so beruhigt darüber, dass das Kind keinen Hirntumor oder eine sonstige Erkrankung in seinem Kopf hatte – eben nur eine Migräne, und dabei geht nichts kaputt –, dass sie völlig übersahen, dass das Kind weiter unter schweren Kopfschmerzen leiden würde und das Problem in keiner Weise gelöst war.
So geht auch so mancher Patient von seinem Facharzt zusammen mit seiner Symptomatik wieder nach Hause, ist erst mal erleichtert, dass keine schwere Krankheit dahintersteckt, schluckt eine Weile die verordneten Medikamente, oft Psychopharmaka, und wirft sie bald weg, weil er sie nicht verträgt. Will sagen: wenig Wirkung – viel Nebenwirkung. Das ist typisch bei psychosomatischen Problemen.
Richtig schwierig kann es aber werden, wenn ein Arzt Überlegungen über eine mögliche schwere Erkrankung in den Raum stellt.
So erging es einem meiner noch sehr jungen Patienten, der sich für längere Zeit in einer anerkannten psychosomatischen Klinik aufhielt, wo man ihn durch und durch wegen starker und anhaltender Bauch- und Magenschmerzen untersuchte und behandelte und nichts fand und ein etwas ratloser junger Arzt in seinem Beisein mutmaßte, es könnte sich um Morbus Crohn handeln, was sich definitiv als Fehlalarm herausstellte. Dieser junge Mann entwickelte daraufhin zusätzlich Panikattacken, die nach und nach in eine Angststörung mündeten, einhergehend mit umherwandernden Weichteilschmerzen, was die Diagnose »Fibromyalgie« nach sich zog. Die Bauchschmerzen waren mittlerweile weg.
Ich hatte diesen jungen Mann erst etliche Monate später in meiner Praxis und fragte ihn nach den Gründen für seine massive Angst, und er sagte wörtlich: »Seit dieser Fehldiagnose damals von Morbus Crohn komme ich von dem Gedanken nicht los, dass ich doch noch Morbus Crohn bekomme – denn die Ärzte haben sich dabei doch was gedacht und irgendwas gesehen, was darauf hingedeutet hat.«
Man kann niemandem Vorwürfe machen. Alle haben ihre Profession gut gelernt und wenden sie an. Wenn die Kenntnisse aber auf die vorliegende psychosomatische Störung nicht passen, kann man nach allen Regeln der anerkannten Kunstfertigkeiten arbeiten, es wird wenig nützen.
Man muss sich nur mal die Leitlinien zur Behandlung von Fibromyalgie, unspezifischen Rückenschmerzen, Reizdarm, Magen-Darm-Irritationen und den vielen anderen psychosomatischen Symptomen, die sich der Körper so einfallen lässt, anschauen: Daran haben interdisziplinär viele ausgewiesene Experten oft jahrelang gearbeitet, und herausgekommen ist wenig Definitives, was die Ätiologie und Therapie betrifft. Denn die Symptome oder Syndrome werden aus der Perspektive der somatischen Medizin oder der psychologischen Forschung mit ihrer ausgefeilten Statistik betrachtet – und da ist für die Psychosomatik nicht allzu viel zu erkennen. Schon gar nicht für einen individuellen Patienten, der vor einem sitzt und sich Erklärung und Hilfe erhofft.
Die Patienten gehen also von einem Facharzt zum anderen und suchen nach einer Lösung.
Nach all der sukzessiven Fachdiagnostik werden sie, wenn sie Glück haben, in eine interdisziplinäre Konferenz geschickt. Dort sitzen sie zusammen mit allen für ihr Störungsbild in Frage kommenden Fachärzten, die sich untereinander und mit dem »schwierigen« Patienten fachkundig beraten. Solche interdisziplinären Konferenzen sind für komplizierte chronische Schmerzzustände erfunden worden – denn bei chronischen Schmerzen kommt eine einzelne Fachdisziplin allein nicht weiter –, und bei solchen Schmerzen ist es nicht leicht zu unterscheiden, ob es sich um ein körperliches, ein psychisches oder ein psychosomatisches Leiden handelt oder um alles gleichzeitig. Weil alles mit allem zusammenhängt, geht man bei komplexen Störungen von einem bio-psycho-sozialen Problem aus – und alle zuständigen Fachdisziplinen sollen zusammenarbeiten.
Das können sie aber nicht, weil ja jede durch ihr eigenes Rohr schaut und so nur ein buntes Puzzle zustande kommt, in dem der Patient von einem Puzzlestück ins nächste springt – und so hat er nach einiger Zeit viel Buntes über Diagnostik und Therapieversuche zu berichten. Solche Konferenzen sind, neben der aktuellen Problemdiskussion eines schwierigen Falls, dazu gedacht, in den einzelnen Köpfen interdisziplinäres, also fachübergreifendes Denken anzustoßen.
Aus meiner Sicht stellt es sich so dar: Nach 30 Jahren verpflichtender Teilnahme an solchen Schmerzkonferenzen – zehnmal pro Jahr immerhin – ist das nur ansatzweise gelungen. Es werden immer zuerst ärztliche Überlegungen zu weiterer Diagnostik, Medikation, Operationen oder andere somatische Therapien empfohlen – und wenn alles schon »ausgeschöpft« ist (ein schönes Wort!), fällt der Begriff »kognitive Verhaltenstherapie«, wie ein Mantra der letzten Rettung.
Ich erinnere mich an Raffaele, den »sein« Orthopäde in einer gut bestückten Schmerzkonferenz vorstellte – will sagen, es waren viele Experten da aus vielen verschiedenen Fachdisziplinen unter der Leitung eines alten, sehr versierten Neurologen und Psychiaters, der eine anerkannte Praxis für Schmerztherapie betrieb.
Der vorgestellte Patient Raffaele, 28 Jahre, Italiener aus Mailand, erzählte seine Geschichte in exzellentem Deutsch so: Er war mit seiner Freundin an die Heidelberger Universität gekommen, um bei einem bekannten Professor seine Doktorarbeit in Mathematik zu schreiben. Die Arbeit war schon weit gediehen und stand kurz vor ihrem Abschluss, als vor ein paar Wochen in seinem rechten Handgelenk so starke Schmerzen auftraten, dass er nicht mehr schreiben konnte – er war Rechtshänder. Er hatte das Handgelenk nicht überlastet, außer natürlich beim Computerschreiben, da kommen solche Schmerzen schon mal vor – allerdings war ihre Heftigkeit ominös. Die Schmerzen zogen sich nach und nach bis über die Beuge am Ellenbogen, sie waren stark und ziehend und bei der kleinsten Bewegung da – in völliger Ruhe nicht. Schmerzmittel hatten anfangs etwas geholfen, dann nicht mehr.
Ein definitiver Befund konnte nicht erhoben werden. Sehnenscheidenentzündung, Tennisellenbogen, Karpaltunnelsyndrom, Tendomyopathie mit geschädigten Kollagenfasern, auch RSI, standen im Raum. RSI war aus meiner Sicht noch am ehesten wahrscheinlich. Das heißt »repetitive strain injury« und bedeutet, dass kleine Läsionen in den Sehnenansätzen der Handgelenke entstehen, wenn man sehr lang und wiederholt die immer gleichen Bewegungen macht, unter hoher (konzentrativer) Anspannung – weshalb man das Problem auch »Mausarm« nennt, was bei Sekretärinnen öfter vorkommt.
Man sollte sich dann gleich mal fragen, wieso die Computer-Maus gerade zu diesem Zeitpunkt so gefährlich geworden ist, wo sie sich doch die ganzen Jahre zuvor zahm verhalten und der Hand, die sie bediente, gefügt hatte.
Von den ärztlichen Kollegen wurden einige Vorschläge zur weiteren Diagnostik und Medikation gemacht, Physiotherapie, Psychopharmaka, Reizstrom, Akupunktur, eine Karpaltunnel-OP wurde vorgeschlagen, später auch durchgeführt.