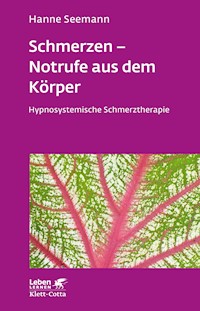
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Leben Lernen
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Wenn der Körper uns mit der Beharrlichkeit und Vehemenz eines chronischen Schmerzes eine Störung meldet, sollten wir hinhören! Mit dem hier vorgestellten hypnosystemischen Ansatz kann das Schmerzgeschehen tiefer verstanden und wirksamer behandelt werden. Wir wissen so viel wie nie zuvor über die neurobiologischen, medizinischen und psychotherapeutischen Aspekte des chronischen Schmerzes. Doch haben wir auch verstanden, was er uns sagen will? Hanne Seemann beschäftigt sich seit drei Jahrzehnten in Forschung, Therapie und Lehre mit psychosomatischen Schmerzen bei Kindern und Erwachsenen und sie kommt in diesem umfassenden Buch, das die kritische Auseinandersetzung mit dem Mainstream der Schmerztherapie nicht scheut, zu dem Schluss: Chronischer Schmerz ist nur systemisch zu verstehen und kommuniziert eine Störung in Lebensweise und -umfeld eines Patienten, die individuell aufgespürt werden muss. Die hypnosystemische Herangehensweise liefert hierzu die passenden Konzepte, um funktionellen Kopf- und Rückenschmerzen sowie der Fibromyalgie wirksam zu begegnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 365
Ähnliche
Hanne Seemann
Schmerzen – Notrufe aus dem Körper
Hypnosystemische Schmerztherapie
Klett-Cotta
Zu diesem Buch
Wir wissen so viel wie nie zuvor über die neurobiologischen, medizinischen und psychotherapeutischen Aspekte des chronischen Schmerzes. Doch haben wir auch verstanden, was er uns sagen will? Hanne Seemann beschäftigt sich seit drei Jahrzehnten in Forschung, Therapie und Lehre mit psychosomatischen Schmerzen bei Kindern und Erwachsenen, und sie kommt in diesem umfassenden Buch, das die kritische Auseinandersetzung mit dem Mainstream der Schmerztherapie nicht scheut, zu dem Schluss: Chronischer Schmerz ist nur systemisch zu verstehen und kommuniziert eine Störung in Lebensweise und -umfeld eines Patienten, die individuell aufgespürt werden muss. Die hypnosystemische Herangehensweise liefert hierzu die passenden Konzepte, um funktionellen Kopf- und Rückenschmerzen sowie der Fibromyalgie wirksam zu begegnen.
Die Reihe »Leben Lernen« stellt auf wissenschaftlicher Grundlage Ansätze und Erfahrungen moderner Psychotherapien und Beratungsformen vor; sie wendet sich an die Fachleute aus den helfenden Berufen, an psychologisch Interessierte und an alle nach Lösung ihrer Probleme Suchenden.
Alle Bücher aus der Reihe ›Leben Lernen‹ finden Sie unter:
www.klett-cotta.de/lebenlernen
Impressum
Leben Lernen 302
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2018 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Jutta Herden, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von © Adobe Stock/srckomkrit
Datenkonvertierung: Eberl & Koesel Studio, Altusried-Krugzell
Printausgabe: ISBN 978-3-608-89225-3
E-Book: ISBN 978-3-608-11083-8
PDF-E-Book: ISBN 978-3-608-20389-9
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Teil I
Grundlagen
Kapitel 1
Schmerz – was ist das?
1.1 Definitionen
1.2 Funktionen: Wozu ist er da?
Der Schmerz – bellender Wachhund der Gesundheit
Menschen mit angeborener Schmerzunempfindlichkeit
Schmerz als Schutzreflex
Auch chronische Schmerzen haben eine Schutzfunktion
Schmerz als Antrieb und Forderung
Drei Phasen des Übels
Iatrogene Chronifizierung durch das Gesundheitssystem – die Störung der dritten Phase
1.3 Neurobiologie: Unter welchen Bedingungen sendet der Organismus Schmerzsignale an sein Bewusstsein?
Die Beziehung zwischen Soma und Psyche, Leib und Seele, Körper und Geist
1.4 Schmerz als körpernahe Emotion
1.5 Das willkürliche und das unwillkürliche Bewusstsein
Die Kontrollprämisse bei chronischen Schmerzstörungen
1.6 Kleiner Exkurs in die Theorie lebender Systeme
1.7 Kategorienfehler vermeiden!
Kapitel 2
Klassifikation und Epidemiologie
2.1 Klassifikation, Nomenklatur
2.2 Epidemiologie – Häufigkeiten
Kapitel 3
Schmerz-Psychotherapie
3.1 Historische Entwicklung der Schmerz-Psychotherapie bis heute
3.2 Schmerz-Psychotherapie heute – Die drei vorherrschenden Therapieansätze und ihre Unterschiede
3.2.1 Psychodynamisches Schmerzverständnis und -therapie
3.2.2 Verhaltenstherapeutisches Schmerzverständnis und -therapie
3.2.3 Hypnosystemisches Schmerzverständnis und -therapie
3.2.4 Vergleich zwischen den Grundannahmen der Verhaltenstherapie und der Hypnotherapie
Akuter psychosomatischer Schmerz aus hypnosystemischer Sicht
Chronifizierende und chronische psychosomatische Schmerzen
Fazit: Chronischer Schmerz ist eine Kommunikationsstörung auf vielen Funktionsebenen
Teil II
Hypnosystemische Schmerztherapie in der Praxis
Kapitel 1
Erstgespräch und Beratung
1.1 Gesprächseinstieg
1.2 Schmerzanamnese
Vom Hören
1.3 Lösungsanalyse
1.4 Der Körper als therapeutisches Tertium und die Auflösung des hierarchischen Paradoxons
1.5 Reframing – eine neue Ordnung finden
1.6 Mein Körper und ich – Wie leben wir zusammen?
Mit dem Körper verhandeln – Fokussierung
1.7 Therapeutisches Grundprinzip: Die Ungehorsamkeits-Regel
Kapitel 2
Weitere therapeutische Wege: Auf Imbalancen und Einseitigkeiten achten!
2.1 Zu viel Großhirn-Denken und zu wenig Körper-Fühlen
2.2 Mehr desselben – weniger desselben
2.3 Alexithymie: Unter-Repräsentanz der Innenwelt im Vergleich zur Außenwelt
2.4 Wo die Seele wohnt
2.5 Kontrolle versus Vertrauen
2.6 Der Lebensbogen
Kapitel 3
Therapeutische Wirkfaktoren
3.1 Hypnosystemische Therapeut-Patient-Beziehung
3.1.1 Therapeutische Beziehungsbildung
Non-verbale Kommunikation
3.1.2 Die eigene Haltung zum Schmerz
Der Helfer-Impuls
3.1.3 Mentale Vorbereitung der therapeutischen Begegnung
3.2 Die Beziehung des Patienten zu sich selbst
3.2.1 Der Placebo-Effekt
3.3 Die Macht der inneren Bilder
3.4 Wirkmächtige Chemie: Endogene Schmerzmittel
Fazit
Teil III
Spezielle Schmerzsyndrome
Kapitel 1
Das Konzept der Rhythmusstörung: Gesundheit und Störung als harmonische und dysharmonische Schwingung
Kapitel 2
Funktionelle Über- und Untersteuerung
2.1 Migräne
Pathophysiologie der Migräne
Klinisches Bild und Klassifikation
Prävalenzen – Häufigkeiten
Anamnese und Diagnostik
Migräne als Ordnungsstörung
Entspannungs- und Wochenend-Migräne
Multimodale Therapiekonzepte
Fazit: Migräne
Kopfschmerz-Prävention bei Kindern
Familienberatung
Kapitel 3
Funktionelle Erstarrung und Blockaden als Rhythmusstörungen
3.1 Muskuläres Festhalte-Syndrom: Spannungskopfschmerzen
Erscheinungsbild
Prävalenzen
Pathogenese
Therapie
3.2 Funktionelle Erstarrung: Das Fibromyalgie-Syndrom (FMS)
Erscheinungsbild
Prävalenzen
Pathophysiologie
Therapie
Gesprächsführung
3.3 Funktionelle Blockaden: Rückenschmerzen
Prävalenzen
Pathogenese
Psychosoziale Pathogenese
Anamnesegespräch
Therapie
Kapitel 4
Schmerzen und Trauma: Immer wieder zurück in die Vergangenheit
Gesprächsführung
Die stellvertretende Entschuldigung
Kapitel 5
Schlussgedanken: Wenn Schmerzen das Voranschreiten unseres Lebens in eine gute Zukunft blockieren
Literatur
Für meine Patienten – in all den Jahren
Vorwort
Seit nunmehr 30 Jahren beschäftigen mich die Schmerzen – aus Sicht der Forschung und der Therapie. Und immer noch ist mir manches an diesem – doch jedem Menschen vertrauten – Phänomen rätselhaft geblieben und deshalb nach wie vor interessant. 1986 begeisterte mich ein Vortrag des Neurophysiologen Manfred Zimmermann wegen seiner geistigen und sprachlichen Klarheit – den ich verstehen konnte.
Daraufhin beschloss ich, bei ihm zu arbeiten, und ich habe sehr viel von ihm gelernt. Da er mich als Psychologin nicht anstellen und bezahlen konnte, hat er mir beigebracht, wie man Forschungsanträge schreibt, und so wurde ich viele Jahre, sukzessive und immer wieder, vom BMFT, BMBF und der Universität Heidelberg mit Forschungsstellen versorgt. Das war eine anstrengende und lehrreiche Zeit – ich kann das allen jungen Wissenschaftlern nur empfehlen. Prof. Zimmermann war nämlich einer der Ersten in Deutschland, der wusste, dass die Schmerzforschung und -behandlung nicht ohne Psychologen auskommt. Auch dafür sei ihm gedankt.
Die Forschungsthemen reichten von Untersuchungen über die Versorgungslage von Schmerzpatienten in Deutschland (Zimmermann & Seemann 1986), über Krebsschmerzen, inklusive Schmerzmessung, bis zu den Kopfschmerzen bei Kindern. Das war ein weiter Weg, auf dem ich denn auch in das Institut für Psychotherapie und Medizinische Psychologie wechselte, um zu lernen, mit konkreten Patienten therapeutisch zu arbeiten. Herrmann Lang, dem damaligen Leiter des Instituts, bin ich heute noch dankbar für sein Vertrauen und die große Freiheit, die er, ein echter Heidelberger Psychoanalytiker, mir entgegengebracht hat. Er sagte damals: »Der wichtigste therapeutische Rat, den ich Ihnen gebe: Fallen Sie nicht vom Stuhl, bleiben Sie aufrecht sitzen, halten Sie stand!«
Das habe ich fortan mit Gewinn beherzigt: Mut braucht der Therapeut. Besonders, wenn es um Schmerzpatienten geht. Und auch der Patient mit chronischen Schmerzen, die organphysiologisch nicht erklärbar sind, braucht Mut, um seinen eigenen Weg zu finden.
In dieser Zeit bin ich zufällig in ein Seminar von Gunther Schmidt geraten, der schon damals ein großartiger systemischer Hypnotherapeut war, und habe gemerkt, dass dieser Ansatz genau der richtige für Schmerzen und für die gesamte Palette psychosomatischer Störungen ist.
Aus der Zeit des Kinder-Kopfschmerz-Projektes sind mir besonders Gideon Franck und Jutta Schultis verbunden geblieben, denen ich dafür herzlich danke. Und auf dem weiteren Weg haben mich Eva Neubauer und Carola Rudolf mit Rat und Tat begleitet. Sie haben mich immer wieder mit den neuesten Nachrichten aus Forschung und Therapie unterstützt, ohne die ich dieses Buch nicht hätte schreiben können.
Hans Lieb, selbst Autor fabelhafter Bücher, hat mir zugetraut, dieses Buch zu verfassen, noch bevor ich es mir selbst zugetraut hätte. Und last but not least danke ich Paul Nilges, der von Schmerzforschung so viel versteht wie kaum ein anderer und der mir mit seinem brillanten Kopf beim Denken geholfen hat – obwohl er nicht in allem meiner Meinung ist.
Am meisten bin ich Dr. Christine Treml dankbar und seit langen Jahren in professioneller Freundschaft verbunden, die dieses querdenkende Schmerzbuch begleitet, lektoriert und herausgebracht hat – ohne sie hätte ich kein einziges Buch je geschrieben!
Den Ausschlag dafür, dass ich mich noch einmal darangemacht habe, über das alte Thema Schmerz zu schreiben, war die seltsame Beurteilung, die so gut wie alle Besprechungen und Rezensionen meiner Schriften zum Schmerz bis heute begleitet – schon seit 1998 mein erstes Buch zum Thema – Freundschaft mit dem eigenen Körper schließen. Über den Umgang mit psychosomatischen Schmerzen – erschienen ist. Auch in dem neuen Schmerz-Heft der Zeitschrift Psychotherapie im Dialog, PiD, von 2016 (S. 103 und 105) heißt es: Hanne Seemann vertritt einen anderen Ansatz.
Außer, dass alle immer wieder meinen Ansatz als freundlich und liebevoll bezeichnen, ist aber nirgendwo zu finden, wie anders denn dieser Ansatz sei.
Um es gleich zu sagen: Er ist paradigmatisch anders.
Um das zu zeigen, habe ich nun ausführlich aufgeschrieben, wie sich die systemische und hypnotherapeutische Schmerztherapie von anderen Ansätzen unterscheidet. Gleichzeitig plädiere ich dafür, diesen Ansatz zu verwenden: Er sorgt dafür, dass Patienten und Therapeuten bei guter Laune bleiben, dass auch der Körper des Patienten zuhört und der Schmerz merkt, dass er aufhören kann, so laut zu schreien.
In diesem Sinne: Viel Vergnügen!
St. Leon im Frühjahr 2018
Hanne Seemann
Einleitung
Den Schmerz aus hypnosystemischer Perspektive zu betrachten ist ebenso naheliegend wie therapeutisch fruchtbar.
Historisch gesehen galt der Schmerz bis vor Kurzem, d. h. bis vor etwa 50 Jahren, als eine Domäne der Medizin, und seine Diagnose und Therapie waren Teil der ärztlichen Versorgung. Machen sich doch die meisten Krankheiten, die zum Arzt gebracht werden, durch Schmerzen bemerkbar. Erst in der jüngsten Zeit wurde mit der allgemeinen Anerkennung des biopsychosozialen Schmerzmodells die Perspektive erweitert und die psychologische Schmerz-Forschung und -Therapie in die Schmerzbehandlung einbezogen. Ja, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass sich heute ohne Berücksichtigung psychosozialer Faktoren kein ärztlicher Behandler an Schmerzen, besonders an chronische Schmerzen, heranwagt. Wenn er einen psychologischen Schmerztherapeuten kennt, wird er gern an ihn überweisen.
Dieser Entwicklung wird durch interdisziplinäre Anamnese und Diagnostik in den mittlerweile obligatorischen Schmerzkonferenzen – für schwierige Fälle auch unter Anwesenheit und aktiver Teilnahme des Patienten – und anschließende multimodale Therapie Rechnung getragen.
All diese notwendigen und rasanten Entwicklungen, die das Denken über den Schmerz verändert und zweifellos vorangebracht haben – bio-psycho-sozial, interdisziplinär, multimodal –, sind jedoch weiterhin dem herkömmlichen medizinischen Forschungsparadigma verhaftet geblieben, dem sich die wissenschaftliche Psychologie methodisch angeschlossen hat. Dem liegt das lineare Denken der Naturwissenschaften zugrunde, woraus folgt, dass die Vielfalt und Breite der diagnostischen und therapeutischen Ansätze und der interdisziplinären Zusammenarbeit so etwas wie ein kompliziertes Puzzle aus vielen Faktoren ergibt, an dem sich die Behandler und auch der Patient selbst abarbeiten müssen.
Schmerzen, denen ein Organbefund zugrunde liegt oder auch eine sicht-, tast- oder sogar messbare Funktionsstörung, können sehr oft zielsicher diagnostiziert und behandelt werden. Für solche Schmerzen können Leitlinien erstellt werden, da sich im menschlichen Organismus die Zell-, Nerven- und Organfunktionen innerhalb bestimmbarer Normwerte ähneln und man Abweichungen vom Normalen feststellen und reparieren kann. So etwas versucht man auch in der psychologischen Schmerztherapie – nicht mit dem Schmerz selbst, sondern mit seinen Begleitstörungen, also den psychischen und sozialen Beeinträchtigungen, die durch die Schmerzen hervorgerufen werden und ihn ihrerseits beeinflussen und möglicherweise aufrechterhalten. Dafür gibt es Tests und Fragebögen mit Normwerten – was Fragen über psychosoziale Normalität aufwirft.
Der Schmerz selbst und alles, was ihn unbewusst steuert, kann jedoch nicht mit den gleichen Methoden beforscht und behandelt werden, denn er ist qualitativ davon verschieden. Er ist nicht sichtbar, nicht messbar, diagnostisch nur schwer fassbar – wer Schmerzen hat, kann darauf deuten und den Körper-Ort nennen, wo er ihn spürt, und sagen, wie sehr es wehtut. Schmerz ist ein inneres, subjektives Geschehen, und wenn man ihn behandeln will, muss man den ganzen komplexen Menschen mit seiner Geschichte und seinem Lebenskontext in den Blick nehmen. Dies gilt besonders für solche Patienten, deren Schmerzen ohne erklärungskräftige Organbefunde daherkommen und beharrlich bleiben, also chronisch werden.
Die medizinische und psychologische Forschung hat sich – außer an ihren Rändern – bisher nicht dazu bereitfinden können, sich eine, ihrem Gegenstand – dem Menschen – angemessene wissenschaftstheoretische Grundlage zu geben, wie sie z. B. für die Psychologie schon von Groeben & Scheele 1977 und von von Uexküll & Wesiak (1988) oder von Weiner (1991) für die Medizin in den Neunzigerjahren des letzten Jahrhunderts ausformuliert worden ist.
So blieb auch der Schmerz dem analysierenden und fragmentierenden Denken unserer Epoche verhaftet und konnte in seiner Komplexität nicht ausreichend gut verstanden werden. Die Komplexität lebender Systeme kann eben nicht auf Mehr- oder Viel-Dimensionalität reduziert werden, auch dann nicht, wenn Wechselwirkungen beachtet werden. Anders gesagt, die derzeitigen Wissenschaftsstrukturen sind nicht geeignet für die Erforschung eines so komplexen Funktionssystems, wie es der Schmerz, insbesondere aber der chronische Schmerz, darstellt – wie ich im Abschnitt über Kategorienfehler zeigen will. (Zur Unterscheidung komplizierter und komplexer Systeme siehe Strunk & Schiepek 2014.)
Aufgrund der expandierenden und aus der Sicht des vorherrschenden Paradigmas ergiebigen Forschungstätigkeit zum Schmerz in den Neurowissenschaften, der Biochemie, der angewandten Medizin, der Psychodiagnostik und -therapie können wir heute zwar sagen:
Wir wissen viel über den Schmerz, es gibt eine Flut an Literatur über ihn, aber: Verstehen wir ihn?
Verstehen wir den Schmerz so gut, dass wir einem einzelnen Menschen, der Schmerzen hat, effektiv raten und helfen können?
In diesem Buch soll versucht werden, auf der Grundlage der Theorie lebender Systeme und neuerer Erkenntnisse über das Zusammenspiel von Körper und Psyche ein Schmerzkonzept zu entfalten, aus dem sich die Therapie – in diesem Fall die Psychotherapie psychosomatischer Schmerzen in Form der modernen Hypnotherapie – logisch ableiten lässt bzw. natürlicherweise ergibt. Eine solche gegenstandsangemessene Theorie sagt nicht, was therapeutisch getan werden soll oder gar muss. Sie eröffnet vielmehr einen Raum für eine Fülle von Möglichkeiten, der an den Rändern begrenzt wird durch das, was innerhalb dieses theoretischen Rahmens verboten ist.
Die Hypnotherapie und die ihr verwandtschaftlich verbundene Systemtherapie – worunter manche Leute, auch Therapeuten, ausschließlich die Familientherapie verstehen, was allerdings eine zu enge Sicht wäre – bilden dabei die Grundlage. Andere Denkansätze und therapeutische Techniken, die sich in der psychologischen Schmerzbehandlung etabliert haben, sollen daraufhin befragt werden, ob und in welcher Form sie sich mit hypnosystemischer Therapie vertragen und in sie integrieren lassen.
Im ersten Teil des Buches wird der Schmerz im Allgemeinen theoretisch und therapeutisch erörtert. Hier wird auch die historische Entwicklung der mit der Schmerztherapie befassten Therapieschulen vorgestellt und auf ihre Unterschiede eingegangen. Der zweite Teil widmet sich der hypnotherapeutischen Praxis in der Schmerzbehandlung. Im dritten Teil werden, unter der übergeordneten Perspektive der Rhythmus-Störung, einige häufig vorkommende Schmerzsyndrome, Migräne, Spannungskopfschmerzen, Rückenschmerzen, Fibromyalgie, Schmerzen und Trauma, besprochen. Kopf- und Bauchschmerzen im Kindesalter werden unter der Perspektive schmerzpräventiver Maßnahmen verhandelt.
Teil I
Grundlagen
Kapitel 1
Schmerz – was ist das?
1.1 Definitionen
Was etwas ist, erfährt man aus seiner Definition:
»Schmerz ist ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis, das mit aktueller oder potenzieller Gewebeschädigung verknüpft ist oder mit Begriffen einer solchen Schädigung beschrieben wird.«
(Pain is an unpleasant sensory and emotional experience with actual or potential tissue damage or described in terms of such damage.)
In der seit 1979 bis 2016 unveränderten Definition der IASP, der International Association for the Study of Pain (IASP Subcomittee on Taxonomy 1979), wird dem Sachverhalt Rechnung getragen, dass jeglicher Schmerz, von dem hier die Rede ist und der als Körperschmerz empfunden und als solcher beschrieben wird, auch ohne körperliche Beschädigung auftreten kann. Auch eine lediglich potentielle körperliche Schädigung kann als Schmerz erfahren werden. Die Potentialität des Schmerzes muss allerdings erwartet bzw. imaginativ vorgestellt werden – also in der Psyche präsent sein.
Diese wissenschaftliche Definition kann für den akuten Schmerz akzeptiert werden, obwohl sie, wie Wörz (2004) treffend bemerkt, außer Acht lässt, dass der Schmerz nicht »ruhige Empfindung oder atmosphärisches Gefühl ist, sondern eine Kraft« ist, und zwar eine treibende Kraft, wie man hinzufügen möchte.
Er muss jedoch, um als »Schmerz« anerkannt zu sein, vom betroffenen Menschen wahrgenommen und beschrieben, also mitgeteilt werden. Denn Schmerz ist eine private und subjektive Erfahrung, die nicht direkt, also objektiv von außen beobachtet und gemessen werden kann – das gilt für den klinischen Schmerz. Was als klinische Schmerzmessung bezeichnet wird, sind indirekte Verfahren, die über die Wahrnehmung des Patienten laufen und in Skalen übertragen werden, welche wiederum der Außenbeobachter interpretieren muss.
Also muss der Patient, der unter einem Schmerz leidet und therapeutische Hilfe wünscht, Auskunft geben.
Leidet er nicht darunter, ist sein Schmerz lediglich unangenehm oder aus subjektiven, z. B. sexuellen oder religiösen, Gründen erwünscht, vielleicht sogar lustvoll, kann der Schmerz im Privaten bleiben und ist nicht auskunftspflichtig. Das gilt auch dann, wenn der Betroffene mit seinem Schmerz allein bleibt und ihn vor der Außenwelt verbirgt. Wenn der oder die Leidende therapeutische Hilfe anfragt, treten die Ärzte und/oder Psychotherapeuten auf den Plan.
Die Definition der IASP hebt, wie Kröner-Herwig (2011) richtig anmerkt, »den emotionalen Aspekt als konstitutive Komponente des Schmerzgeschehens heraus und unterscheidet damit Schmerz von anderen sensorischen Wahrnehmungsprozessen, die nicht notwendigerweise eine affektive Reaktionskomponente beinhalten. Schmerz ist damit mehr als reine Reizwahrnehmung« (S. 4). Allerdings würden Schmerzpatienten die Kennzeichnung ihrer Schmerzen als »unpleasant«, als üblen Euphemismus bezeichnen, was in der neuen Schmerzdefinition 2016 dann auch explizit berichtigt wurde (s. u.).
Aber schon in dieser frühen Definition wurde die kausale Verknüpfung von Gewebeschädigung und Schmerzreaktion aufgegeben.
Zumal wir heute mittels bildgebender Verfahren wissen, dass, neurophysiologisch gesehen, »psychische« Phänomene wie seelischer Schmerz oder das »Mitfühlen« von Schmerzen anderer Menschen (Empathie) in sehr ähnlichen (den gleichen, wie die Autorin anmerkt) Hirnregionen stattfinden, wie die Verarbeitung des selbst erlebten Schmerzes, wobei dies besonders die affektive Verarbeitung betrifft (Singer et al. 2004). Gleiches gilt für Einsamkeit – in der Schmerzpsychotherapie meist als Depression diagnostiziert – die, wie Manfred Spitzer (2018) betont, sich als Schmerz bemerkbar macht und mit Schmerzmitteln »bekämpft« wird. In der psychologischen Schmerzdiagnostik und -psychotherapie werden schmerzassoziierte Emotionen wie Angst und Depression berücksichtigt, allerdings steht die verhaltensbezogene Komponente von Schmerzen im Fokus des therapeutischen Interesses. Also: Was tut der Mensch, wenn er Schmerzen, Angst oder Depressionen hat, was an seinem Tun ist funktional und was dysfunktional? Vor allem: Was kann er wegen seiner Schmerzen nicht tun, wo ist er eingeschränkt? Dies ist beobachtbar und auch deshalb wichtig, weil der Schmerz selbst nicht beobachtbar ist, außer vom betroffenen Menschen. Alle Versuche, vom Ausdrucksverhalten, sei es der Mimik oder dem körperlichen Schonverhalten, auf Schmerzen zu schließen, sind höchst unzuverlässig.
Meine Mutter musste sich einmal einer Operation unterziehen. Danach lag sie in ihrem Krankenhausbett, und die Tränen liefen ihr übers Gesicht. Das sah die Schwester, verschwand und kehrte mit einer Tablette zurück, die sie meiner Mutter gab, zusammen mit einem Schluck Wasser. Dann erst fragte meine Mutter: »Was war das jetzt für ein Medikament?« Die Schwester: »Etwas gegen Schmerzen.« Meine Mutter: »Ich hab doch gar keine Schmerzen.« Die Schwester: »Ja, warum weinen Sie dann?« Meine Mutter: »Ich bin so froh, dass ich nach der OP wieder aufgewacht bin!«
Man muss also immer nachfragen, und wenn der Patient nicht antworten kann, z. B. bei sehr kleinen Kindern, tappt man im Dunkeln. Man ist allerdings auch nicht berechtigt, aus dem Ausdrucksverhalten auf Schmerzfreiheit zu schließen, ein Irrtum, der noch bis vor Kurzem dafür verantwortlich war, dass Kinder schmerzhafte Prozeduren ohne Analgetikum bzw. Anaesthetikum erleiden mussten. Kleine Kinder ziehen sich in Notsituationen oft völlig in sich zurück, was dem archaischen Notfallreflex »Totstellen« entspricht. Sie tun dies auch in anhaltenden Mangelkontexten, was der erlernten Hilflosigkeit nach Seligman gleichkommt und zum Tod durch Erlöschen führen kann, was schon René Spitz 1945 in gut ausgestatteten amerikanischen Kinderheimen beobachtet hatte. Also keine Spur von »braves Kind!«, wie es von außen erscheinen mag.
Die neue, überarbeitete Schmerz-Definition der IASP von 2016, die sich explizit auf das biopsychosoziale Schmerzmodell bezieht, lautet nun:
Pain is a distressing experience associated with actual or potential tissue damage with sensory, emotional, cognitive and social components (Williams & Craig 2016).
Die Autoren weisen in ihrem Kommentar darauf hin, dass die Kennzeichnung von Schmerz als unpleasant – also unangenehm – nun durch den Begriff distress ersetzt wurde, womit seine negative emotionale Valenz stärker konnotiert werden sollte. Die Schmerzerfahrung setzt sich auch in dieser neuen Definition aus Komponenten zusammen, die ungewichtet nebeneinander stehen, was dem derzeitigen wissenschaftlichen Schmerzverständnis entspricht.
Was die Definition der IASP nicht berücksichtigt, sind chronische Schmerzen und der Übergang vom akuten zum chronischen Schmerz, also der Prozess der Chronifizierung.
Von chronischem Schmerz spricht man, wenn er »persists past the normal time of healing« (Bonica 1953). Was eine normale Heilungszeit sein soll, ist, bezogen auf den Einzelfall, nicht darstellbar. Zumal man bei einem Schmerz, dem keine Verletzung oder Erkrankung zugrunde liegt, gar nicht weiß, wie man den Begriff der normalen Heilungszeit verstehen könnte.
Man benutzt deshalb ein einfaches zeitliches Kriterium, meist drei Monate und für wissenschaftliche Studien 6 Monate, was problematisch ist, wie ich weiter unten mithilfe von Patrick Wall (1982) diskutieren will. Das Mainzer Stadienmodell der Schmerz-Chronifizierung (Gerbershagen 1996) unterscheidet mehrere Stufen der Chronifizierung, in dem erschwerende Merkmale hinzutreten: Beeinträchtigungen im Lebensvollzug, insbesondere bei der Arbeit und Freizeit, sozialer Rückzug und psychische Beeinträchtigungen, besonders Resignation, Hilflosigkeit, Depressivität. Je weiter die Chronifizierung fortgeschritten ist, umso weiter hat sich der Schmerz von seinen ursprünglichen Auslösern entfernt, und umso weniger erfolgreich wird Schmerztherapie eingeschätzt. In der englischsprachigen Literatur sprach man lange Zeit von »intractable pain« d. h. von unbehandelbaren Schmerzen. Der Patient hat dann eine »Schmerzkrankheit« und ist ein Schmerzpatient.
Schauen wir uns den Schmerz einmal aus einer systemischen Perspektive an, so fragen wir nicht: Was ist das? Und in der Folge davon: Woraus setzt er sich zusammen?
Das interessiert uns eigentlich nicht, weil jeder, der Schmerzen hat, weiß, was das ist und was mit ihm zusammenhängt.
Aus systemischer Perspektive fragen wir nach seiner Funktion:
1.2 Funktionen: Wozu ist er da?
Zunächst einmal ganz allgemein: Welche Funktion hat der Schmerz für den Menschen? Wenn er für uns nicht nützlich wäre, hätten wir ihn in der Evolution schon längst hinter uns gelassen.
Der Schmerz – bellender Wachhund der Gesundheit
Wie bei Christof Müller-Busch (2011) nachgelesen werden kann, wurde der Schmerz schon in der Ilias als »der bellende Wachhund der Gesundheit« bezeichnet. Und diese Funktion hat er bis heute behalten: Er bellt und beißt, wenn die Gesundheit gefährdet ist. Das ist relevant für den betroffenen Menschen und das Gesundheitssystem, wohingegen andere Funktionen des Schmerzes, wie z. B. »Strafe Gottes« oder »Fluch«, meist nicht explizit an Ärzte herangetragen werden, auch wenn sie im Untergrund – oft unbewusst – weiterwirken und von dort aus möglicherweise therapeutische Versuche boykottieren mögen.
Der Schmerz ist eine Angelegenheit zwischen der Psyche und ihrem Körper, er ist also immer psycho-somatisch, weshalb der hier gemeinte Schmerz zu Recht nicht als psychische Störung gilt, außer bei seelischen Schmerzen wie Trauer oder Liebeskummer, wovon hier aber auch nicht zu reden sein wird.
Der vom Schmerz Betroffene erlebt und verortet nämlich den Schmerz im Körper, von dem aus ein Notsignal oder, bei chronischen Schmerzen, wiederkehrende oder andauernde Botschaften an die Psyche geschickt werden, die diese, weil sie wehtun und bedrängend sind, nicht ignorieren kann. Das ist nicht immer so, aber willkommene Schmerzen, z. B. bei sado- und masochistischen oder anderen sexuellen Praktiken, werden nicht zum Therapeuten gebracht, können also hier ebenfalls unterschlagen werden. Dennoch ist bemerkenswert, wie eng die beiden Phänomene Schmerz und Lust verbunden und aufeinander bezogen sind und wie sie ein basales und geradezu existentielles Wertebewusstsein begründen (hierzu Pöppel 1995).
Auch Patrick Wall (1982), einer der kundigen Pioniere in der neueren Schmerzforschung, nennt den Schmerz einen bellenden Wachhund der Gesundheit und fügt hinzu: »Der Schmerz kommt, wenn er gebraucht wird, und er bleibt weg, wenn es nicht passt.« Was schon darauf hinweist, dass es sich da um ein Funktionssystem handeln muss, das in der Lage ist zu entscheiden, wann ein Schmerz ins Bewusstsein zu treten hat und wann nicht.
Zum Beispiel passt der Schmerz überhaupt nicht, d. h., sein Vorhandensein wäre für den Organismus dysfunktional, wenn jemand ein schweres Trauma erlebt und sich in Sicherheit bringen bzw. Hilfe suchen muss. Nach einem schweren Unfall mit »eigentlich« schmerzhaften Verletzungen kommt es vor, dass der Schmerz erst eine halbe Stunde später, manchmal auch erst nach 24 Stunden, einsetzt – und dies nicht aufgrund einer bewussten Entscheidung des Unfallopfers, das oft gar nicht entscheidungsfähig ist, sondern jenseits des Bewusstseins. Der Organismus darf also, auch was den Schmerz betrifft, mit Fug und Recht für ein hochintelligentes, entscheidungsfähiges Funktionssystem gehalten werden.
Im Fall eines Traumas schützt sich der Organismus selbst, indem er den Schmerz nicht bzw. erst verzögert zur Psyche vordringen lässt. Auch bei psychischen Traumata setzen ad hoc Schutzmechanismen ein, die oft sehr lang bestehen bleiben, bis der Mensch stabil genug ist, das Geschehene zur Kenntnis zu nehmen.
Käme der körperliche Schmerz gar nicht ins Bewusstsein, so würde der Mensch möglicherweise denken, es wäre alles in Ordnung, und würde seine gebrochene Wirbelsäule nicht beachten, mit fatalen Folgen.
Menschen mit angeborener Schmerzunempfindlichkeit
Solches geschieht den wenigen Menschen, die eine kongenitale, sprich angeborene, Indolenz haben, also überhaupt keine Schmerzen wahrnehmen können. Sie müssen auf anderen kommunikativen Wegen lernen – also von anderen Menschen gesagt bekommen –, was für ihren Organismus gefährlich werden kann. Das funktioniert nur unzureichend, weshalb diese Menschen meist nicht alt werden, weil sie dauernd gefährdet sind, an den Folgen ihrer Verletzungen zu sterben. Auch wenn sie gelernt haben, sich vor offensichtlichen äußeren Schädigungen zu schützen, so wirken vor allem die inneren (Folge-)Störungen mit der Zeit letal. Denn es handelt sich hier um eine Wahrnehmungsstörung, die die Kommunikation zwischen Organismus und Psyche in diesem einen Punkt aussetzt.
Harro Albrecht (2015, S. 45 f.) hat in seinem Buch »Schmerz – eine Befreiungsgeschichte«, das ich sehr zu lesen empfehle, wenn Sie dieses hier ausgelesen haben, von den Kindern im Soroka Medical Center in Israel am Rande der Wüste erzählt, die gehäuft an einem genetischen Defekt leiden, der eine völlige Schmerzunempfindlichkeit zur Folge hat. Normalerweise leiten schnelle A-Delta-Nervenfasern bei einer Verletzung den ersten scharfen Schmerz über das Rückenmark an das Gehirn weiter, danach sorgen die langsameren C-Fasern für den dumpfen Schmerz, der später einsetzt. Solche Nervenfasern wachsen nicht in diesen Embryonen. Sie haben kein eingebautes Schutzsystem. Diese Kinder gehen mit sich selbst so rücksichtslos um, dass ihnen prophylaktisch alle Zähne gezogen werden, damit sie sich nicht dauernd Bisswunden zufügen; Arme und Beine sterben ab und müssen amputiert werden; sie sitzen in Rollstühlen und können offenbar ihre sichtbaren Verletzungen nicht einschätzen, auch nicht lernen, sie zu vermeiden, weil sie sie nicht spüren.
Jedoch: Sie zeigen empathisches Mitgefühl beim Anblick des Leidens eines wichtigen Gegenübers und beginnen, sich z. B. vor Spritzen zu fürchten, wenn sie sehen, wie ein anderes Kind schreit. Aber ihre eigene Kommunikation mit ihrer sozialen Umwelt ist hochgradig gestört, weil niemand merkt, wann dieses Kind Trost braucht und was man ihm zumuten kann oder wann er oder sie sich zurückziehen sollte – sie werden zu Außenseitern wider Willen.
Dass es erlernte und, im Vergleich dazu, moderate Wahrnehmungsstörungen ähnlicher Art gibt, werden wir zu erörtern haben, wenn es weiter unten darum geht, dass Menschen zwar Schmerzen empfinden, aber nicht merken, dass diese von unbewussten Anspannungen gespeist werden – auch dies eine chronische Kommunikationsstörung zwischen Körper und Psyche: hier muss der Körper laut, d. h. schmerzhaft, schreien, um sich bemerkbar zu machen.
Schmerz als Schutzreflex
Nun haben allerdings alle Körper bzw. alle Lebewesen – außer jenen mit genetischen Aberrationen – vielfältige automatisierte und reflektorische Schutzsysteme, die funktionieren, ohne dass wahrnehmendes Bewusstsein davon nötig ist und Kommunikation mit der Psyche stattfinden müsste. Auch wenn der Mensch bewusst lernen kann, dass Feuer oder Hitze wehtun, handelt es bei der immer wieder erwähnten Hand, die von der heißen Herdplatte zurückgezogen wird, nicht um eine Reaktion, sondern um ein Reflexgeschehen – es erfolgt automatisch, stereotyp und ohne kognitive Beteiligung. Deshalb spricht man vom Wegziehreflex, wie z. B. auch vom Lidschlussreflex, wenn die Augen einer Bedrohung ausgesetzt sind. Es handelt sich also um unwillkürliche Schutzreflexe, was man im Auge behalten sollte, wenn man verstehen möchte, auf welche Weise Schmerzen kommunizieren: Sie kommen unwillkürlich und sind dem aktiven Willen und seiner Kontrolle selten direkt zugänglich. Im zweiten Teil des Buches wird erklärt, dass auch der Migräne-Anfall als Schutz-Reflex verstanden werden kann.
Auch chronische Schmerzen haben eine Schutzfunktion
Schmerzen haben eine schützende Funktion – nicht nur in akuten oder drohenden Gefährdungssituationen, sondern auch in anhaltenden, also chronischen, Bedrohungen der individuellen Integrität.
Insofern haben nicht nur akute Schmerzen eine Warn- und Schutzfunktion, sondern auch chronische Schmerzen – was der derzeit gültigen Meinung aller mir bekannten Schmerzexperten zwar durchaus nicht entspricht, aus funktioneller Sicht aber gut begründbar ist. In den einschlägigen Vorträgen wird mantraartig wiederholt: »Akute Schmerzen haben eine Warnfunktion, chronische Schmerzen haben diese Funktion verloren und sind zu einer eigenständigen Krankheit geworden«. So als müsse man sich selbst und die Zuhörer seiner Richtigkeit versichern und ohne darüber zu reflektieren, ob das nicht einfach nur heißt: »Schmerz, wir haben die Warnung verstanden, du könntest dich zurückziehen. Aber, was du als chronischer Schmerz sagen willst, wissen wir nicht, wir verstehen dich nicht – dein Fehler!«
Es wird angenommen, dass bei chronischen Schmerzen quasi sinnlose neuronale Verbindungen geknüpft werden. Zwar überfordert die Komplexität des menschlichen Nervensystems unser Verständnis, doch erscheint es mir nicht sinnvoll, den menschlichen Nervensystemen zu unterstellen, es würden ihnen hin und wieder eben Fehlschaltungen unterlaufen, weil sie so überaus komplex verschaltet sind. Das resultiere dann darin, dass Neuronen unbotmäßig andauernd feuerten ohne Sinn und Zweck. Unsere Nervensysteme kommen, wie ich meine, mit ihrer eigenen Komplexität ganz gut zurecht. Wenn sie dauerhaft entgleisen, hängt das nicht mit ihrer eigenen Unzulänglichkeit zusammen, sondern damit, dass sie von außen einwirkende Störungen, wozu auch die eigenen Gedanken gehören, nicht (mehr) kompensieren können – darauf sollten wir schauen.
Auch sollten wir unterscheiden zwischen Störung und Erkrankung bzw. Krankheit. Chronische Schmerzen ohne erklärungskräftigen Organbefund signalisieren eine chronische, d. h. anhaltende, Störung, wobei immer mehr körperliche, psychische und soziale Funktionen in das Störungsgeschehen hineingezogen werden – es wird daraus trotzdem keine Erkrankung. Zu welchem Zweck sollte sich dieser qualitative Sprung ereignen?
Akute Schmerzen, die im Zusammenhang mit einer Grunderkrankung auftreten, können mit ihr zusammen chronifizieren, z. B. bei entzündlichem Rheumatismus oder einer fortschreitenden Krebserkrankung. Hier wird die Krankheit zusammen mit dem ihr zugehörigen Schmerz behandelt. Bei einer Schmerzstörung, akut oder chronisch, muss die Störung behandelt werden. Wenn beides zusammenkommt, behandelt man beides, und zwar zeitgleich.
Kehren wir noch einmal zur Wachhund-Funktion des Schmerzes zurück, so sehen wir, dass die häufigste Bedeutungszuschreibung für den Schmerz seine Signalgebung ist, die sagt: Achtung Gefahr!
Schmerz als Antrieb und Forderung
Patrick Wall, den ich für einen der klügsten Schmerzforscher halte, bezweifelt die Abfolge der Ereignisse. Er bezweifelt nicht den Wachhund, aber er gibt ihm eine andere Funktion: Ausgehend von der schon oben dargestellten Tatsache, dass bei Verletzungen zunächst und sehr oft für längere Zeit, d. h. ein paar Stunden, überhaupt kein oder nur marginaler Schmerz auftritt, sodass der Verletzte geistig klar und orientiert Flucht- oder Kampfreaktionen ausführen kann, geht Wall davon aus, dass der (dann) eintretende Schmerz eine Aufforderung darstellt, sich in Sicherheit zu bringen und Bedingungen für Heilung zu suchen; und erst in zweiter Linie, solche Gefahren künftig zu vermeiden.
Wall (1982) stellt die Frage, wie wir denn das Gefühl Schmerz klassifizieren sollen, da es ja die Kriterien für die klassischen Sinnesempfindungen nicht erfüllt. Der Schmerz gehört eher zu den Trieben wie Hunger und Durst – doch was ist beim Schmerz der Trieb und sein zu erreichendes Ziel?
Patrick Wall (1982, S. 40): »Es ist nicht richtig zu sagen, dass der Schmerz der Vermeidung einer Verletzung dient, obgleich diese Aussage häufig gemacht wird. Es liegt auf der Hand, dass in den meisten Fällen der primäre Schaden schon eingetreten ist, wenn Schmerz empfunden wird. Es stimmt, dass die Erfahrung von Schmerz eine wirksame Begleiterscheinung des Lernprozesses ist, der es ermöglicht, eine Wiederholung des Reizes, der den Schmerz hervorruft, zu vermeiden. Dasselbe gilt für Hunger und Durst.« (. . .) Die unbewusste und unwillkürliche Vermeidungsreaktion, wie etwa der Flexor-Reflex, findet sowieso lange vor der bewussten Empfindung von Schmerz statt. Auch »in Fällen von überraschenden Verletzungen ist Schmerz ein schlechter Beschützer und vielleicht noch schlechter, wenn Schädigungen langsam eintreten. Bei einer fortgesetzten Zerstörung, wie sie durch Krankheiten wie Krebs, Tuberkulose, Lepra etc. hervorgerufen wird, signalisiert der Schmerz eher die Ankunft des Leichenwagens als den Beginn einer rettenden Maßnahme.«
Ein weniger drastisches Beispiel beschreibt Treede (2004) unter der Überschrift »Gewebeschädigung ohne Nozizeption« und zieht dafür den Sonnenbrand heran. Den Schmerzrezeptoren der Haut fehlt die Sensitivität für UV-Strahlung. Daher ist die eigentliche Noxe auch bei starker Sonnenbestrahlung nicht schmerzhaft. Erst später, wenn die zunächst unbemerkt eingetretene Gewebeschädigung zu einer Entzündungsreaktion geführt hat, wird die entzündete Haut schmerzüberempfindlich. Die Hitzeschmerz-Schwelle wird unter die Körpertemperatur abgesenkt, und Linderung geschieht durch Kühlung der Haut. Offenbar hat die Evolution nicht damit gerechnet bzw. konnte nicht so schnell darauf reagieren, dass weißhäutige Menschen sich bei wachsendem Ozonloch absichtlich in der Sonne bruzzeln.
Der akute Schmerz wird hier als ein Trieb verstanden, der dazu auffordert, heilende Maßnahmen zu ergreifen. Der Wachhund bellt und winselt so lang, bis dies erfolgt ist. Wenn er sieht, dass man sich in Behandlung begibt, hört er bisweilen schon mal auf: Oft schon dann, wenn der Mensch die Praxis seines Zahnarztes betritt. Intelligenter Hund!
Drei Phasen des Übels
Erste Phase: Angst und Vermeidung Diese erste von den »drei Phasen des Übels«, wie Wall formuliert, ist neben dem Schmerz auch gekennzeichnet von Angst und möglicherweise von Aggression und starker Energie. Der akute Schmerz enthält eine starke ängstliche Forderung. Dabei reicht die Angst zeitlich in die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Die rückwärts gerichtete Angst bezieht sich auf die angenommene Ursache, versucht sie zu verstehen, um sie künftig vermeiden zu können. So lernt der Mensch zum Beispiel: »fear avoidance«, was heißt: Vermeidung aus Angst. Dieses Lernen koppelt die Vergangenheit an die Zukunft, indem sie sagt: Hüte dich! Das ist eine normale und nützliche Sache. Sie wird in manchen Therapiekonzepten allerdings oft als Vermeidungslernen psychopathologisch konnotiert.
Die gegenwarts- und zukunftsbezogene Angst richtet sich auf die Behandlung und den künftigen Schaden. Dabei sind Angst und Schmerz vollständig miteinander verknüpft. »Die Behandlung des einen ist auch die Behandlung des anderen. Es gibt keine Rechtfertigung, diese zwei Zustände als unabhängige Variable zu betrachten. Sie erscheinen als zwei Aspekte desselben Phänomens (. . .), mehr bezogen auf die Behandlung und Wiederherstellung als auf die auslösende Ursache selbst.« (Wall 1982, S. 42)
Dass Angst eine Emotion ist, wird niemand bestreiten wollen. Dass Schmerz – nämlich das Quälende und Bedrängende an ihm – ebenfalls eine Emotion ist, hat sich noch nicht überall herumgesprochen.
Zweite Phase: Behandlung und Sicherheit Die Apellfunktion des Schmerzes ist gewissermaßen zwingend. Es besteht auch für das soziale Umfeld die dringende Verpflichtung, diesen Schmerz zu beachten und zu lindern. Und es gibt eine verbriefte Verbindlichkeit, die dem Schmerzpatienten das Recht auf Schmerzbehandlung zuspricht (Kutzer 1991). So gilt der bekannte Satz von Marcel Proust nicht nur für den betroffenen Menschen selbst, sondern auch für sein soziales System: »Krankheit ist der Arzt, auf den wir am meisten hören. Der Güte und dem Wissen machen wir nur Versprechungen – dem Schmerz gehorchen wir.« (zit. nach Wall 1982, S. 30) Wall fährt fort: »Was ist das für ein merkwürdiger Zustand, der eine Befehlsgewalt über den Menschen besitzt, der sich ansonsten einbildet, einen freien Willen, willentliche Kontrolle über sein Verhalten, seine Wahlen und seine Entscheidungen zu haben?« Der Schmerz fordert, sich um das zu kümmern, was als Verletzung physischer oder psychischer Art vorausgegangen ist, und dies zu behandeln, zu lindern und zu heilen.
Dies geschieht in der Zeit, die wir als das akute Stadium ansehen, und es besteht ein professioneller Konsens unter Ärzten und Schmerzpsychologen darüber, dass akute Schmerzen behandelt werden müssen – wenn der/die Betroffene dies wünscht.
Dritte Phase: Erholung und Geduld Die eigentliche Pointe des Wall’schen Drei-Phasen-Modells besteht darin, dass die nachfolgende dritte Phase »des Übels« der wichtigste Pfad in die Wiederherstellung der gesunden Funktionsfähigkeit ist.
Der Übergang vom akuten zum chronischen Schmerz ist eines der größten Rätsel in der Schmerzmedizin und der Schmerzpsychologie. Unsere derzeitige Sicht auf den chronifizierenden und letztendlich chronischen Schmerz ist geprägt von Unverständnis – nicht so sehr gegenüber dem Phänomen, aber gegenüber dem Patienten, der am Ende des Weges chronische Schmerzen hat.
Schon die Bestimmung, wann ein Schmerz als chronisch anzusehen ist, zeugt, wie schon oben gesagt, von einiger Hilflosigkeit. Was in der Übergangszeit von akut zu chronisch mit den Schmerzen geschehen ist, warum sie bei dem einen vergangen sind, beim anderen persistieren, wieso und auf welcher Grundlage nun eine ganz andere Kategorie – Erkrankung statt Störung – entstanden sein soll, ist unklar. Allerdings wird bei der Definition der Chronizität eines Schmerzes nun die reine Zeitschiene ergänzt durch die kontinuierliche Zunahme von dysfunktionalen Begleitstörungen, die nach meiner Ansicht die zunehmende Not des komplexen Gesamtsystems signalisieren.
Andererseits kennen wir Schmerzen, die einer anderen Dynamik folgen. Das sind intermittierende Schmerzzustände etwa bei Angina pectoris, bei der jede Attacke eine Wiederholung der akuten Phase darstellt, die Furcht und Angst beim Patienten auslöst. Wenn die Attacken häufiger werden und ernst sind, kommen die Patienten in einen akuten Angstzustand. Sie sind blass, schwitzen, sind nervös und schränken ihre Aktivitäten ein, die weitere Attacken auslösen könnten – also ein klassischer Fall von fear avoidance. Ähnlich ergeht es Patienten mit Trigeminus-Neuralgie oder auch Migräne (siehe dazu Teil III).
Iatrogene Chronifizierung durch das Gesundheitssystem – die Störung der dritten Phase
Könnte es nicht sein, dass es sich bei vielen chronischen Schmerzstörungen um einen malignen Zirkel von Missverständnissen, falschen Maßnahmen im Sinne von »mehr desselben« und sich weiter aufschaukelnden Störungsprozessen handelt?
Mit dieser Hypothese beziehe ich mich wiederum auf Patrick Wall:
Zunächst einmal ist seine Beschreibung von Patienten mit chronischen Schmerzen, die sich von solchen mit akuten Schmerzen völlig unterscheiden, nach wie vor gültig und auch von Schmerzpsychologen akzeptiert: »Das Verhalten dieser Patienten verändert sich nach dem anfänglichen akuten Stadium im Verlauf der Tage, Wochen und Monate. Schmerz und Beschwerden sind ständig vorhanden, und oft wird eine immer ausgeprägtere Suche nach Behandlungsmöglichkeiten zu ihrer Hauptbeschäftigung. In anderer Hinsicht zeigen die Patienten alle Zeichen einer zunehmenden Depression. Die Bewegungen sind verringert, das Denken ist langsam, und die Aufmerksamkeit für die Außenwelt ist eingeschränkt. Bisweilen kommt Selbstmord vor – sehr oft Appetitverlust, Verstopfung, Verlust der Libido, Störungen des Menstruationszyklus, des Schlafverhaltens und Störungen der familiären und sozialen Beziehungen. Wenn dieses Verhalten chronisch wird, können die ursprünglichen Krankheitszeichen verschwinden oder nur ein kleiner Rest davon übrig bleiben.«
Wenn kein ausreichend erklärungskräftiger körperlicher Befund diagnostiziert werden kann, geraten die Behandler in Frustration und Hilflosigkeit und haben (und kommunizieren) den Eindruck, dass dem Patienten »gar nichts fehlt«. Sie meinen damit »körperlich«, übersehen aber, dass Schmerz ein geistiger Vorgang ist, der sich über den Körper ausdrückt. Sie fragen sich dann: Ist der Patient vielleicht für Krankheitsverhalten belohnt worden? Hat er einen sekundären Krankheitsgewinn, indem er mehr Liebe und Zuwendung erhält als vorher? Kann er so die Anforderungen des Alltagslebens vermeiden oder eine Versicherungskompensation bzw. Rente erhalten? »Das Denken der Leute über diesen Patienten wird allmählich von solchen lieblosen Gedanken bestimmt und resultiert in Gegenkonditionierung, Verhaltenstherapie und sogar darin, dass sie den Patienten aufgeben.« (Wall 1982, S. 43)
Diese Beschreibung bildet auch heute noch gut ab, was sich gegenüber Schmerzpatienten, die sich in einem fortgeschrittenen Chronifizierungs-Stadium befinden, im Versorgungssystem abspielt. Die Patienten bleiben unerschütterlich davon überzeugt, dass sie Schmerzen haben und einer speziellen Behandlung bedürfen. In den reichen Industrieländern ist hierfür auch ein weitreichendes Angebot an Behandlungsmethoden und -einrichtungen entstanden einschließlich wiederholter Operationen, die nicht selten zu vermehrten Schmerzen und assoziierten Problemen führen.
Wenn wir Patrick Wall folgen, so müssten wir die dritte Phase nicht als pathologischen Prozess, sondern als eine ganz normale und essentiell wichtige Zeit ansehen, die dazu dient, die Genesung zu fördern und allmählich zu vollenden. Manche Krankheiten zeigen ähnliche Syndrome allerdings ganz ohne Schmerzen, wie z. B. die infektiöse Hepatitis, bei der Aktivität, Schlaf, Stimmung und Verhaltensmuster der Mattigkeit, Lustlosigkeit und Schonung Monate brauchen, um sich wieder zu normalisieren, auch wenn Leberfunktionstests offensichtlich zum Normalzustand zurückgekehrt sind.
Wenn der Schmerz einen Körperzustand signalisiert, der Maßnahmen für seine Wiederherstellung und Erholung – im Sinne von Rekonvaleszenz – erfordert, die allgemeine Veränderungen der chemischen und hormonellen Veränderungen im Körper und auch Veränderungen im Zentralnervensystem mit sich bringen, so können diese normalen Genesungsprozesse ihrerseits gefördert oder auch erheblich gestört werden.
Wenn man diesen, schon etwas älteren Schmerzvorstellungen folgen möchte, was ich hiermit vorschlage, so fällt auf, dass die Wall’sche Phase drei heute so gut wie nicht mehr stattfindet. Überall in der Gesellschaft, auffallend auch im Gesundheitssystem, hat sich eine Beschleunigungs-(Un-)Kultur entwickelt, die darauf zielt, den immer mal wieder kranken Menschen schnell wieder funktionsfähig, will heißen arbeitsfähig, zu machen. Wenn man hingegen Literaturen oder Berichte aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert ansieht, wundert man sich doch, welch lange Zeiten, nämlich Monate, die damaligen Leute – eher die wohlhabenden – zur Rekonvaleszenz in Karlsbad oder anderen Thermen, im Gebirge oder am Meer verbrachten.
Man geht wohl davon aus, dass sich der menschliche Organismus in der seither vergangenen (kurzen) Zeit den Anforderungen der Schnelllebigkeit angepasst hat: »Heil’ schneller, Genosse!«
Es könnte aber auch sein, und das ist wahrscheinlicher, dass er sich diesen Anforderungen einfach nicht fügen kann – und dass deshalb die Rekonvaleszenz sich sehr verzögert oder, wegen schneller Rückkehr in die Arbeit und zahlreicher therapeutischer Interventionen, die zusätzlich Kraft und Zeit kosten, überhaupt nicht gelingen kann. Die Patienten, die ja ein Teil dieses Systems sind, spielen das Spiel mit, da sie sich eine schnelle Genesung erhoffen – und machen sie so gleichzeitig zunichte.
Schon sehr früh wiesen, interessanterweise, orthopädische Operateure auf die Beteiligung des Gesundheitssystems an der Chronifizierung von Schmerzen – im speziellen Fall von Rückenschmerzen – hin. Nachemson (1992) beklagte das »abnorme diagnostische und therapeutische Verhalten« der meisten Ärzte, das das »abnorme Krankheitsverhalten« der Patienten hervorbringe. Und Waddell (1998) stellte fest, dass die Behinderungen durch Kreuzschmerzen weitgehend ärztlich bedingt seien. Über den geradezu epidemieartigen Anstieg von Rückenschmerzen trotz verstärkter therapeutischer Angebote und Einrichtungen mehr im Teil III.
Patienten mit chronischen Schmerzen klagen oft darüber, dass sie den Doppel-Anforderungen ihres Lebens und der Therapie nicht gewachsen seien. Deshalb: Cave! Möglicherweise bringen wir die misslichen Zustände, die wir beklagen, gemeinsam hervor.
In der letzten Zeit häufen sich allerdings Störungsphänomene, die das, was nötig ist, erzwingen: Bei einem Burn-out ist eine lange Aus-Zeit garantiert. Man sieht, dass die Psyche ständig gangbare Wege sucht und der Körper ihr gehorcht.
Wie wir diesem Dilemma therapeutisch begegnen können, wird im Kapitel über die hypnosystemische Behandlung akuter und chronischer bzw. chronifizierender Schmerzen besprochen.
Zunächst wende ich mich einer grundlegenden Frage zu, deren Beantwortung therapeutisch relevant ist. Wenn wir wissen, unter welchen Umständen der Organismus Signale an sein Bewusstsein als Schmerzsignale kodiert, können wir vielleicht daraus Schlüsse ziehen, wie wir ihn dazu veranlassen könnten, damit auch wieder aufzuhören.
1.3 Neurobiologie: Unter welchen Bedingungen sendet der Organismus Schmerzsignale an sein Bewusstsein?
Zunächst einmal: Auf welchen Wegen schickt der Organismus ein bestimmtes Signal, z. B. Schmerz, an sein Bewusstsein? Und weiter: Wie beeinflusst das Bewusstsein das Schmerzerleben?
Diese Fragen werden in allen Forschungssparten gestellt, die sich mit dem Schmerz befassen.
An vorderster Front die Neurobiologie, die in den letzten Jahrzehnten einen rasanten Aufstieg vorzuweisen hat.
Die Erklärungen begannen mit einfachen Konzepten, wie der Vorstellung von Descartes, der annahm, dass sich irgendwo in der Körperperipherie, z. B. an einem Fuß, der ins Feuer gerät, oder in einem Zahnnerv eine Schädigung ereignet, die dann über einen Nervenstrang ins Schmerzzentrum des Gehirns gemeldet wird, wo das Schmerzsignal ertönt. Er und seine Zeitgenossen gingen noch davon aus, dass es im Gehirn ein Schmerzzentrum geben müsse.
Etwa um 1900 wurden von Sherrington die Nozizeptoren, also Schmerzrezeptoren, entdeckt sowie schmerzleitende Fasern (die schnellen myelinisierten A-Delta und die langsameren C-Fasern) als ein Teil des somatosensorischen nozizeptiven Systems. Diesem System wird die sensorisch-diskriminative Komponente des Schmerzes, genauer gesagt die Nozizeption, zugeordnet, die aus der Identifikation des Ortes und der Intensität des Schmerzes besteht. Nozizeption ist zunächst einmal eine interne Angelegenheit des Nervensystems – wenn dort das Signal stark genug ist, also überschwellig, dringt es ins Bewusstsein vor und wird als Schmerz wahrgenommen. Wo die Bewusstseinsschwelle zum Schmerz liegt, ist sehr individuell und von Kontextbedingungen abhängig. Die kognitiv-emotionale Bewertung bzw. Bedeutungsgebung des Signals bestimmt die Empfindung bzw. das Schmerzerleben.
Im Laufe der Zeit wurden mehr und mehr funktionell verschiedene Hirnstrukturen entdeckt, die in einer konzertierten Aktion am Schmerzgeschehen beteiligt sind. Heute spricht man von einer komplexen neuronalen Schmerz-Matrix.
Als von Melzack & Wall (1965





























