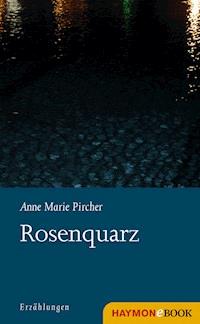Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kopfüber an einem Baum versammelt Erzählungen von Anne Marie Pircher, geboren 1964, Kuens bei Meran. Es sind Geschichten aus dem Dorf und aus der Fremde, Geschichten aus einer Welt des Weiblichen, erzählt von einer Frau: schwebend zwischen Realität und Surrealem, zwischen Wahrheit und Mythos, in einer kraftvollen Sprache, die hart und weich sein kann, die Traurigkeit und Erotik, Melancholie und Leidenschaft ausstrahlt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 153
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anne Marie Pircher
Kopfüber an einem Baum
Erzählungen
Herausgegeben in Zusammenarbeit mit dem Kreis Südtiroler Autorinnen und Autoren.
Ungekürzte E-Book-Ausgabe
HAYMON Verlag, Innsbruck-Wien 2013
www.haymonverlag.at
© 2003 by Skarabæus Verlag Innsbruck-Bozen-Wien in der Studienverlag Ges.m.b.H.
Erlerstraße 10, A-6020 Innsbruck
e-mail: [email protected]
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-7099-3569-9
Buchgestaltung nach Entwürfen von Kurt Höretzeder/Circus, Innsbruck
Satz und Umschlag: Skarabæus Verlag/Elisabeth Natz
Lektorat: Anna Rottensteiner
Dieses Buch erhalten Sie auch in gedruckter Form mit hochwertiger Ausstattung in Ihrer Buchhandlung oder direkt unter www.skarabaeus.at.
Zwischen den Dörfern
Schattenlauf
Zihuatanejo
Der Gorilla
Der Taucher
Der Furchenmann
Das dritte Kind
Spondeo
Marktszenario
Anders
Ein bisschen
Das fünfte Element
Erwischt
Die Einladung
Wer es könntedie Welthochwerfendaß der Windhindurchfährt.
Hilde Domin
Zwischen den Dörfern
Wenn man von der Stadt kommt und taleinwärts fährt, erkennt man es nicht sofort. Auf den ersten Blick ist hier gar nichts, und man würde achtlos vorbeifahren, wenn man ein anderes Ziel hätte. Man könnte meinen, es liege weiter oben oder weiter unten. Wenn man aber wirklich ins Dorf will, muss man sich am Gasthaus an der Hauptstraße die Frage stellen, ob man nun rechts oder links abbiegen soll. Man wird natürlich die Hinweisschilder suchen und erleichtert dem Wort Ortsmitte folgen. Nun kann man gelassen links abbiegen und zielsicher nach oben fahren, nichts ahnend, dass ein beachtlicher Teil des Dorfes genau in der entgegengesetzten Richtung liegt.
Es gibt Dörfer, ich habe sie vor allem im Vinschgau gesehen, die strahlen auf den ersten Blick diese heimelige Wärme aus. Die Häuser aneinander gekuschelt, Schulter an Schulter oder Wange an Wange. So, als müssten sie sich verbünden gegen den Rest der Welt. Und mittendrin der Kirchturm als Mahnung und gleichzeitig als Bestätigung für Recht und Ordnung, für Ehre und Standhaftigkeit. Einmal bin ich oben am Kloster Marienberg gestanden und habe auf diese zusammengetragenen Haufen geblickt. Ich habe mir vorgestellt, in einem dieser Haufen geboren und aufgewachsen zu sein. Habe mir eines der Häuser ausgesucht, möglichst in der Mitte, und mich mit roten Wangen und lustigen Zöpfen, achtjährig dorthin gestellt. Es gelang mir aber nur, mich vor dem Haus zu sehen. Vor einer dieser Fassaden, die ich mir von weitem genau ausgemalt hatte. Ein Stück Garten hätte dabei sein sollen, aber ich hatte meine Schwierigkeiten, inmitten dieser zusammen getragenen Haufen ein Stück Grün zu platzieren. So sah ich mich letztendlich gezwungen, ins Haus zu gehen. Sobald aber die Fassade in meinen Vorstellungen zerbröckelte und ich mich mit dem Inneren des Hauses auseinander setzen musste, habe ich meinen Blick schnell auf die umliegenden Berge geworfen und die Weite des Himmels gesucht.
Ich selbst bin in keinem Dorf groß geworden. Zwischen den Dörfern gibt es oft weite Flächen, die ein Niemandsland sind und sich nicht so einfach zuordnen lassen. Es besteht zwar die Möglichkeit, sich an das Katasteramt zu wenden und auf den Raumordnungsplänen nach einer Lösung zu suchen. Aber selbst dann findet man nicht das, womit man zufrieden wäre. Man hat nichts Eindeutiges, nichts Klares, nichts von dieser Zugehörigkeit zu einem dieser zusammen getragenen Haufen. Es bleibt ein Niemandsland, und man kann höchstens scherzhaft tun und ihm den Namen Sibirien geben, so wie ich es getan habe.
Sibirien gab dem Ganzen etwas Heldenhaftes, Undurchdringliches, Undurchschaubares. In meinem Sibirien lebten streunende Wölfe, vor allem aber eine einzige Wölfin. Sie war nicht wirklich wild, denn selbst in Sibirien wurden Wölfe nach Möglichkeit gezähmt. Aber sie war stark und mutig auf ihren Streifzügen durch das dürre Land. Oft habe ich sie oben in den Wäldern verfolgt und heimlich beobachtet, wie sie nach Essbarem suchte. Manchmal hatte ich das Glück, in ihre Augen sehen zu können, und das Funkeln, das zu mir herüber sprang, hat mich zu ihrer heimlichen Verbündeten gemacht. Ich habe es nie gewagt, mich ihr wirklich zu nähern, ich hatte Angst vor Wölfen, so wie alle Kinder. Aber ich habe sie jahrelang beobachtet und ihre Spuren in den Wäldern verfolgt. Im Winter, wenn Schnee gefallen war, konnte ich sie mühelos ausfindig machen. Die Kälte unserer Wohnung hat mich hinaufgetrieben in die Wälder, wo ich das warme Funkeln ihrer Augen suchte. Sie lebte niemals im Rudel, und es war ein Leichtes, ihre einsame Spur zu lesen. Nur den Platz, wo sie ihr Nachtlager hatte, wo sie sich von ihren Futtersuchungen ausruhte, habe ich nie zu Gesicht bekommen. So sehr ich mich auch bemühte, ich habe sie nicht ein einziges Mal schlafend gesehen, nicht ein einziges Mal in dieser kindhaft entspannten Lage, die mir die Möglichkeit gegeben hätte, mich ihr in fürsorglicher, mütterlicher Liebe zu nähern. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich getan hätte, aber ich erinnere mich, dass ich stets diese Sehnsucht in mir trug, meine Wölfin in ihrem Schlaf zu streicheln. Selbst heute noch, wenn ich daran denke, spüre ich ein großes Verlangen danach.
Ich bin also in Sibirien groß geworden, und man kann sich vorstellen, mit welch träumerischen und überschwänglichen Fantasien man sich dort den Süden erdenkt. Ich habe stets von einer Zukunft am blauen, weiten Meer geträumt. Irgendwo im Licht der Sonne, die meine Haut berührt und es mir erlaubt, fast ohne Kleider durch die Welt zu laufen. Ich bin in Gedanken auf blauen Walen durch die Wellen geritten und in die warmen Fluten eingetaucht, die meinen lebendigen Körper gerne trugen. Nichts habe ich dann mehr gespürt von dem Unbehagen kratzender Pullover auf meiner Haut, von kalten Zehen in fremden Schuhen oder von starren Fäusten in einsamen Taschen. Zu gerne habe ich den Weg der Zugvögel mit meinen Augen verfolgt, wie sie über unser Haus und dann übers Tal flogen. Ich bin dagestanden mit meinen Fingern im Mund und war einer dieser schwarzen Punkte, der so mühelos und selbstverständlich über die hohen Berge ans Meer kam. Nur der Ruf meiner Mutter hat mich stets daran erinnert, dass ich warten musste, dass ich ins Haus gehen und warten musste.
Wenn ich heute vom Dorf hinüber schaue auf die andere Talseite nach Sibirien, ist mir nicht ganz klar, warum ich den Weg in den Süden später niemals gefunden habe. Ich kann es mir nur dadurch erklären, dass meine Liebe zur Wölfin stärker gewesen sein muss als meine Liebe zum Süden. Wie sonst wäre es mir gelungen, einfach nur Talseite zu wechseln, einen Bach zu überspringen, um weiterhin das dürre Land vor Augen zu haben, wenn auch aus einer anderen Perspektive. Nur der Wölfin räume ich das Recht ein, diesen Platz für mich gewählt zu haben, von dem aus ich auch heute noch ihre Streifzüge erahnen kann, weit seltener zwar und aus ganz anderer Distanz.
Wahrscheinlich habe ich unzählige Male an den Fenstern meiner Kindheit gestanden, vom Dorf gegenüber nichts ahnend, das so leicht zu übersehen war, weil die Zugvögel so hoch flogen. Ich habe wahrscheinlich auch nie wirklich etwas vom Dorf gehört, weil meine Vorstellung von Dörfern eine völlig andere war. Und doch habe ich meinen Fuß in dieses Dorf gesetzt, irgendwann. Habe mir am Gasthaus an der Hauptstraße die Frage gestellt, ob ich nun links oder rechts abbiegen soll. Habe lange die Ortsmitte gesucht und nach eng umschlungenen Häusern Ausschau gehalten. Bin umher geirrt in diesem zerstreuten Nest, dessen Anspruch ich nicht erkennen wollte. Dieses längs gezogene, von oben nach unten verlaufende Häusergespann, irgendwo radikal getrennt durch die Hauptstraße, die ins Tal oder in die Stadt führt, hat meine Erwartungen so beschämend verhöhnt.
Und doch bin ich geblieben. Habe Fuß gefasst und meine Erinnerungen hierher getragen.
Ich gehe die schmale Dorfstraße hinauf, die mich vorbeiführt an ehemals selbstzufriedenen Gehöften. Sehe die braven Familienhäuschen, die sich in der Zeit des Wohlstands dazwischen angesiedelt haben. Hie und da noch ein billiges Bauwerk aus schlichteren Zeiten, eines davon trägt sogar den Namen Belvedere. Auf halber Höhe begegne ich einer einsamen Kirche, an deren rechter Seite ein lebloses Gebäude steht. Nur die von Kinderzeichnungen geschmückten Fenster beteuern, dass es auch heute noch die Dorfschule ist. Ich schaue hoch zu den beiden Fenstern unterm Dach und versuche, die Zeichnungen meiner zwei Buben zu erraten. Dann öffne ich das schmiedeeiserne Gitter und steige die Treppe zum Friedhof hinauf. Von hier hat man einen schönen Blick auf die Stadt, auch auf die gegenüberliegende Talseite. Die Stadt liegt im Süden, Sibirien aber im Osten, dort, wo die Sonne aufgeht.
Mein Blick kehrt zurück auf die Gräber und streift das des Mörders. Einmal habe ich mit meinen Kindern Blumen hierher gebracht, um ihnen zu erklären, dass auch ein Mörder sich über Blumen freuen könnte. Nun bestaune ich das Grab, das sich so unauffällig zwischen die anderen gereiht hat.
Ich gehe die schmale Dorfstraße hinunter und suche die Lichtung auf der anderen Talseite. Sie liegt am rechten Ende des Waldstückes zwischen den Dörfern. Genau dort, an der Stelle, wo die Sonne am Morgen ihre ersten Strahlen hinwirft, glaube ich einen Schatten zu erkennen. Es ist der Schatten eines Tieres, das soeben sein Nachtlager verlassen hat.
Schattenlauf
Ich laufe mit meinem Schatten die Treppe hinunter. Es ist ein dunkles, düsteres Haus, eigentlich nur ein Turm, in dessen Mitte sich eine windende Treppe befindet. Ich weiß nicht mehr, wie ich ganz nach oben kam. Aber das spielt jetzt keine Rolle, denn ich muss nach unten, dort liegt der Ausgang aus diesem Turm. Ich laufe sehr schnell, geschickt auch. Denn es ist nicht ganz einfach, eine solche Treppe im Laufen zu meistern. Man läuft andauernd im Kreis und es wird einem ein bisschen schwindlig dabei. Auch wenn es ein offener Kreis ist, der sich nach unten hin immer ein wenig auftut, ist es doch nicht ganz einfach, ihn ohne Gleichgewichtsstörungen zu überwinden. Mein Schatten läuft ganz dicht hinter mir. Beinahe berührt er mich. Das gibt mir keinen richtigen Halt, sondern weist mir nur die Richtung. Er hindert mich daran, rückwärts zu laufen, er ist in gewisser Weise mein Antrieb. Ohne meinen Schatten würde ich wahrscheinlich gar nicht so laufen, sondern mich auf dieser langen, sich windenden Treppe zwischendurch hinsetzen und ausruhen, vielleicht würde ich auch nur langsam Stufe um Stufe nach unten oder aber wieder zurück nach oben steigen, weil ich ja nicht weiß, warum ich laufen sollte und warum gerade dem unteren Ausgang zu. Ich habe es eigentlich gar nicht so eilig, nach unten zu kommen, weil ich nichts vorhabe. Ich habe weder Hunger noch Durst noch sonst ein Bedürfnis, das befriedigt werden müsste. Ich könnte mir ganz ruhig, wenn ich ohne Schatten wäre, diesen Turm ansehen. Von innen. Ganz oben, daran erinnere ich mich noch, bevor ich den Weg nach unten antrat, ist der Turm offen. Ich habe lange Zeit dort oben verbracht. Auf der Plattform unterm Himmel. Wahrscheinlich waren es Jahre.
Es muss Frühling gewesen sein, als ich das erste Mal dort oben ankam. Ich erinnere mich, dass Schwalben sich in den Zinnen eingenistet hatten. Und dass ein leichter Wind durch die Gucklöcher blies. Der Himmel über mir war oft blau, meist mit dünnen, weißen Schleiern durchzogen. Ich habe hinunter auf eine Stadt sehen können durch eines der Gucklöcher. Diese Stadt schien mir so fern und unerreichbar, dass ich oft tagelang mit Hunger in den Augen ihre Häuser verschlang, ihre Straßen und Kirchtürme, ihre Plätze und Menschen, die in ihrer Geschäftigkeit wie Insekten aussahen.
Der Frühling war immer die Zeit der ersten Ankünfte. Sei es der Schwalben oder auch der vielen Menschen, die um diese Jahreszeit auf den Turm hinaufstiegen, um die Aussicht zu bewundern. Sie kamen und gingen, die Schwalben wie die Menschen. Und alle waren sie meist unbeschwert. Vor allem die Schwalben. Zwar gab es unter den Menschen immer mal wieder auch traurige oder zornige, überhebliche, eingebildete oder schwerfällige. Aber im Grunde waren sie es nie von langer Dauer, dann wechselten sie wieder. Der Frühling dauerte bei diesen Menschen nie sehr lange, sondern immer nur eine Woche, zehn Tage, manchmal auch zwei, allerhöchstens drei Wochen. Dann bereits konnte die Traurigkeit, der Zorn oder auch die Überheblichkeit wieder gegen Lust und Freude, gegen Spiel und Redseligkeit eingetauscht werden. Es kam ein neuer Frühling, alle Wochen wechselte er. Sie kamen und gingen, die Launen der Menschen. Und mit ihnen kamen und gingen ihre Kleider und ihre Mitbringsel, die sie auf dem Turm abstellten und die sich im Laufe der Jahre häuften und mich immer weiter zurückdrängten an die Zinnmauern mit den Gucklöchern, durch die der Wind blies. Ja, ich erinnere mich, dass ich aufräumen musste, dass ich ihren Dreck wegputzen musste, um wieder Platz zu machen für neuen Dreck, den die Turmbesucher mit sich brachten, wenn sie ankamen und abreisten. Ihre Habseligkeiten und Manieren, an all das erinnere ich mich. Dass ich schließlich ein kleines Loch fand, eine kleine Mauernische, die noch frei war von Turmbesuchern, und dass ich mich dort einrichtete, um die lange Zeit meines Frühlings, der Jahre dauern sollte, aus diesem Loch heraus zu beobachten. An diese beschwerliche Zeit der Ankünfte und Abreisen, deren einziges Ziel mein immer wiederkehrendes Aufräumen war. Von hier aus hatte ich einen guten Überblick über all das, was auf der Plattform geschah, sah, wie sich die Besucher die Hände schüttelten, wie sie sich niederließen und in die Sonne starrten, bis sie mit rot verbrannten Köpfen und Schultern wieder aufstanden, um zu essen oder zu trinken oder einfach viel zuviel zu reden, um sich mitzuteilen, um den anderen Besuchern ihre Lage zu schildern, sich aber auch gegenseitig auszufragen über Herkunft und Fortgang ihrer Reisen. Sah, wie sie sich erkälteten, weil sie den Frühling bereits mit dem Sommer verwechselten und sich nicht genügend anziehen wollten auf ihren Turmausflügen, die fest in ihren Lebensplänen verankert waren. Ein falsches Wetter und diese Pläne konnten maßlos durchkreuzt werden, sodass die Turmbesucher oft früher schon abreisten als geplant, mit enttäuschten Gesichtern, die aber schnell durch neue, hoffnungsvollere, ersetzt wurden.
So sah ich sie kommen und gehen von meinem Loch aus, von dem ich mich immer wieder erhob, um ihren Unrat wegzuräumen, hinunterzuschütten durch die Gucklöcher oder aber auch in das Innere des Turms, in diese dunkle, undurchschaubare Tiefe unter der Plattform. Sah ihre Maßlosigkeit, mit der ihre Augen über die Zinnen schweiften, hinaus in die Wiesen und Wälder, hinauf zu den Almen und hinunter zu den Rundbögen der kleinen Stadt.
Und während mein Frühling nicht enden wollte, begann für die Turmbesucher schon der Sommer und sie kamen in Badehosen und kleinen zarten Pullovern mit dünnen Trägern, unter denen die Frauen dicke Brüste trugen. Und wieder dauerten die Sommer der Ausflügler nur ein oder zwei Wochen, dann wechselten sie die Badehosen, die Farben ihrer Baumwollhemden und Socken. Wechselten ihre Haarfarben und Rucksäcke. Nur ihre Maßlosigkeit und ihr gieriger Blick blieben. Und wenn ich nicht aufräumen musste, wenn ihre Habseligkeiten für eine Weile eine Ordnung gefunden hatten, dann konnte ich in meine Mauernische kriechen und den Himmel über mir ausmachen. Dieses weite Land, dessen Farbe wechselte, von einem tiefen Blau in ein graues Blau hinüber zu einem dreckig Weiß und manchmal zu einem echten Grau, dessen Niedergeschlagenheit sich dann auch auf die Plattform meines Turms zu legen begann und mich einhüllte in eine warme, allumfassende Nebeldecke, unter der ich schlief.
Und später, als ich aufwachte, war es immer noch Frühling bei mir, waren es immer noch diese meine Jahre, die ich abzusitzen hatte, während die Turmbesucher mit ihren Wanderstöcken schon im Herbst standen, rote Kniestrümpfe in ihren schweren Bergschuhen trugen und ihre fettgeschmierten Gesichter zu den Weinbergen gierten, die den Turm umgaben und in die sie aufbrachen, tagtäglich. Mit von Wein und Höhenluft geröteten Nasen stiegen sie dann abends müde den Turm zur Plattform wieder hinauf, fraßen ihre Mahlzeiten und tranken dann, um all das zu verdauen, ihre Birnen- oder Enzianschnäpse, von denen ihre Nasen noch röter wurden und ihre Zungen redselig und viel sagend, weil das Wetter trocken und schön gewesen war und golden in den Hängen gelegen hatte. So war das Wetter das Wichtigste überhaupt in den Reden der Turmbesucher, und wenn man lange genug zugehört hatte, kannte man all seine Nuancen, seine Feinheiten, aber auch die Grobheiten, die das Wetter mit sich brachte, diese heimtückischen, unvorhergesehenen Seitenhiebe, mit denen es die Turmbesucher immer wieder in helle Aufregung versetzten konnte. So hörte ich denn auch genau hin, um die Wetterlage und damit die Stimmung unter den Menschen auf der Plattform auszumachen, um mich rechtzeitig an die Arbeit zu machen, an all die wetterabhängigen Tätigkeiten, die meinen Frühling nicht enden lassen wollten.
Bei Regen gab es am meisten zu tun, denn die Besucher brauchten Schutz gegen die Nässe und Kälte. Es konnte passieren, dass ich dann oft tagelang nicht in mein Loch zurückkehren konnte, weil ich damit beschäftigt war, all den Menschen Schutz zu geben, Regenschirme über ihre Köpfe zu halten, ihnen Windjacken zu leihen oder aber gut zuzureden, dass der Herbst für sie noch nicht zu Ende sei, dass er noch halten würde ein oder zwei Wochen, je nachdem, wie lange sie es brauchten. Und dass nichts zu spät sei in ihrem Leben, dass morgen wieder die Sonne scheinen könnte auf ihre roten Nasen und auf ihre entblößten Schultern, die sich zu häuten begannen, nachdem der Regen gekommen war, mit dem sie nicht gerechnet hatten, der aber ihre Maßlosigkeit gebrochen hatte und ihre Schultern wieder glatt werden ließ. Ich ermutigte die Turmbesucher zu Ausflügen hinunter in die Stadt, die ich nur aus der Ferne kannte. Erzählte ihnen von Rundbögen und spitzen Kirchtürmen, von Wandmalereien und handgefertigten Altären, von Wasserpromenaden und italienischen Eissalons, von Kurpackungen und Schnitzstuben, die ich durch die Gucklöcher ausgemacht hatte. Beschrieb ihnen den Weg hinunter, den ich durch meine Beobachtungen auswendig kannte, den kürzesten, den sie immer haben wollten, und räumte dann, als ich sie endlich überredet hatte, wieder auf. Ihren Müll und ihre Reste. Vor allem dann, wenn es regnete, weg damit, hinunter in das Innere des Turms, in diese undurchschaubare, alles verschlingende Tiefe.