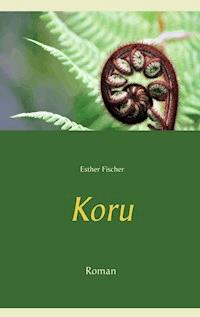
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dorothea, eine kinderlose Anwältin mit liebevollem Ehemann und Kater, meint fest im Leben zu stehen, bis sie nach Neuseeland reist, um ihre verstorbene Tante zu beerdigen. Am andern Ende der Welt entdeckt sie nicht nur ein exotisches Land, sondern entblättert die Biografie einer Frau, die sie mit den tiefen Fragen des Lebens konfrontiert. Ihre Welt droht aus den Fugen zu geraten. Koru (Maori für Spirale) ist die Form eines jungen, sich entfaltenden Silberfarn Blattes. Es symbolisiert ewige Bewegung, Wachstum, Frieden und Kraft, sowie die Rückkehr zum Ausgangspunkt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Esther Fischer, geboren 1964 in Salzburg.
Nach dem Studium der Rechtswissenschaften führten sie die Recherchen für ihre Bücher um die ganze Welt. Sie ließ sich für mehrere Jahre in Neuseeland nieder und vertiefte ihr Wissen in den Bereichen Coaching, Lebensberatung und Psychologie.
Ihre Themen regen Leser zum Reflektieren an und dazu, ihren eigenen Weg zu finden.
Ich kuschelte mich in meinen Kamelhaarmantel. Es war wohlig warm im Auto. Günther hatte das Radio angemacht und wir sprachen nicht. Das war mir auch lieber nach einem anstrengenden Tag bei Gericht.
Eltern, die sich scheiden ließen, zehrten an meiner Energie. Eine Trennung konnte die dunkelsten Seiten eines Menschen hervorbringen und die Realität für Jahre verschieben. Selbst hoch gebildete und intelligente Menschen regredierten zu kleinen gekränkten, wütenden oder trotzigen Kindern. Genkränkt, weil sie nicht mehr um ihrer selbst willen geliebt wurden, zornig diejenigen, deren Erwartungen in der Beziehung unerfüllt geblieben waren, trotzig jene, die Angst hatten, ihre Macht über den anderen zu verlieren. Ihre Kinder dienten oft als verlängerter Arm all dieser Enttäuschungen. An schlechten Tagen hatte ich das Gefühl, dass der gegenseitige Groll und Missmut der Partner bis in mein Innerstes vordrangen.
An Tagen wie diesen dauerte es eine Weile bis ich wieder zu meinen eigenen Gefühlen Günther gegenüber zurückfinden konnte. Und die waren gut und samtig. Ich fühlte mich geborgen neben ihm, dem Mann, der nie aus der Ruhe zu bringen war und immer gut roch, besonders hinter den Ohren. Ich liebte es, meine Nase in seinen Nacken zu bohren und seinen Geruch aufzusaugen. Die Welt schien dann im Lot.
Ich sah aus dem Fenster, auf dem sich die Regentropfen in schrägen Zickzackbahnen nach unten arbeiteten. Im Auto nebenan warf eine junge Frau mit dick getuschten Wimpern ihren Zigarettenstummel durch den kleinen Fensterspalt. Asche fiel dabei nach innen und sie streifte sich ihren schwarzen Pullover ab. Ich stellte mir die raue Stimme der Frau vor, wenn sie sagte „Klar Boss, machen wir.“
„Wie war dein Tag?“ Die sonore Stimme meines Mannes durchbrach das Wattepolster um meinen Kopf. „Ganz ok“, meinte ich, „eine der üblichen Gerichtsverfahren. Mutter und Vater und der Streit um ein dreijähriges Kind. Und wie so oft geht es um alles Mögliche, nur nicht um das Kind.“
Ich hatte keine Kinder, aber ich mochte sie in ihrer Ursprünglichkeit. Ihre Seelen warteten darauf, in ihrer kleinen Ganzheit gesehen zu werden. Man musste ihnen nur in die Augen schauen und sich für das starke Ich dahinter interessieren. Erst prüfen sie mit unsicherem Blick, ob das was vom Erwachsenen kommt, auch echte Aufmerksamkeit ist. Ihr Blick pendelt dann hastig von den Spielsachen zu den eigenen Augen und zurück. Als ob sie sich immer wieder vergewissern wollten, dass die Person hinter diesen Augen wirklich jemand Lebendiger ist. Und wenn sie sich dann dieses Interesses und der Entdeckungsfreude des anderen sicher waren, sprudelte ihr inneres Selbst einfach aus ihnen heraus. Manchmal geschah dies in einer Wildheit, die schwer zu nehmen war. Aber ich hatte Freude daran und das spürten die Mütter. In meinem Büro war eine kleine Spielecke eingerichtet mit Kissen und allerlei Spielzeug und Bilderbüchern. Ich vertrat hauptsächlich Frauen in meiner Anwaltskanzlei. Männer schoben häufig ihre Rechte vor, um nicht über ihre Gefühle sprechen zu müssen. Es war mir zu mühsam, die Aussagen in emotionale Befindlichkeiten zu übersetzen, um sie wieder auf ein juristisches Niveau zu bringen. Ich musste verstehen, wie die Menschen tickten, um sie gut vertreten zu können. Frauen sprachen meist direkt über ihre Kränkungen, über die Untreue des Ex-Mannes, seine Anteilslosigkeit am Familienleben und die Hilflosigkeit gegenüber männlicher Gewalt oder Chauvinismus. Manchen Frauen verrechnete ich einen geringeren Zeitaufwand als tatsächlich geleistet. Auf diese Weise hatte ich das Gefühl, dem Universum meine Dankbarkeit darbringen zu können. Die Gnade, in einer stimmigen Beziehung zu leben, wollte ich dadurch beschwören, dass ich Frauen vertrat, die durch ihre Partnerschaft in ihrem Leben und in ihrer gesamten Existenz erschüttert worden waren.
Heute nach der Gerichtsverhandlung blieb ein zwiespältiges Gefühl, nachdem die Mutter ein absolutes Kontaktverbot des Mädchens zu seinem Vater erwirken wollte.
Ich selbst hätte gerne ein innigeres Verhältnis zu meinem Vater gehabt, der zeitlebens seinem unerreichbaren Berufswunsch nachhing und sich mit fortschreitendem Alter mehr und mehr von der Welt lossagte, bis er unerwartet und früh an Leberkrebs starb. Er hatte nur zwei Monate zwischen der Diagnose und seinem Tod. Ich besuchte ihn jeden Tag. In unserer Vater-Tochter-Beziehung war es die wahrhaftigste Zeit gewesen, wenngleich sie nicht so innig war, wie ich sie mir gewünscht hätte. Der Tod stand zwischen uns und einer bedingungslosen Liebe; keine langen Umarmungen, in denen sich die Herzen aneinander schmiegten, aber ein ehrliches Lächeln, wenn ich die Tür zu seinem Krankenzimmer öffnete. In den letzten Tagen vor seinem Tod küsste ich ihn zur Begrüßung auf die Stirn. Sie war feucht und kalt.
Eine Sache war jedoch anders geworden: wenn er sich etwas wünschte, konnte er es sagen. Das hatte er früher nicht gekonnt. Es waren Dinge, die einfach zu besorgen waren – Rasiercreme oder eine Zeitung. Für seinen Dank und das breite Lächeln hätte ich alles auf mich genommen. Aber immer und überall dieser Geruch von Krankenhaus und Siechtum. Sein Atem roch nach Sterben. Ich redete mir ein, es wäre die Krankenhauskost, warum er so anders roch. Als er auf der Hospizstation lag, konnte ich es nicht ertragen, wenn er regungslos und mit hohlem Blick dalag und ich wünschte mir, dass das alles aufhören sollte. Es hörte auf. Einfach so.
Ein paar Wochen später stand ich vor dem Spiegel im Badezimmer und schnitt eine Grimasse. Und da war dieses Gesicht. Es sah aus wie das meines Vaters, als er im Sterben lag. Es erschreckte mich so sehr, dass ich seitdem vor dem Spiegel keine Miene mehr verziehe.
Nach seinem Tod tröstete ich mich mit der Überzeugung, dass er sich von nun an immer gut um mich kümmert und hinter mir steht. Ich stelle mir vor, dass er mir mit breiter, warmer Hand den Rücken stärkte, wenn ich es brauche. Ich war auch überzeugt, dass er mir als Wiedergutmachung für unsere distanzierte Beziehung meinen Mann geschickt hatte, bei dem ich die Nähe und Geborgenheit fand, die ich bei meinem Vater nicht erleben durfte.
Wie würde es dieser Dreijährigen gehen, wenn sie dreizehn war. Wie würde sie die Männer sehen, wenn ihre Mutter den eigenen Vater zum Monster mutierte. Ich stellte mir das Mädchen mit weißen hochhackigen Schuhen und Push-up BH vor, männerverachtend und verletzt, mit einem Loch in ihrem Selbst. Im besten Fall würde sie die Anteile des Vaters in sich verleugnen, im schlimmsten Fall hassen. Sie würde versuchen, Männer zu begreifen und zu beherrschen, indem sie mit ihren weiblichen Reizen spielte, sie benutzte und wieder ausspuckte, nicht ahnend, dass sie schließlich selbst die Verliererin sein würde.
Es beruhigte mich, dass ein völliges Kontaktverbot ohnehin nicht verhängt werden würde, da der Vater zwar der Mutter gegenüber gewalttätig gewesen war, nicht aber der Tochter gegenüber. Im Sinne meiner Mandantin beantragte ich begleiteten Kontakt in einer Kinderschutzeinrichtung. Der Vater des Mädchens hatte sich selbstbewusst gegeben und hatte der Mutter vorgeworfen, dass sie ihn vorsätzlich und mit plumpen Anschuldigungen an der Ausübung des Kontaktrechtes hinderte. Es war ein Machtspiel zwischen dem Vater, der auf seine Rechte pochte, und der Mutter, die ihre Rache für die Gewalttätigkeiten im Wege der Macht über das Kind ausspielte. „Dafür was du mir angetan hast, wirst du für immer bezahlen“, war ihr Mantra. Die Sorge um die Unversehrtheit der Tochter wurde dabei vorgeschoben und stand wie der Geist aus der Flasche im Raum. In den kommenden Jahren würde sie der Tochter in kleinen wohlportionierten und scheinbar beiläufigen Bemerkungen den Vater madig machen, bis diese ihn genauso verachtete wie sie selbst. Kinder mussten glauben, was ihre Eltern ihnen sagten. Wem sonst könnten sie vertrauen, wenn nicht denen, die sonst auch gut für sie sorgten. Ich hatte es schon so oft miterlebt und es geschah mit unser aller Billigung.
Wie absehbar, endete die Verhandlung mit der Bestellung eines Sachverständigen zur Erstellung eines Gutachtens. Bis zur nächsten Verhandlung würden wohl vier bis fünf Monate vergehen. In dieser Zeit würde der Vater wenig Aussicht hatte, seine Tochter zu sehen. Wie lange war doch ein halbes Jahr für ein Kind, wie viel geschah in diesem Leben, wie schnell war ein Vater vergessen. Bis zur Pubertät, wenn die Suche nach der eigenen Persönlichkeit an diesem Vater nicht vorbeikam. Ich war nicht sicher, ob ich auf unseren Erfolg bei der Verhandlung stolz sein konnte, tröstet mich aber damit, dass meine Mandantin erreicht hatte, was sie anstrebte. Und das war schließlich meine Aufgabe gewesen.
Günther parkte den Wagen vor der Galerie Weltzer. Es kostete mich einige Überwindung, aus dem beheizten Auto auszusteigen. Wir waren zu einer Vernissage eingeladen, wie so oft um diese Jahreszeit, und ich wusste, dass er es gerne hatte, wenn ich ihn begleitete. Ich verstand zwar nicht viel von moderner Kunst, hatte aber das Gefühl dass ich beim Betrachten der Exponate so etwas wie Yoga mit meinem Gehirn betreiben könnte. Es tat gut, das strukturierte und geordnete Denken auf den Kopf zu stellen. Günther liebte es, sich über Kunst im Allgemeinen und Kunstwerke im Speziellen auszutauschen und mit den Künstlern in lange Dialoge zu treten.
Er stieg aus dem Wagen, holte seinen Schirm aus dem Kofferraum und öffnete mir die Tür.
„Günther, ich freue mich, dich zu sehen“, säuselte Karl Löhe, der Galerist und sein kahlgeschorener Kopf glänzte im Licht der Halogenleuchten. Sein Eau de Toilette war zu schwer. „Dorothee. Er zog meinen Namen stets in ein langes E. Das entsprach seinem stetigen Streben nach einem exklusiven und internationalen Publikum. Er deutete links und rechts ein Küsschen auf meinen Wangen an, ohne mich zu berühren.
„Du siehst bezaubernd aus“, floss es zuckersüß in mein Ohr und ich machte meine inneren Schotten dicht. „Darf ich dir gleich Francois Foucet vorstellen?“ Der Galerist nahm Günther am Ellbogen und führte ihn zu einem Mann mittleren Alters mit schwarzen gegelten Locken und einem bodenlangen schwarzen Trenchcoat.
Ich schlenderte den nächstbesten Gang entlang, vorbei an zwei Frauen in Outfits, die den Kunstwerken Konkurrenz zu machen versuchten. Gedämpftes Gemurmel und leises Aufsetzen von High Heels auf Parkett wurde gelegentlich unterbrochen von einem überraschten Ah oder einem zu laut ausgesprochenen Vornamen, wenn Bekannte zufällig aufeinandertrafen. Ich nahm wie immer die Gelegenheit wahr, mich durch das farbenfrohe und formenreiche Buffet zu essen. Besonders das Dekor hatte es mir angetan und ich zog mir manchmal böse Blicke einer Cateringangestellten zu, wenn ich Dinge aß, die lediglich arrangiert waren, um das Bild des Buffets zu vervollständigen. Essen war eine meiner Leidenschaften. Meine Figur war bei Kleidergröße 44 schon lange nicht mehr perfekt, aber mein Mann meinte, er freue sich, so viel Dotti zu haben. Ich machte mir manchmal Sorgen, dass sich meine Kleidergröße, so wie in den letzten Jahren, parallel zu meinem Alter entwickeln würde. Aber wenn ich ab und an auf Essen verzichten musste, fühlte ich mich unausgeglichen.
Während ich mir einen Maischip mit Guacamole in den Mund schob, schnappte ich das Wort Habibti auf, mit dem der dunkelhaarige Mann mit perfekt gepflegtem Bart neben mir seine junge Freundin einhüllte. Seine Hand ruhte wie beiläufig auf ihrem Po. Nahtlos und ohne Spuren eines Slips spannte sich die weiße Hose über ihre Rundungen. Ich liebte dieses Wort und hätte mir gewünscht, dass mein Mann mich manchmal so genannt hätte.
Ich stand gerne an Stehtischen von Buffets, wo man hinhören konnte ohne zuhören zu müssen. Die Anonymität des nebeneinander Essens und Trinkens verpflichtete zu nichts. Ich finde es anstrengend, immerzu kommunizieren zu müssen und irgendwann war mir klar geworden, dass ich eigentlich ein introvertierter Mensch war. Nicht, dass ich nicht mit Menschen kommunizieren konnte oder rhetorisch unbegabt war, aber es war immer schon eine innere Anstrengung für mich gewesen. Ich hatte über die Jahre gelernt, mich extrovertiert zu verhalten. Aber ich war produktiver und kreativer, wenn ich alleine war. Ich brauchte meine Rückzugszeiten, um mich nicht ausgelaugt zu fühlen. Es stört mich nicht, ein ganzes Wochenende auf der Couch zu verbringen, ohne mit irgendjemandem Kontakt zu haben, ganz im Gegenteil.
Als Günther die Tür zu unserer Penthousewohnung öffnete, kam Wuschel, unser Langhaarkater angelaufen. Bevor ich ihn aufhob legte ich meinen schwarzen Mantel ab. Es war mir ein Rätsel, wie sich schwarze Katzenhaare auf schwarzer Kleidung abzeichnen konnten. Ich legte ihn in meinen Arm wie ein Baby. Er war ein außergewöhnlicher Kater, der gegen den Fellstrich gekratzt und am Bauch gekrault werden wollte. Er liebte es, auf dem Rücken zu liegen und ließ es immer gerne zu, wenn ich seinen flauschigen Bauch massierte, auf dem das flauschige Fell kleine Löckchen formte. Günthers Mutter meinte, Menschen würden ihre Finger gerne in Fell wühlen, weil das ihr limbisches Gehirn anspricht. Als ehemalige Psychotherapeutin, die zeitlebens Therapiehunden gehabt hatte, musste sie es wohl wissen. Ich konnte Hunde nicht ausstehen. Sie rochen nach alten Regenschirmen oder getragenen Socken. Aber vielleicht gehörten diese Gerüche ebenfalls zum limbischen Gehirn und machten Hunde deshalb für viele Menschen liebenswert.
Günther machte sich daran, einen Martini zu mixen. Es war ein eingespieltes Ritual. Nachdem wir zusammen ausgegangen waren, nahmen wir noch einen Drink, bevor wir zu Bett gingen. Mehr aus Höflichkeit als aus Interesse fragte ich, wie sein Tag gewesen sei. Ich hörte gerne seiner Stimme zu und ich hatte den Eindruck, dass er seinen Tag gut abschließen konnte, wenn er ihn zusammenfasste. Ich verstand nur wenig von CAD-Software und ihrem Einsatz in der Möbelherstellung. Günther ging völlig in seinem Unternehmen auf und sein erfolgreiches Unternehmen war sein ganzer Stolz.
„Ich denke, wir werden einen neuen, sehr großen Auftrag erhalten. Erinnerst du dich an die Grohmanns? Das Ehepaar, das so wie wir im Urlaub auf Kreta, die erste Nacht in dieser Besenkammer von Hotelzimmer verbringen musste? Sie arbeiten jetzt mit einem finnischen Designer zusammen, der eine ganz neue Esszimmerlinie herausbringt, Stühle, Tische und Schränke.“
Während er von seinem neuesten Auftrag erzählte, zog ich mein dunkelblaues Kostüm aus und hängte es sorgfältig in den mit weichem Licht durchfluteten Schrankraum. Die malvenfarbenen Tapeten und honigfarbenen Regale ließen mich einen süßen Geschmack aus meiner Kindheit abrufen, an den ich mich gerne erinnerte, obwohl ich ihn nicht zuordnen konnte.
Günther umarmte mich von hinten und küsste meine Schläfe bevor er meinen BH öffnete. Es war seit langem ein ungeschriebenes Gesetz, dass wir mittwochs Sex hatten und heute war Mittwoch. Ich konnte seine Erektion spüren, als er sich an mich drückte und meinen BH zu Boden fallen ließ. Er biss mir sanft in die Schulter. Ein leichtes Kribbeln strömte meinen Rücken hinunter. Ohne mich umzudrehen, streifte ich meinen Slip ab und legte mich mit dem Gesicht nach unten auf das Bett. Auch das war ein ungeschriebenes Gesetz Günther mochte es nicht, wenn ich ihn beim Sex ansah. Er konnte dann seine Erektion meist nicht halten. Für mich war sein stoßendes Eindringen von hinten stets erotisch und es verschaffte mir mehr Lust als in anderen Stellungen. So stellte sich ein stilles Übereinkommen ein, das für uns beide befriedigend war. Und dennoch hätte ich mir manchmal gewünscht, er würde mich auf Stirn, Wangen und Mund küssen, mir tief in die Augen schauen und mich zärtlich umarmen. Aber man gewöhnt sich an vieles über die Jahre.
„Was gibt es Neues?“, fragte ich meine Mutter. Ich fragte meine Mutter nie, wie es ihr ging. Dazu standen wir uns nicht nahe genug. Es war leichter, mit ihr über Dinge und entfernte Bekannte zu sprechen. Schon Verwandte waren ein gefährliches Terrain und über Wesentliches in meinem Leben sprach ich schon lange nicht mehr mit ihr. Im Laufe der Jahre war der Umgang mit meiner Mutter immer komplizierter geworden. Ihre schwierigen Charaktereigenschaften hatten sich verstärkt und nahmen immer öfter paranoide Züge an. Ab und an fragt sie mich, ob ich beim letzten Besuch etwas mitgenommen hätte, wenn sie wieder einmal Bettwäsche oder andere Utensilien verlegt hatte. Früher habe ich gekränkt reagierte und mich verteidigt. Inzwischen versuchte ich es mit Humor zu nehmen und einen Scherz darüber zu machen, was mir gelegentlich sogar gelang. Mit anderen Anschuldigungen kam ich wesentlich schlechter zurecht und ich wusste nicht, ob ich jemals die Größe haben würde, meiner Mutter diese Dinge immer wieder nachzusehen und trotzdem für sie da zu sein.
Heute schien sie guter Dinge und plauderte munter drauf los. Mir fiel das Motto meiner Großmutter ein, die immer gesagt hatte: "Arbeit ist auch ein Gebet". Meine Mutter zu besuchen war mein Gebet und es lief immer gleich ab. Wir tranken zusammen Tee und aßen Kuchen, den ich unterwegs gekauft hatte. In letzter Zeit kaufte ich auf ihren Wunsch hin Diättorten, obwohl der Fruchtzucker mir Magengrummeln verursachte. Wir unterhielten uns über belanglose Dinge. Dann spielten wir Karten zusammen, bis ich mich unter einem Vorwand verabschiedete.
„Und, wie läuft es in der Kanzlei?, frage sie wie immer. „Viel los?“
„Ja, wie immer. Es geht so. Ich habe wieder einen Fall von der Verfahrenshilfe zugewiesen bekommen. Ein junges Mädchen aus Tschetschenien, erst neunzehn Jahre alt. Sie hat ihren Mann verlassen, mit dem sie schon beinahe drei Jahre lang verheiratet war.“
Ich wusste, es würde ein schwieriges Verfahren werden. Die junge Frau hatte einen kleinen zweijährigen Sohn, den die Familie des Vaters unbedingt zu sich holen wollte. Es würde viel vom Ausgang des Strafverfahrens gegen die beiden Männer abhängen. Der Schwiegervater und der Ehemann hatten sie regelmäßig verprügelt, doch es würde schwer nachzuweisen sein. Denn selbst als ihr Unterarm gebrochen war, hatte sie im Krankenhaus angegeben, sie sei unglücklich gestürzt. Es würde eine Herausforderung werden, sie davon zu überzeugen in einem Frauenhaus Schutz zu suchen bis die Obsorgefrage geregelt war. Das Mädchen hoffte, dass ihre Herkunftsfamilie die Angelegenheit mit dem Familienclan des Kindesvaters regeln würde. Sie selbst hatte wenig Spielraum in dieser Welt der männlichen Familienoberhäupter. Zu oft hatte ich schon erlebt, wie junge Frauen unter dem Druck ihrer Community zusammenbrachen und sich fügten. Manche zogen sich dann völlig zurück oder tauchten tief in die Religion ein, vielleicht aus dem Wunsch heraus, bei zumindest einem Vater Schutz und Geborgenheit zu finden, auch wenn dieser nicht von dieser Welt war.
Ich hoffte, dass Mutter und ich mit meiner kurzen Bemerkung einen sicheren Konversationsboden finden würden und versuchte mich zu entspannen. Ich mochte mit Mutter nicht über mein Leben und meine Pläne und Wünsche sprechen. Nicht, dass ich welche hatte, aber selbst wenn, hätte ich sie lieber nicht mit ihr geteilt. Obwohl sie nie darüber sprach, wusste ich, dass sie sich gewünscht hätte, Großmutter zu werden. Sie hat mich jedoch nie gefragt, warum Günther und ich keine Kinder hatten.
„Die jungen Leute sollten sich mehr Zeit lassen und sich besser kennen lernen, bevor sie heiraten“, meinte sie. „Früher hatten wir ja nicht einmal die Möglichkeit, mit einem Mann vor der Hochzeit zusammen zu leben. Aber heutzutage kann man das. Da kann man erst mal ausprobieren, wie das ist, wenn man mit einem Mann nicht nur die schönen Stunden teilt. Das Leben miteinander ist ja doch ganz anders als Sonntagausflüge ins Grüne. Die Sorgen, die man hat. Und man ist ja auch nicht immer einer Meinung.“
Ich dachte an das blasse Gesicht der jungen Frau. Meine Mandantin hatte deutlich gemacht, dass sie die Ehe nicht aus Liebe eingegangen war. Die Familie hatte ihr die Verbindung mehr als nur nahe gelegt. Um nicht verstoßen zu werden, hatte sie sich auf die Heirat eingelassen.
„Ach weißt du Mutter, bei manchen Migranten ist es üblich, dass die Familie die Ehe arrangiert“, sagte ich. „Bei uns war das ja bis vor einigen Jahrzehnten nicht anders.“
„Da hast du wohl recht“, meinte sie. „Meine Taufpatin, Mechthild, war, als sie jung war, in den Knecht verliebt, der nichts hatte und nichts war. Als dann ein angesehener Bauernsohn zum Heiraten kam, beschlossen ihre Eltern, dass man sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen konnte. Sie heiratete ihn, obwohl sie vom Knecht schwanger war. Und sie war auch noch so dumm, ihm das zu sagen. Also ich hätte ihm das sicher nicht gestanden wegen der paar Wochen“, meinte meine Mutter bestimmt. „Früher hat man ja innerhalb von zwei oder drei Wochen geheiratet. Ich hätte ihm das Kind einfach untergeschoben. Der Bub hieß Karli. Er wurde von seinem Stiefvater auch nie gut behandelt und musste früh von zu Hause weggehen. Das hat niemandem genützt.“
Mutter liebte es, von der Vergangenheit zu sprechen und ich war froh, dass sie in ihren üblichen Erzählmodus kam. Das war unverfänglich.
„War das zu deiner Zeit auch noch so?“, fragte ich. Ich wusste, dass meine Mutter nicht die Liebe ihres Lebens heiraten konnte. Sie war erst siebzehn, als die Mutter ihres Angebeteten starb. Er musste eine fähige Bäuerin heiraten, um die Wirtschaft fortführen zu können.
„Zu meiner Zeit war es nicht mehr so streng“, erzählte sie. „Ich erinnere mich, kurz nach dem Krieg – ich werde wohl etwa achtzehn Jahre alt gewesen sein – kam der Hellberger Toni zum Heiraten. Die Mutter hat mich getadelt, dass ich in meiner Kammer blieb. Ich habe ihr gesagt, ich werde den bestimmt nicht nehmen. Am nächsten Tag hat mich dann der Vater beim Mähen gefragt, was ich von ihm halte. Und ich habe ihn gefragt: Was hältst du von ihm? Er hat gemeint: ‚So einen wie den Toni bekommst du allemal‘. Damit war die Sache erledigt. Der Vater war ein guter Mann, der mich sehr gern gehabt hat. Aber die Mutter hätte mich bestimmt an den verheiratet. Der Vater hat immer gut auf mich geschaut. Er hat für mich sogar ein Sparbuch angelegt. Nach dem Krieg war es dann aber nichts mehr wert, als wir von Reichsmark auf Schilling gewechselt haben. Da hab ich für das Geld nur mehr ein Paar Schuhe bekommen.“
Ich war müde. Viele der Geschichten hatte ich schon mehrmals gehört, immer mit denselben Worten, immer mit denselben Pointen und immer mit denselben Gefühlen, die sich von Mal zu Mal tiefer in ihr Gesicht eingruben, so als wollte sie sich versichern, dass die Emotionen die richtigen wären.
„Ich werde wohl jetzt aufbrechen müssen. Ich muss morgen früh raus, habe um neun Uhr eine Verhandlung“.
Sie erwartete von mir eine Umarmung und einen Kuss auf die Wange. Sie selbst hob ihre Arme niemals. Es wäre mir auch unangenehm gewesen. „Fahr vorsichtig“, sagte sie. Ich fragte mich, ob es eine Floskel war oder ob sie es wirklich meinte. Manchmal hatte ich den Eindruck, sie sorgte sich zumindest um mein Seelenheil. An Fasttagen fragte sie stets, ob ich Fleisch gegessen hätte. Irgendwann traf mich völlig unerwartet das Gefühl der Rührung. Sie machte sich scheinbar Sorgen, dass ich eines Tages in der Hölle schmoren würde. In all den Jahren hatte ich die Liebe meiner Mutter herbeigesehnt und unverhofft hatte ich dann einen Funken davon an einem Ort entdeckt, an dem ich diese nie vermutet hätte.
Renate empfing mich bereits mit zwei Rückrufnotizen, und das um acht Uhr zehn. „Ach ja, und da ist noch eine E-Mail aus Neuseeland, die Sie vielleicht vor ihrem Termin noch lesen möchten“, sagte sie, während sie eine Akte ins Regal schob.
Ich hängte meinen Mantel in den Schrank und kämmte den Sand in meinen Miniatur-Zen Garten auf dem Schreibtisch. Die Reinigungskraft musste ihn durch Unachtsamkeit durcheinander gebracht haben. Dann setzte ich mich an den Schreibtisch und öffnete meine Mails noch bevor ich einen Blick in meinen Terminkalender warf.
From: [email protected]
Sent: Tuesday, 15th of November 2016, 06:33
Subject: Maria
Dear Ms Rosenberger,
Mein Name ist Patricia Barrett und ich bin die Nachbarin Ihrer Tante Maria. Sie bat mich, Ihnen zu schreiben. Ich habe ihre Adresse im Internet gefunden. Ich hoffe, Sie sind Marias Nichte.
Ihre Tante wurde gestern ins Krankenhaus gebracht. Sie ist gestürzt und hat sich dabei eine Hüfte gebrochen. Ein sofortiger Operationstermin war nicht möglich, da das Hospital überlastet ist. Wir hoffen, dass sie in den nächsten Tagen operiert wird.
Ich werde Ihre Tante täglich im Krankenhaus besuchen und Ihnen in der Folge berichten, sobald es etwas Neues gibt.
Mit freundlichen Grüßen
Patricia Barrett
Ich war beunruhigt. Ich hatte meine Tante seit etwa dreißig Jahre nicht mehr gesehen. In der Vergangenheit hielten wir regelmäßigen Briefkontakt. In den letzten Jahren hatte ich allerdings fast nur mehr telefonischen Kontakt mit ihr. Mit ihren sechsundachtzig Jahren war es Maria zusehends schwer gefallen zu schreiben.
Anders als meine Mutter war Maria eine offene und abenteuerlustige Frau, die ihren Führerschein erst im Alter von mit achtzig Jahren unfreiwillig abgegeben hatte, nachdem sie den Sehtest nicht mehr bestanden hatte. Sie weigerte sich, jemals in ein Altenheim zu gehen, denn sie würde sich nach ihren eigenen Worten unter all diesen alten, gebrechlichen oder dementen Menschen nicht wohl fühlen. Marias Mann war bereits vor zwanzig Jahren gestorben und sie lebte seitdem alleine in einem Haus in Piha, einem kleinen Dorf an der Westküste der Nordinsel Neuseelands.
Als ich ein Kind war, erzählte ich allen, dass ich eine Tante hatte, die am anderen Ende der Welt lebte. Die Postkarten, die von dort kamen waren exotisch. Bunte Briefmarken mit Vögeln oder Schmetterlingen zierten die Umschläge der Briefe. Ich habe sie nach und nach auf meinen Schrank geklebt. Meine Tante hatte mir oft von diesem Land erzählt, in dem alles anders war. Man fahre auf der anderen Straßenseite, der Mond stehe Kopf, zu Weihnachten sei es heiß, wenn es bei mir Nacht war, wäre es dort Tag, und je weiter südlich man fährt, desto kälter würde es.
Zum Geburtstag und zu Weihnachten pflegte Maria ein Paket zu schicken. Als ich ins Teenageralter kam waren es Schecks gewesen, die ich unter den neugierigen Blicken der Bankangestellten einlöste und mich dabei sehr erwachsen fühlte. Wenn ich ihr Fotos und Briefe schickte, antwortete sie oft, wie jung und hübsch ich aussähe und wie gescheit ich wäre. Das hatte mir vorher noch nie jemand gesagt. Ich war immer schon ein pummeliges Kind gewesen, aber irgendwann beschloss ich ihr zumindest zu glauben, dass ich klug war.





























