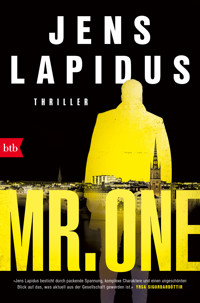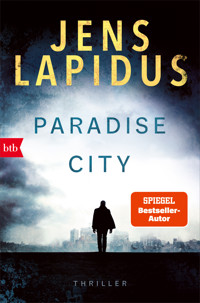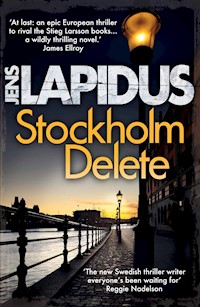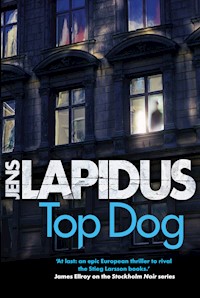12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Stockholm Reihe
- Sprache: Deutsch
Die dunkle Seite Stockholms: Seit Jahren werden junge Mädchen von einem geheimen Täterring missbraucht. Jeder, der droht, die Machenschaften dieses menschenverachtenden Netzwerks aufzudecken, wird gnadenlos eliminiert. Anwältin Emilie vertritt eines der jungen Opfer. Katja ist schwer traumatisiert, stellt sich aber dennoch den quälenden Fragen der Staatsanwaltschaft, um die Peiniger dingfest zu machen. Als Katja brutal niedergemetzelt wird, setzen Emilie und ihr Freund Teddy – ein Ex-Knacki, der sich in der Stockholmer Unterwelt bestens auskennt – alles daran, den Mörder zu finden. Doch sie werden selbst von Jägern zu Gejagten, die mit aller Macht zum Schweigen gebracht werden sollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 758
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zum Buch
Die dunkle Seite Stockholms: Seit Jahren werden junge Mädchen von einem geheimen Täterring missbraucht. Jeder, der droht, die Machenschaften dieses menschenverachtenden Netzwerks aufzudecken, wird gnadenlos eliminiert. Anwältin Emelie vertritt eines der jungen Opfer. Katja ist schwer traumatisiert, stellt sich aber dennoch den quälenden Fragen der Staatsanwaltschaft, um die Peiniger dingfest zu machen. Als Katja brutal niedergemetzelt wird, setzen Emelie und ihr Freund Teddy – ein Ex-Knacki, der sich in der Stockholmer Unterwelt bestens auskennt – alles daran, den Mörder zu finden. Doch sie werden selbst von Jägern zu Gejagten, die mit aller Macht zum Schweigen gebracht werden sollen.
Zum Autor
JENS LAPIDUS, geboren 1974, hat eine der erstaunlichsten Karrieren Schwedens inne. Er ist nicht nur einer der angesehensten Strafverteidiger des Landes, sondern auch einer der erfolgreichsten Autoren. Durch seine anwaltliche Tätigkeit verfügt er über vielfältige Kontakte zu Schwerverbrechern und genuine Einblicke in die schwedische Unterwelt. Seine Bücher wurden in 30 Sprachen übersetzt, vielfach preisgekrönt und mehrfach verfilmt. Nach »Schweigepflicht« ist »Kreuzverhör« der zweite Fall um die junge Anwältin Emelie und den Ex-Kriminellen Teddy.
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »Top dogg« by Wahlström & Widstrand, Stockholm.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Deutsche Erstausgabe August 2021
btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Copyright © 2017 by Jens Lapidus
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2021
by btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, München
Published by Agreement with Salomonsson Agency
Covergestaltung: semper smile, München
nach einem Entwurf von John Vorhees
Covermotiv: Masterflie/Mauritius Images
Autorenfoto: Pierre Björk
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
MK ∙ Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-20377-1V002
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
JENS LAPIDUS
KREUZVERHÖR
THRILLER
Aus dem Schwedischenvon Susanne Dahmann
Svensk Damtidning
Viel feine Gesellschaft auf der Vernissage bei Buchards
Es waren längst nicht nur Prinz Carl Philip und sein Designerfreund Joakim Andersson zugegen, als CoolArt und Buchards zur Vernissage ihrer einzigartigen Kunst einluden. Hier versammelte sich die Stockholmer feine Gesellschaft zusammen mit den Großen der Kunstwelt.
Die Svensk Damtidning bemerkte unter anderem einen neuen Stern am Himmel der Stockholmer Kunstsammler-Szene, den jungen Finanzmann Hugo Pederson mit seiner schönen Ehefrau Louise. Beide sind ungeheuer kunstinteressiert, und obwohl sie erst seit zwei Jahren sammeln, haben sie, so verlauten die Quellen unserer Zeitung, bereits eine ansehnliche Sammlung zeitgenössischer Kunst aufbauen können.
»Seit jeher liebe ich das Zerbrechliche und das Schwierige«, sagt ein fröhlicher Pederson zu unserem Reporter.
Hugo Pederson ist im Investmentunternehmen Fortem aktiv und hat sich binnen kurzer Zeit als Mäzen für eine Reihe Künstler hervorgetan.
»Wenn man das Glück gehabt hat, ein bisschen Geld zu verdienen, dann muss man auch etwas zurückgeben«, erklärt Hugo Pederson, bevor er sich bei Buchards zusammen mit seiner ebenso engagierten Ehefrau wieder unter die Gäste mischt.
Johan W. Lindvall, 2007
PROLOG
Adan schleppte die Aluminiumleiter zur Rückseite des Hauses und sah zum Balkon hinauf. Die Nystadsgatan. Die Wohnung befand sich im ersten Stock – es sollte also kein großes Problem sein, die Leiter aufzuklappen, sie ans Balkongeländer zu lehnen und hochzuklettern. Trotzdem: fuck – er hatte das Gefühl, sich in die Hosen zu scheißen. Und zwar richtig. Er sah es förmlich vor sich: Er selbst ganz oben auf der Leiter mit einem braunen Fleck am Hintern.
Eigentlich hatte er mit diesem Kram Schluss gemacht. Er war neunzehn Jahre und zu alt für kleine Brüche. Mit so was hatten sie sich am Ende der Oberstufe die Zeit vertrieben. Außerdem war das inzwischen unter seiner Würde. Aber was sollte er machen? Wenn Surri was angesagt hatte, dann war das Gesetz.
Sie kannten sich seit dem Kindergarten, hatten im selben Hof gewohnt, in derselben Mannschaft gespielt – ihre Väter waren sogar im alten Land Nachbarn gewesen. »In Bakool kannten wir uns kaum, wir hatten nie mehr Kontakt, als nötig war«, pflegte Adans Vater zu sagen. »Aber hier denken alle, wir sind wie eine Familie, als wären wir ein und dieselbe Person.«
Sein Papa hatte recht und unrecht zugleich: Surri war ein Bruder. Trotzdem benahm er sich wie ein Schwein.
Adan spürte die Kälte des Balkongeländers durch die genoppten Handschuhe. So viel Routine hatte er von früher noch drauf – seine Fingerabdrücke waren nämlich garantiert in irgendeinem alten Register. Er nahm Anlauf, das war viel Körper, was er rüberhieven musste. Er wog sicherlich hundertzehn. Trotzdem hatte er den Schraubenzieher locker in der Hand, und der Griff fühlte sich bequem an – als hätten seine Finger sich danach gesehnt, ihn zu benutzen. Obwohl er inzwischen doch ein normales Leben führte: Er fuhr den Botenwagen für den Chef seines Vaters, aß Popcorn und kuckte abends mit seinem Mädel Luke Cage und Fauda. Aber vor zwei Wochen war die Anfrage reingekommen, ob er ein paar Flocken extra verdienen wollte. Nichts Ungesetzliches, nur ein Tag Arbeit, um der alten Freundschaft willen. Da war man doch dumm, wenn man nein sagte.
Alles war nur die Schuld von den Deutschfotzen. Surri hatte nämlich gefragt, ob Adan nach Hamburg runterfahren und einen BMW aus der neuen 7er-Serie abholen könnte. Eine ganz einfache Win-win-Situation: Da konnte man einen 730d für unter hunderttausend Euro kriegen, und hier verkaufte man den easy für anderthalb Mille. Nur eins musste beachtet werden: Man durfte nicht zu viele Autos pro Jahr auf sich anmelden, denn dann wachte das Finanzamt auf. Und hier kam Adan ins Spiel.
Er war mit dem Zug runter nach Rødby, die einfache Fahrt kostete fünfhundertneunundvierzig Kröten, und er saß die ganze Reise über und hörte Spotify mit seinen neuen Beats-Kopfhörern, hielt die Bauchtasche umklammert, die er von Surri bekommen hatte, und schaute aus dem Fenster. Eine Million Kronen in Euroscheinen wog nichts. Er hatte noch nie zuvor so lange in einem Zug gesessen, aber es war ehrlich naiß. Er konnte sich an der Natur draußen gar nicht sattsehen. Die Landschaft wischte vorbei: überfrorene Äcker, Nadelwald und kleine Dörfer, wo die Menschen rostige Autowracks und alte Planken zu sammeln schienen. Wovon die wohl lebten?
Der Autoschuppen war schnell gefunden, er hatte die Kaufunterlagen unterschrieben und war mit dem Verkaufstypen einig geworden, der sogar ein bisschen Arabisch sprach. Das war zwar nicht Adans Sprache, aber er beherrschte sie gut genug für ein paar nette Worte. Dann war es obersoft gewesen, sich in den schwarzen Ledersitz sinken zu lassen, den Motor zu starten und zur Fähre nach Schweden zurückzubrausen. Dieses Auto sah nicht nur nach Klasse aus, die Qualität war in allen Details zu spüren. Der Geruch von Leder, das Gefühl unter den Fingern, wenn er über das Armaturenbrett fuhr, das Gewicht der Autotüren, das dumpfe Geräusch von Geborgenheit, wenn sie zuschlugen. Surri hatte einfach Stil – sogar seine Kapuzenpullis waren von abgefahrenen französischen Designermarken. Eines Tages würde sich Adan vielleicht auch so ein Auto leisten können. Doch jetzt würde er erst mal den ganzen Abend und die Nacht durchfahren, er wollte den BMW nach Hause bringen, ohne noch mal in einem Motel Halt machen zu müssen.
Auf der Autobahn bei Jönköping hörte er es zum ersten Mal: ein hartnäckig schleifendes Geräusch, das überhaupt nicht gut klang. Drei Kilometer später hielt er den Wagen an. Stieg aus, inspizierte alles, konnte aber nichts sehen. Sowie er wieder losrollte, kehrte das Geräusch zurück. Nach wenigen weiteren Kilometern begann ein Warnlämpchen zu leuchten. Etwas mit den Bremsen. Was bedeutete das? Shit – er wusste nicht mal, ob er weiterfahren konnte. Er nahm das Tempo raus, hinter ihm bildete sich eine Schlange, er fuhr mit siebzig auf einer Straße, wo man hundertzwanzig durfte. Das Auto klang Hölle. Noch ein paar Kilometer weiter bog er auf eine Tankstelle und fragte freundlich, ob der Angestellte mal rauskommen und sein Auto ansehen könne. Der Typ hatte krass viele Pickel und sah fünf Jahre jünger aus als Adan, aber er fing sofort an, mit seiner Taschenlampe hinter die Felgen zu leuchten.
»Ich finde, das sieht aus, als wären Ihre Bremsscheiben irgendwie nicht mehr da«, sagte der Tankwart. »Sie können mit dem Auto keinen Zentimeter mehr fahren. Voll schade um so einen schicken Wagen allerdings.«
Dann nahm das Unheil seinen Lauf: Adan hatte einen Abschleppwagen bezahlen müssen, der das Auto in die nächste Werkstatt brachte. Es dauerte fünf Wochen, es zu reparieren, und kostete vierzig Riesen. Aber wahrscheinlich war auch der Rahmen des Wagens verzogen, sagten sie. Adan rief den Verkäufer in Deutschland an und machte ihn fertig, aber der Alte tat so, als würde er nicht mal mehr Englisch verstehen. Am Ende ließ Surri den Katastrophenwagen schätzen: Er würde gerade mal sechshunderttausend dafür kriegen.
»Wie konntest du so verdammt bekloppt sein, dass du den Wagen nicht untersucht hast, bevor du unterschrieben hast?«
Das Schloss der Balkontür gab mit einem klackenden Geräusch nach. Adan schob sie auf. Surri war deutlich gewesen. »Die Bullen haben unseren Mann, der diese Wohnung gemietet hat, hochgenommen, aber sie haben den Stoff da nicht gefunden. Wenn du also mal in die Wohnung reingehst und das suchst, was mir gehört, dann können wir die Hälfte deiner Schuld streichen. Du weißt ja schon, was ich für das Auto habe berappen müssen.«
Adan wand sich. »Wohnt da jetzt jemand drin?«
»Das kann dir scheißegal sein. Zumindest kommt vor morgen Abend niemand nach Hause.«
Adan erinnerte sich an ein Ereignis von damals, als sie klein waren und auf dem Hof spielten. Surri war vom Klettergerüst gefallen, wie ein kleiner Handschuh, und hatte sich das Knie aufgeschlagen. Es floss ein Schwall von Blut, so kam es ihnen zumindest vor, und in der Wunde saß jede Menge Kies. Sein Kumpel hörte nicht auf zu weinen. »Ich helfe dir. Komm, wir gehen nach Hause zu mir, ich glaub, mein Papa ist da«, sagte Adan, so freundlich er konnte. Sie waren sechs Jahre alt, und Adan wusste, dass sein Papa das Knie von Surri wieder heil machen konnte. Und so kam es auch – Papa reinigte die Wunde und klebte das größte Pflaster drauf, das sie je gesehen hatten. Als sie hinterher Kakao tranken, Kekse aßen und Toy Story auf DVD anschauten, sagte Surri: »Dein Papa ist besser als meiner darin, sich um kleine Krieger zu kümmern.«
Es handelte sich um eine Dreizimmerwohnung mit Küche. Adan schaltete das Licht in dem Raum ein, der wahrscheinlich das Wohnzimmer war. Dort standen ein grünes Stoffsofa, ein Couchtisch mit Glasplatte und ein Bücherregal. Dann war da etwas, das aussah wie eine Art Projektor. In beiden Schlafzimmern schmale, ungemachte Betten. Hier wohnten welche – warum sollten sonst auf dem Couchtisch Zeitungen liegen und ein T-Shirt über dem Stuhl hängen?
Es war allerdings sparsam möbliert, vielleicht war es jemand, der nur ab und zu hier übernachtete. Adan inspizierte den Mülleimer in der Küche, sah auf eine leere Milchtüte herab und vernahm einen Geruch, den er definitiv kannte: die Asche von Gras.
Er schaute Küchenregal und Kühlschrank durch. Wer immer hier wohnte, besaß massenhaft Chipstüten und saure Sahne, aber kein normales Essen. Er sah in den Ofen und die Spülmaschine, legte sich auf den Boden und leuchtete mit seiner Taschenlampe unter die Spüle und hinter den Kühlschrank. Es war staubig.
Manchmal waren die Leute einfallsreich. Trotzdem fand er nichts. Er nahm die Kissen im Sofa beiseite, fühlte mit der Hand unter Laken und Matratzen in den Betten. In dem einen der Schlafzimmer stand eine Tasche auf dem Boden. Er wühlte darin herum – ein paar T-Shirts, vier Paar Unterhosen und Strümpfe. Er stellte sich auf den Couchtisch und leuchtete in den Luftabzug an der Wand. Nichts.
Er fand nichts.
Noch mal das Wohnzimmer. Adan ging auf alle viere und schaute unters Sofa, leuchtete hinter das Bücherregal.
Die Person, die die Wohnung gemietet hatte, musste Surri reingelegt haben – denn hier gab es keinen Stoff. Oder die Bullen hatten das Zeug doch gefunden. Eigentlich war das jetzt nicht mehr Adans Problem, aber das würde Surri natürlich anders sehen.
Plötzlich hörte er etwas. Ein Geräusch aus der Diele.
Nein, es kam von der Galerie vor der Tür. Das waren Stimmen, da draußen.
Noch ehe Adan weiter darüber nachdenken konnte, rasselte es im Schloss. Verdammter FICK aber auch – da war jemand auf dem Weg in die Wohnung. Er schaltete das Licht im Wohnzimmer aus.
Jetzt hörte er Leute in der Diele reden. Die Stimme eines Mädchens und die eines Typen. Vielleicht sollte er einfach raustreten und die beiden zusammenschlagen, egal, wer sie waren. Doch – er war nicht so wie Surri. Er war kein schwererJunge.
Adan kauerte sich hinters Sofa.
Die Stimmen wurden deutlicher. Das Mädchen redete von einer, die Billie hieß. Der Typ murmelte was von einem Fest. »Gleich ist Party.«
Adan lag mucksmäuschenstill, versuchte, sich ganz ruhig zu verhalten. Er sollte nach Hamburg zurückfahren und diesen BMW-Verkäufer mit seinen eigenen Händen erwürgen – alles war nur die Schuld von dem.
Dann hörte er eine Tür zuschlagen, es klang weiter entfernt, so als wäre es die Toilettentür. Vielleicht war das seine Chance. Jetzt war nur noch die Stimme des Mädchens zu hören, sie summte irgendeinen Song. Der Typ war wahrscheinlich auf dem Klo. Es klang, als käme das Mädchen ins Wohnzimmer. Dann wurde es still. Adan hielt die Luft an, versuchte, nur zu lauschen. Leise Schritte. Pustelaute. Dann wieder Schritte, hinaus, zu einem der Schlafzimmer.
Jetzt.
Er stand auf. Das Wohnzimmer war leer. In zwei Riesenschritten war er an der Balkontür. Er dachte nicht mehr, lief auf Autopilot. Handelte einfach. Riss die Tür auf. Sah nicht zurück. Trat auf den Balkon, machte die Tür hinter sich zu. Sog die frische Luft ein.
Sprang übers Geländer.
Warf sich hinunter. Nein, fiel.
Wie Surri vom Klettergerüst.
Die Dunkelheit fühlte sich sicher an, aber es war viel zu kalt draußen. Die Noppenhandschuhe waren dünn wie Papier.
Adan lehnte sich an den Baum. Er versuchte, nicht mit seinem rechten Fuß aufzutreten. Im Fallen hatte er sich ernsthaft verletzt, im schlimmsten Fall war der verdammte Fuß gebrochen. Trotzdem wollte er hier nicht weggehen. Vor ihm auf dem Boden lag die Leiter, er hatte sie mit sich gezerrt, war mit dem Ding über den Schnee gehinkt. Surri würde wahnsinnig vor Wut werden, wenn er hörte, dass Adan nichts gefunden hatte. Aber es musste doch Surris eigener Typ gewesen sein, der ihn reingelegt hatte. Adan hatte ordentlich gesucht.
Seit vier Stunden stand er jetzt hier. Wartete einfach. Hoffte, dass der Schmerz im Fuß nachlassen würde. Die Wohnung war hell. Seltsame Farben erleuchteten die Wände, und Musik dröhnte aus der Balkontür, die ab und zu aufging. Da drinnen waren massenhaft Leute – man konnte sie durch die Fenster erkennen, wie verwischte Backgroundtänzer in einer Talentshow im Fernsehen.
Irgendwann im Laufe des Abends mussten die Idioten, die da drinnen feierten, doch mal abhauen oder sich wenigstens schlafen legen. Irgendwann mussten die Chips und die Dips doch mal alle sein. Dann würde er die Leiter aufstellen, und sich noch einmal reinschleichen. Den ganzen Place noch mal absuchen.
Er konnte hier nicht die ganze Nacht stehen – dazu tat ihm der Fuß zu sehr weh –, aber ein bisschen ging noch.
Er war kein wirklicher Krieger.
Aber warten konnte er.
*
Neunzehn Personen drängten sich in dem kleinen Wohnzimmer, aber sie hatten mindestens noch mal so viele eingeladen. Heute musste es wirklich voll werden, fand Roksana, schließlich war es die Einweihungsparty von ihr und Z. Immerhin ein guter Grund zum Feiern. Die würden doch wohl kommen?
Young-Thug-Rhythmen pulsierten aus der Lautsprecheranlage, die sie von Billie hatte ausleihen können und die Z. direkt mit der SoundCloud auf seinem Telefon verbunden hatte. Thuggy gab alles – seine treu leiernde Stimme zu Reggae-Riddims. Man konnte sich fallen lassen, eintauchen in ein wild funkelndes Meer aus Rhythmen und Lauten. Roksana sah sich um: Gefiel den Leuten der Sound? Hatten sie Spaß? War die Stimmung gut?
Die Leute hatten eigene Getränke mitgebracht. Sektflaschen standen auf dem Couchtisch aufgereiht, darum hatte Roksana in der Einladung ausdrücklich gebeten: Bringt Blubber! Roksana & Z. laden zu Musik, Party und Snacks ein. Sie hoffte nur, dass sie nicht zu übereifrig geklungen hatte.
Die Snacks bestanden hauptsächlich aus Erdnüssen und Chips, aber Roksana hatte Trüffelöl in die saure Sahne geträufelt, und alle sagten, das sei der beste Dip, den sie je zu Chips gegessen hätten. Aber darum ging es eigentlich nicht – wichtig war vor allem die Party, und die wurde von der Musik angeheizt. Von Lautsprechern, Songauswahl, Mix. Sogar eine Nebelmaschine und eine Minilasershow hatte Z. besorgt. Sie hatten es noch nicht geschafft, Bilder oder Plakate aufzuhängen, deshalb war die weiße Fläche die perfekte Leinwand. Und der künstliche Nebel hing wie eine Wolkendecke um das Sofa. Roksana fand, man fühlte sich wie in einem besonders exklusiven Club. Mit dem einzigen Unterschied, dass hier keine DJ-Base stand und dass diejenigen, die jetzt erst kamen, durch eine Diele voller Roshe Runs und Retro-Vans waten mussten. Z. war es wichtig gewesen, dass die Leute die Schuhe ausziehen. »Wenn wir das hier zusammen durchziehen wollen, dann müssen wir den Putzaufwand hinterher so gering wie möglich halten. Weil Putzen ist nervig. Habe ich das schon gesagt?«
Roksana wusste nicht, was Z. gesagt hatte und was nicht. Es war nicht direkt ihr Plan gewesen zusammenzuziehen. Aber es müsste trotzdem zwischen ihnen funktionieren. Er war ein guter Typ.
Roksana checkte Instagram und Snapchat, ob jemand was über das Fest gepostet hatte: Aber nein, dieses Level hatte ihre Veranstaltung bisher noch nicht erreicht. Bitte, liebe Gäste, dachte sie, euch gefällt die Party doch, oder? Könnt ihr nicht ein bisschen tanzen, nur ein bisschen, wenigstens ein paar von euch? Und ein paar Bilder machen?
Die Wohnung war ziemlich groß, zweiundfünfzig Quadratmeter, aber sie lag an der Nystadsgatan in Akalla, weit weg sowohl von der Innenstadt als auch von der Hochschule Södertörn, wo sie studierte. Aber Roksana hatte keine andere Wahl gehabt. Eigentlich hatte sie bei Billie auf der Verkstadgatan am Hornstull zur Untermiete gewohnt, aber dann wurde Billie polyamourös und wollte, dass drei von ihren Partnern gleichzeitig bei ihr wohnten. Den Vorschlag von Z., den Stadtteil in »Hornsfick« umzutaufen, konnte Roksana nicht lustig finden, sie hatte da ganz einfach keinen Platz mehr – zudem hielt sie es nicht aus, dass einer der Typen tagelang in voller Lautstärke Danny Saucedo spielte, ohne das ein bisschen ironisch zu meinen. In derselben Woche war Z. aus seinem Untermietvertrag rausgeflogen. Er hatte daraufhin drei Nächte lang bei seiner Oma auf dem Sofa geschlafen und war nur mehr einen Nanomillimeter von einem seriösen Nervenzusammenbruch entfernt.
Roksana stand mitten zwischen Z. und Billie. Ringsum unterhielten sich die Gäste. Einige wiegten sich tatsächlich ein klein wenig im Takt der Musik. Roksana wollte sie nicht allzu offen beobachten, das wäre zu auffällig. Sie checkte noch mal Insta und Snapchat. Vielleicht fand jemand sie langweilig, weil sie nur mit ihren besten Freunden rumstand, vielleicht fanden ihre besten Freunde sie aber auch voll beige, weil sie nur mit ihnen herumstand.
Sie hatte sich extra die Haare hochgesteckt und trug neue silberfarbene Birkenstocks. Ansonsten ein Paar gewöhnlicher Bluejeans und ein weißes T-Shirt, das sie zu Hause bei ihren Eltern abgegriffen hatte. Billie nölte manchmal, aber Roksana blieb bei ihrem Stil, ihre Vorbilder waren George Costanza und irgendwie alle von Beverly Hills 90210. Sie hielt nichts von flüchtigen Trends und vorgegebenen Modeidealen.
Billie hatte gute Laune, das war schon mal ein gutes Zeichen. Sie trug Adidashosen, ein riesiges langärmeliges T-Shirt, ein Chokerhalsband und eine weiche Gucci-Kappe auf dem rosa gefärbten Haar. Ihre Achselhaare hatte sie auch rosa gefärbt – »um euch zu feiern«, wie sie sagte. Es war nur schwer vorstellbar, dass sie in wenigen Tagen mit dem Jurastudium beginnen würde. Roksana war froh, dass Billie ihre sämtlichen männlichen und weiblichen Liebschaften zu Hause gelassen hatte, dann war sie einfach entspannter. Sie war Roksanas älteste und wahrscheinlich beste Freundin, aber nach dem Chaos in der letzten Zeit wussten sie beide nicht mehr so richtig, wie sie zueinander standen.
Billie zog eine Zigarettenschachtel hervor. »Wie ist das bei euch? Muss ich auf den Balkon, oder ist es okay, wenn ich drinnen rauche?«
Z. sah auf. »Verdammt, hör bloß auf. Zigarettenrauch setzt sich in Gardinen und Bettzeug. Roxy und ich haben das schon besprochen.«
Billie verdrehte die Augen. »Ihr habt ja gar keine Gardinen.«
Z. blieb streng. »Ist egal. Es ist eklig, im Haus zu rauchen.«
»Ah, dann soll das hier also so ein Ort des reinen Lebens werden?«
Roksana lachte. »Schon, auf gewisse Art, wir werden auf jeden Fall ausschließlich plant-based Biolebensmittel haben, du weißt schon, forks-over-knives, und Plastik kommt uns nicht ins Haus.«
Z. holte einen Tabakbeutel und ein Paket Blättchen raus.
»Will jemand eine eigene Tüte? Ich hab jede Menge.« Er hielt den Beutel hin. »Wie man weiß, gibt es bei Marihuana eine heilige Unterscheidungsregel. Trennt zwischen Sativa und Indica. Beide sind Unterarten des Cannabis, aber die Pflanzen sehen unterschiedlich aus, haben unterschiedlich dicke Blätter und so weiter, aber who cares. Entscheidend ist der Effekt: wie Nacht und Tag. Indica ist die Sofapupservariante, der Rausch für alle, die das wollen, eher ein Play-Station-spielen-und-chillen-Gefühl. Aber das hier ist ein vierundzwanzig Monate alter Sativa, das ist mindestens der Châteauneuf-du-Pape des Rauchens, mit Luft nach oben, besser als das geht nicht.«
Mit sorgfältigen Bewegungen verteilte Z. das Gras im Papier des Blättchens. »Man raucht das hier und wird high. Dann raucht man mehr und wird noch higher. Es gibt kein Dach. Ich schwör.«
Das war alles Anfängerbullshit. Der Unterschied zwischen Sativa und Indica war keineswegs immer klar, aber Z. liebte es, Dinge in Worte zu kleiden, zu reden. So einer war er. Es genügte ihm nicht, im Takt mit der Welt zu gehen, er wollte auch bezeichnen können, was geschah, es einkreisen, es in der Terminologie von Kategorien und Strukturen verstehen. Manchmal wurde ein Wettbewerb daraus.
Roksana griff nach dem Joint, den Z. ihr reichte, und nahm einen tiefen Zug. »Bist du jetzt fertig mit deinem Besserwissergeschwafel?«
Sie kicherten, Z. auch. »Ihr kennt mich doch«, sagte er.
Was Z. gut konnte: Er durchschaute patriarchale Strukturen ebenso klar wie Weedprinzipien, er kapierte nicht nur die Muster der Gesellschaft, sondern erkannte auch seinen eigenen Platz in der Machtordnung. Ein Mann, der Frauen Sachen erklärte. Ein Mann, der immer wusste, wie die Dinge standen. Ein Mann, der neunzig Prozent seiner Ausführungen mit »nun ist es aber so, dass …« einleitete.
Die Stunden gingen dahin. Erik Lundin soft gemixt mit Lil B in einem sanften Übergang zu Rihanna – etwas unerwartet, aber shiiiit, die war so gut –, dann etwas, das total anders war und das nur Z. kannte: offensichtlich hießen die Hubbabubbaklubb. Die Leute hüpften auf dem Boden auf und ab, tanzten free-spirit in den Ecken, wippten im Takt der Musik. Z.s kleines Laserspiel malte geometrische Symbole auf die Wände. Leere Plastikbecher und Chipskrümel lagen auf dem Tisch. An anderen Stellen Blättchen und Weinflaschen. Sah sie da nicht sogar ein Röhrchen? Manchmal waren die Leute zu offensichtlich, das war nicht schön.
Aber jetzt mussten sie doch wohl Spaß haben, oder? Roksana checkte zum zweihundertsten Mal ihr Telefon. Der einzige Post war ein Screenshot von Z. mit der Playlist, die er an diesem Abend abspielte, dazu ein Zigaretten-Emoji und der Text smoke w everyday.
Roksana hatte die Nachbarn informiert, das müsste also in Ordnung gehen, Z. und sie hatten ja nicht vor, jedes Wochenende solche Partys zu feiern. Und irgendwie hatte sie das Gefühl, dass David, der Typ, der ihnen diese Bude untervermietete, sich da keinen großen Kopf machte. Der war zufrieden, wenn er sein Geld bekam, obwohl der Geruch von Weed, der wahrscheinlich dick im Treppenhaus hing, schon zu Fragen Anlass geben könnte. Einer der Nachbarn hatte erzählt, dass der Typ, der vorher hier gewohnt hatte, mit der Polizei zu tun hatte. Den hatten sie offenbar festgenommen und nach einer Hausdurchsuchung dann aber die Wohnung wieder David überlassen. Roksana war das egal. David sagte, sie könnten hier so lange bleiben, wie sie wollten. Was juckte sie es, wer die Wohnung zuletzt gemietet hatte und zu welchem Zweck. Entscheidend war nun, dass die Leute fanden, dass sie und Z. alles richtig machten.
Dass dies hier einen guten Start für ihr Minikollektiv mit ihm bedeutete.
Einen guten Start für dieses Semester.
Die Freunde waren abgezogen. Etwas zu früh, war ihr Eindruck. Roksana versuchte, die Gedanken im Kopf zu stoppen: War sie zu klischeehaft gewesen, als sie erzählt hatte, dass sie überlegte, ein Semester nach Berlin zu gehen? War sie nicht schön genug gewesen?
Das Wohnzimmer sah aus wie ein Schlachtfeld. Der Flickenteppich in der Küche war nass. Auf dem Fensterbrett lagen Marihuanablätter. Sie fragte sich, wie Z. das Putzen hinterher wohl überstehen würde.
Billie sagte: »Shit, wie alle so plötzlich verschwunden sind, sogar der Typ, den ich angebaggert habe. Aber viele wollten wahrscheinlich Ida Engberg sehen.«
Z. saß auf dem Sofa. »Ida Engberg ist einfach großartig. Sollen wir auch hinfahren?« Z. war so high von seinem angeblich vierundzwanzig Monate alten Sativa, dass er wahrscheinlich nicht mal gerade stehen konnte.
»Wir müssen hier aber erst mal aufräumen und lüften. Aber wenn du willst, fahr hin. Ist okay für mich«, sagte Roksana.
Billies Pupillen waren so groß wie Monde. »Ich kann dir helfen, den größten Mist aufzuräumen.«
»Wie willst du dann nach Hause kommen? Taxi?«
»Nein.«
»Erste U-Bahn in die Stadt?«
»Nein.«
»Mit dem Kajak?«
Billie lachte.
Roksana öffnete die Balkontür sperrangelweit. Sie fühlte sich nicht mehr betrunken und nur ein bisschen high, trotzdem kam die frische, kalte Luft überraschend – als würde ihr Kopf mit Mineralwasser ausgespült. Sie schaute zu den schattengleichen Bäumen hinaus. Die Wohnung lag im ersten Stock, zum Boden war es nicht besonders weit. Man konnte dort eine dünne Schneedecke erkennen, doch direkt unter dem Balkon sah es so aus, als hätte jemand die Erde aufgewühlt, und sie erkannte Fußstapfen im Schnee, die in die Dunkelheit führten.
Sollte Billie doch nach Hause kommen, wie sie wollte, das ging Roksana nichts an.
»Ich hab gesehen, dass da in der Kleiderkammer ein Klappbett steht. Kann ich hier übernachten?«, fragte Billie.
Roksana drehte sich um. Das Zimmer war wirklich ein einziges Chaos, jemand hatte eine Wasserpfeife umgeworfen, sodass unter dem Glastisch jetzt alles nass war. Dennoch spürte sie, wie ihr Herz höher schlug: Billie wollte hier übernachten.
»Aber musst du nicht nach Haus zu Fia, Pia, Cia, Olle und wie sie alle heißen?«
»Jetzt klingst du ziemlich heteronormativ, finde ich, und faschistisch.«
»War nicht so gemeint. Aber du hast mich schließlich aus deiner Wohnung geworfen. Und jetzt willst du hier pennen.«
»Man muss die herrschenden Normen infrage stellen, und das betrifft auch die Art zu reden. Wörter sind autoritäre Instrumente der Geschlechterhierarchie …« Billie grinste über sich selbst. Ihr Mund war schief, schon immer. »Aber ich bin so müde. Und es ist echt lange her, dass wir zusammen gefrühstückt haben.«
Sie öffneten die Tür zur Kammer. Ein muffiger Geruch schlug Roksana entgegen. Da drinnen gab es keine Lampe, aber Z. schaltete sein Handy ein und ließ den Lichtstrahl über einen Strickmantel und eine Jeansjacke wandern, die Roksana dort hineingehängt hatte. Er fand es auch okay, wenn Billie hier übernachtete.
Irgendwas war komisch mit diesem Raum. Roksana wusste nicht, was es war, aber sie spürte miese Vibes.
»Kann ich mal dein Handy haben?« Roksana leuchtete die Wand an. Bis auf das Klappbett, ihre zwei Kleidungsstücke und ein paar zurückgelassene Bügel, die auf der Stange schaukelten, war die Kammer leer. Eigentlich roch es nicht muffig, sondern mehr nach altem Holz und stickiger Luft. Mit einem Mal begriff sie, warum ihr dieser kleine Raum ein seltsames Gefühl gab. Das hatte nichts mit dem Gras oder den Drinks, die sie sich genehmigt hatte, zu tun. Nein, hier stimmte was nicht. Auf der anderen Seite der Wand befand sich das Badezimmer, aber eigentlich müsste die Kammer größer sein. Die Winkel stimmten nicht. Der Architekt musste völlig zu gewesen sein. Irgendwas war hier falsch konstruiert.
Dann fing sie an zu klopfen. Schon klar, dass sie das nicht getan hätte, wenn sie nicht nüchtern gewesen wäre. Sie klopfte an die innere Wand. Überall klopfte sie, ganz unten, in der Mitte, etwas höher – als würde sie nach irgendeinem versteckten Schatz suchen. Roksana stellte sich auf Zehenspitzen und fühlte mit der Hand ganz oben über die Sperrholzplatte hinter der Garderobenstange. Sie kam mit den Fingerspitzen dahinter. Es knackte.
»Z. hilf mir mal. Ich glaube, diese Wand ist lose.«
Z. schob sich in die Kammer. Billie stand draußen und glotzte.
Z. zugedröhnt, aber groß.
»Zieh ein bisschen«, sagte Roksana.
Z. riss an der Platte. Sie brach raus. Die ganze Wand löste sich und fiel auf sie herunter.
Roksana konnte noch rechtzeitig die Hände nach oben reißen, irgendwie hatte sie damit gerechnet, dass genau das passieren würde.
»Hallo?«, stöhnte Z., der die Platte auf den Kopf bekommen hatte.
Sie schauten in den Raum, der sich nun vor ihnen geöffnet hatte: rechteckig, insgesamt ungefähr einen halben Quadratmeter groß. Da drin standen zwei Kartons.
Jetzt war Roksana völlig nüchtern und konzentriert, die frische Luft von der geöffneten Balkontür zog bis hier rein. Kühl. Klärend. Was war das hier für ein geheimer Raum?
Sie beugte sich hinab und hob den ersten Karton hoch, der ungefähr neunzig Zentimeter breit war.
Z. war jetzt auf den Beinen. »Sind wir hier bei Shurgard, oder was?«
Sie stellte den Karton auf den Wohnzimmerboden. Da konnte man besser sehen. Der Pappkarton war nicht zugeklebt.
Z. beugte sich vor. Auch Billie sah zu. Roksana beugte sich nach unten und klappte die Seiten auf.
Alle starrten auf den Inhalt.
What the fuck?
TEIL I
Januar
1
Das einzig Nette an diesem Termin war, dass es dieselbe Beraterin war, die Teddy geholfen hatte, als er gerade aus dem Knast gekommen war. Sie hieß Isa und sah genauso aus wie letztes Mal. Immer noch um die vierzig, immer noch wie eine Mischung aus Boheme-Södermalmsfrau und glitzeriger Östermalmslady gekleidet. Immer noch Tücher und seltsame Pulswärmer in starken Farben kombiniert mit kleinen Brillantohrringen, die eigentlich gar nicht so klein waren.
»Hallo, Teddy, lang ist’s her«, sagte Isa. Wenn sie lächelte, bekam sie kleine Grübchen in den Wangen. Aus irgendeinem Grund mochte Teddy sie, obwohl ihre einzige Aufgabe war, ihn zum Arbeiten zu bringen.
»Ja, die Zeit rast«, erwiderte er und versuchte, nett zurückzulächeln. Im Grunde war das alles hier nur peinlich.
Schon als er aus dem Knast gekommen war, hatte er nicht erwartet, hier irgendwann sitzen zu müssen, und schon gar nicht jetzt, zwei Jahre später. Er hatte geglaubt, er sei in einem anderen Schweden angekommen, auf einem anderen Niveau. Er war motiviert gewesen, bereit, hart zu arbeiten und dafür Zeit zu investieren. Er hatte sich wirklich verändert: Er war entschlossen, den unbequemen Weg zu nehmen, den ganzen Scheiß hinter sich zu lassen. Aber bereit zu sein war eine Sache – die Veränderung dann auch durchzuziehen eine andere. Die Wirklichkeit rannte ihm schnell davon. In seinem Lebenslauf klaffte ein acht Jahre langes schwarzes Loch, und inzwischen hatte er sich fast an das Misstrauen der Menschen gewöhnt. Aber nur fast.
»Dann gehen wir mal durch, wie die letzten Jahre aus der Jobperspektive so ausgesehen haben«, schlug Isa vor.
»Wo wollen Sie anfangen?«
»Ich weiß, dass Sie einen Job in einer Anwaltskanzlei bekommen haben, stimmt doch, oder?«
Diesen Teil wollte Teddy gern kurz halten. »Ja, ich habe ein paar Aufträge als Sonderermittler für eine Kanzlei namens Leijon angenommen.«
»Sonderermittler? Was heißt das?«
»Das ist nicht so einfach zu erklären. Aber der verantwortliche Teilhaber, Magnus Hassel, nannte mich den Macher.«
Teddy musste daran denken, dass mehrere dieser Jobs in Gewalttätigkeiten geendet hatten und dass er riskiert hatte, der Teddy zu werden, der er nicht mehr sein wollte. Vor mehr als einem Jahr, nach der Geschichte mit Mats Emanuelsson, hatte er den Job bei der Kanzlei quittiert.
Isa fragte nach Gehalt, Arbeitsgewohnheiten und ob er irgendwelche Fortbildungen absolviert habe. »Und nach der Kanzlei?«, fragte sie. »Was haben Sie dann gemacht?«
»Dann war es schwierig. Aber ich hab die KRAMI-Kurse gemacht.«
Isa sah in ihre Akte. Er wusste, dass sie sehen würde, dass er nicht nur alle Kurse und Gruppenaktivitäten von KRAMI mitgemacht hatte, sondern auch mindestens fünf Praktika absolviert hatte, von denen aber keines zu einer Anstellung geführt hatte. KRAMI: eine schöne Mischung aus Arbeitsvermittlung und Rehabilitationsmaßnahme mit dem Ziel, dass Typen wie er – Personen mit einem sogenannten kriminellen Hintergrund – einen Job finden und vor allem behalten würden. Er wusste nicht, warum das bei ihm nie funktionierte.
Isa sprach von Wegweiserkursen und Arbeitsplänen. Ihr Schreibtisch war aus hellem Holz. Der Boden Linoleum, an den Wänden weiße Strukturtapeten, und die Stühle fühlten sich plastikartig an. Hinter ihr war eine Glasscheibe, in der Teddy arbeitende Arbeitsvermittler und sein eigenes vages Spiegelbild sah. Er war groß und fand immer, seine Haare sahen irgendwie unsichtbar aus: braun, halbkurz oder vielleicht auch mittellang.
Außer Isas Ohrringen erinnerte alles in diesem Raum ans Gefängnis. Das hier war kein persönliches Zimmer, es gehörte nicht Isa, sondern war eine Besucherzelle, ein Ort mit Einblick in die Arbeitsvermittlung, aber ohne Fenster zur Wirklichkeit.
Vielleicht wusste Teddy ja auch, wo sein Problem lag. Nach den Jahren in der Anstalt und den Jahren in Freiheit kannte er immer noch keine anderen Menschen als die, die er vorher schon gekannt hatte und mit denen er schon befreundet gewesen war, ehe er einfuhr. Die zu seinem alten Leben gehörten. Er konnte an einer Hand abzählen, wer zu seinem Umkreis zählte: seine Schwester Linda und deren Sohn Nikola. Dejan von früher. Tagg und Loke vom selben Gang. Mit denen fühlte er sich wohl. In deren Gegenwart konnte er er selbst sein. Und dann natürlich Emelie, aber an die wollte er jetzt lieber nicht denken. Wie auch immer, keiner von denen konnte ihm irgendeine Arbeit anbieten. Abgesehen von Dejan vielleicht, aber die Jobs würden dem schwedischen Staat kaum irgendwelche Steuereinkünfte bescheren. Ehrlich gesagt bestand eher die Gefahr, dass sie zu gesteigerten Kosten für Schweden führen würden – in Form einer größeren Belastung der Polizeikräfte, die ermitteln mussten, was Dejan da so trieb.
Vielleicht sollte er mal zu seiner Lage stehen und einsehen, dass er nirgends hineinpasste. Teddy würde niemals ein Teil des Schweden sein, nach dem er sich während der Jahre im Gefängnis so sehr gesehnt hatte. Er würde für immer ein Außenseiter bleiben. Aber das bedeutete nicht, dass er wieder kriminell werden wollte.
»Hören Sie mir zu, Teddy? Sie müssen mir zuhören, sonst kann ich Ihnen nicht helfen.«
Teddy streckte die Beine unter dem Tisch aus, die vom langen Sitzen schon ganz steif waren. »Entschuldigung. Ich musste nur gerade an einen Kumpel von mir denken, der mir vielleicht helfen könnte, einen Job zu finden.«
Es war ein Versuch. Aber was sollte er auch tun? Keiner der Kurse, Praktikumsplätze und Gruppenworkshops hatte zu irgendetwas geführt. Dejan würde ihm sicher helfen, um der alten Freundschaft willen. Isa tippte auf dem Computer, als Teddy von der Baufirma des Freundes erzählte. Dann legte sie den Kopf schief und sah ernst aus.
»Tut mir leid, Teddy, aber ich glaube, das mit Ihrem Freund wird schwierig. Ich möchte nicht verurteilend wirken, aber seine Firma hat nur einen sehr geringen Umsatz, und er hat in den letzten zehn Jahren kein Einkommen versteuert. Ich glaube nicht, dass er Ihnen einen richtigen Job wird anbieten können. Also, jedenfalls keinen, den ich gutheißen kann.«
Isa hatte recht.
Aber gleichzeitig lag sie auch falsch.
2
Sechs Uhr früh war es, und das Kranke war, dass Nikola deshalb nicht völlig fertig war. George Samuel, sein Chef, hatte ein ganz eigenes Smile, bei dem sich das ganze Gesicht um die Augen herum zusammenfaltete. Nikola fragte sich, ob George überhaupt noch etwas sehen konnte, wenn er grinste.
»Guten Morgen, Nicko, weißt du, was wir heute machen werden?«, fragte er, als Nikola das winzige Büro betrat.
Nikola hängte sich den Werkzeuggürtel um. »Jepp. Heute werden wir mit unserem größten Job überhaupt anfangen. Sie reden jetzt schon eine Woche lang von nichts anderem.«
Sie gingen zum Kleinlaster runter: George Samuels Elektroservice stand in schnörkeligen Buchstaben auf der Seite. Der Werkzeuggürtel klapperte. Nikola hatte keine eigene Karre, deshalb schlug er immer erst mal bei seinem Chef auf, und dann fuhren sie zusammen zu den Jobs. Da hatten sie auch immer Zeit, ein bisschen zu quatschen.
Seine Mutter Linda hatte diese Lehrstelle organisiert. Und jetzt arbeitete Nikola wie jeder normale Affe: fünf Tage die Woche. Mit der ersten Sendung des Morgenradios hoch, Mittag gegen halb elf, und noch ehe es im Winter dunkel wurde wieder nach Hause. Manchmal schlief er eine Stunde vorm Abendessen, damit er es überhaupt schaffte, länger als bis neun Uhr aufzubleiben.
Ein unfertiges Shoppingcenter erhob sich aus dem Nichts zwischen Bahnschienen und Landgericht in Flemingsberg und sah aus, als hätte jemand ein Beton-Ei dort vergraben, das nun erste Risse zeigte. Das war wirklich ein Riesenjob. George Samuel war nicht der einzige Elektriker, der beauftragt worden war, aber für ihn plus seinen Lehrling bedeutete das einen Vollzeitauftrag für über zehn Monate. Ein garantierter sicherer Kunde für fast ein Jahr, das war unschätzbar, so viel wusste Nikola.
Sie standen nebeneinander, arbeiteten als Team. Einphasenwechselstrom, Dreiphasenwechselstrom und Verbindungsdosen. Kabel, Sicherungen und Ampere. Nikolas Wortschatz im Elektrosegment war so schnell gewachsen, dass er schon bald mehr stromführende Wörter beherrschte als Slangbegriffe für Drogen. Manchmal fühlte es sich an, als würde der Job mehr bedeuten als das restliche Leben. Aber das war okay – er mochte das, wenn sie nicht gerade weiter hinten den Boden aufrissen: Das Geräusch erinnerte ihn an das Ereignis.
Vor anderthalb Jahren war er auf dem Weg nach Hause zu Teddy gewesen. Als er die Tür zur Wohnung seines Onkels aufmachte, war eine Bombe explodiert und hatte Nikola an die Wand gedrückt. Er hatte sich Verletzungen im Bauch, auf der Brust und an den Händen zugezogen, mit denen er reflexhaft sein Gesicht geschützt hatte. Das bedeutete eine Woche auf der Intensivstation des Krankenhauses und einen Monat Reha. Seine Mutter und Teddy hatten ihn jeden Tag besucht. Nur das Mädchen, mit dem er sich getroffen hatte, Paulina, die hatte mit ihm Schluss gemacht. Aber egal, sie war es ja offensichtlich nicht wert gewesen.
George hatte wie gewöhnlich ein verstaubtes altes Radio auf den Boden gestellt. Sie hörten Radio: Bebe Rexhas aufmüpfige Stimme versprühte wieder und wieder denselben Refrain. Es war, als würde man in einem eigenen Raum arbeiten.
George drehte die Lautstärke runter. »Du weißt ja wohl, dass du nächste Woche deine sechzehnhundert Stunden geschafft hast, oder?«
»Ehrlich?«
»Ja, ehrlich. Du hast sehr gut gearbeitet, Nicko. Die Lehrzeit ist beendet, der Zentrale Elektrikerverband wird dich sofort anerkennen und dir dein Zertifikat ausstellen. Du wirst fertiger Elektriker sein. Was sagst du dazu?«
George Samuel lachte in sich hinein – da wurden seine Augen wieder so ganz schmal, und Nikola konnte nicht anders: Er musste auch laut lachen. Ja, er musste richtig laut lachen. George Samuel: blind vor Lachen – Nikola: bald Elektriker. Das gehörte zusammen. Er würde einen richtigen Job bekommen. Einen richtigen Lohn.
Wer hätte das vor anderthalb Jahren noch gedacht? Als er nach der Explosion auf der Intensiv lag, als Linda vor Sorgen fast vergangen war, weil er auf dem falschen Weg zu sein schien. Wer hätte gedacht, dass das Leben schön sein würde? Wer hätte gedacht, dass es tatsächlich richtig schön sein würde?
Alle waren stolz auf ihn. Teddy, der ihm die Wohnung besorgt hatte, schlug ihm jedes Mal auf die Schulter, wenn sie sich trafen: »Nicko, wie gut, dass du nicht in meine Fußstapfen trittst.« Sein Opa Bojan versuchte immer noch, ihn mit in die Kirche zu schleppen, aber lächelte nur noch, wenn Nikola sich weigerte. »Du bist ja doch auf dem richtigen Weg, moje malo zlato. Deine Großmutter hätte geweint vor Glück.« Und sogar der Leiter des Heims für straffällige Jugendliche in Spillersboda hatte angerufen, um ihm zu seinem neuen Leben zu gratulieren – gerade so, als hätte Nikola drei gleiche Eine-Million-Bilder von einem Rubbellos gekratzt.
Doch am glücklichsten von allen war Mama Linda.
»Weißt du, was ich so schön finde?«, hatte sie irgendwann im Frühjahr gefragt, als er immer noch in die Abendschule ging und ihr seine Noten vorgelesen hatte. Da machten sie gerade einen Spaziergang entlang des Kanals, und Nikola sah rüber zum Zentrum von Södertälje. Die Vögel zwitscherten wie verrückt, und auf dem Kiesweg lag Hundekacke.
»Dass ich mit meinem alten Leben gebrochen habe?«, versuchte er.
»Nein, eigentlich nicht. Das Schönste ist, dass Veränderung möglich ist. Du weißt ja, dass ich mir Sorgen gemacht habe, als du in Spillersboda gesessen hast, und noch mehr, als du festgenommen worden bist, und dann nach der Explosion. Aber jetzt ist es bewiesen. Menschen können sich ändern.«
Linda war solariumgebräunt und trug Ray-Bans die ihr halbes Gesicht verdeckten, aber Nikola konnte an ihrer bebenden Stimme hören, dass da hinter der Sonnenbrille eine Träne kullerte.
»Weißt du, Nicko, du musst nie wieder denken, dass du jemand werden musst, dass du auf Status und solche Sachen aus sein musst«, sagte seine Mutter und machte eine Kunstpause. »Denn du bist ja schon wer.«
Sie blieben an einer Parkbank stehen. Nikola wandte sich ihr zu. Sie trug einen Houdinifleece und eine Art Wanderhose – das passte alles nicht mit der Sonnenbräune und der Brille zusammen. Körper: Freiluft-Spießertraining. Kopf: MILF-Alarm in der Stadt. Ach was, streich das Letzte, so denkt man doch nicht von seiner Mutter.
Der Boden unter der Bank war voller Schalen. Albuzur – Sonnenblumenkerne. Die mochte Nikola selbst sehr gerne. Hier hatte vor ihnen jemand gesessen und lange philosophiert. Nikola setzte sich. »Nächsten Donnerstag habe ich Schwedischprüfung und soll dafür einen Aufsatz abliefern.«
»Spannend. Worum geht es?«
»Der Graf von Monte Christo. Hast du das gelesen?«
»Nein.«
»Eines der Lieblingsbücher von Opa Bojan, wusstest du das?«
»Das kann ich mir vorstellen. Der ist ja ein großer Leser. Aber es wird gut werden, das weiß ich.«
Nikola musste wieder an seinen Opa denken. Der Bücherwurm, die krasseste Leseratte aus Belgrad, der Nikola, als der sechs Jahre alt war, in die magische Welt der Bücher entführt hatte, an seinem Bett saß und sich durch alte Schmöker arbeitete. Die Schatzinsel, Zwanzigtausend Meilen unter dem Meer, Die geheimnisvolle Insel.
Und gleichzeitig hatte Opa Bojan seinen Onkel Teddy großgezogen – seinerzeit eine Gangsterlegende von Süd-Stockholm. Das kriegte Nikola nicht zusammen.
Chamons Audi A7 stand zwischen den Baumaschinen vor dem halb fertigen Einkaufszentrum. Wie immer: Die Knöllchensammlung seines Kumpels war dicker als die Geldscheinbündel von Pablo Escobar. Aber das war Chamon scheißegal – das Auto war nicht auf ihn gemeldet. Das machte man immer so. Vorsprung durch Technik – oder, wie Chamon zu sagen pflegte: »Vorsprung durch Babso« – so hieß der Typ, der auf den Fahrzeugscheinen von mehr als vierhundert Autos in Södertälje stand.
Es war Donnerstag, aber Nikola würde morgen nicht arbeiten. Mit anderen Worten: Jetzt war Wochenende. George Samuel war einverstanden gewesen, ihn schon um drei Uhr ziehen zu lassen. Am Montag würden sie sich wie immer sehen.
Chamon startete den Wagen. »Hast du gehört, dass Audi ein neues krasses Modell rausbringt, Q8?«
»Yes, hab davon gelesen. Mit V8-Motor. Aber wolltest du dir nicht den neuen Lexus holen, den LS?«
Chamon starrte ihn an. »Machst du Witze, oder was? Ich bin von Södertälje. Ich fahr nur deutsch.«
Es lief offensichtlich gut für Chamon, und das Auto war immer der heftigste Beweis. Dann kam die Uhr, dann der übrige Schmuck, dann wo man Urlaub machte. Nur wie man wohnte, da gaben die Leute einen Scheiß drauf. Sie sprachen niemals darüber, wo Chamon seinen Schotter herhatte – auch wenn Nikola wusste, dass er kreidebleichen Innenstadthipstern in ihren übertriebenen Raveclubs Präparate verkaufte. Nicht einmal mit seinem besten Freund redete man über sowas – und schon gar nicht, wenn man nicht selbst ein Teil des Lebens war. Manchmal sehnte sich Nikola danach: zurück zu dem, was er gehabt hatte. Zurück zu der Freiheit. Dem Unkontrollierten.
Sie fuhren zu ihm nach Hause, zogen sich zum zweiten Mal ein paar Folgen von Narcos rein: liebten es, wenn Escobar die Kokainfabriken in Medellín checkte. Dann gingen sie runter und kauften sich einen Kebab. Chamon holte ein paar Gramm Gras raus, die sie in Nikolas Shisha rauchten – Nikola brauchte diese gechillten Momente: Auch wenn er es nicht richtig benennen konnte, war in ihm doch irgendwas passiert, seit die Explosion ihn durchgeschüttelt hatte.
Chamon und er kicherten. Hörten Musik. Ließen sich aufs Sofa fallen und redeten einfach.
Nach ein paar Stunden sah Chamon auf. »Nicko, glaubst du an Gott?«
»Nee, eigentlich nicht.« Das hier war echter Chamon-Softschnack. »Ich glaube an das Schicksal. Und meinen Dachri.«
Chamon lachte nicht. »Glaubst du nun an Gott, oder nicht?«
»Shit, also, Bratan, ich weiß nicht.«
Chamon nahm einen Zug aus der Pfeife, dann küsste er das fette Goldkreuz, das an der noch fetteren Kette um seinen Hals hing. »Ich glaube.«
»Und warum?«
Die Augen des Kumpels wurden feucht. »Weil es was anderes geben muss als das hier.«
»Als was?«
»Bratan, ich mach nachts kein Auge zu. Einmal die Viertelstunde steh ich auf und checke hinter der Gardine, was draußen ist. Hör ich hinter mir auf der Straße ein Geräusch, schmeiß ich mich auf die Erde. Wenn ich ein unbekanntes Auto auf dem Parkplatz sehe, krieg ich Bauchschmerzen. Verdammte Scheiße, ich bekomm noch ein Magengeschwür.«
»Aber du bist doch frei. Du musst nicht wie ich jeden Tag um fünf Uhr aufstehen.«
»Ja, zum Teufel, vielleicht hast du es gar nicht so schlecht. Ist schwer zu erklären, aber manchmal glaub ich, ich kann nicht mehr, ich bin die Scheiße leid, hab keine Power mehr. Weißt du, wie viele hier in den letzten Jahren umgebracht worden sind? Weißt du, wie viele Brüder verschwunden sind? Und die das bestimmen, die scheißen einfach drauf. All die verdammten Huren, verstehst du? Ich würd gern irgendwann was anderes machen. Reisen oder so. Oder Musik. Verstehst du?«
»Musik?« Nikola erkannte seinen Kumpel nicht wieder: Ich würd gern irgendwann was anderes machen – das klang mehr wie das Gelaber seiner Mutter als nach Chamon.
»Also, ich würd gern ein Instrument lernen. Ne Weile lang hab ich Fußball gespielt, aber meine Mom hat immer gesagt, dass ich eigentlich den Kopf für Musik hab, wenn ich eine Melodie gehört hab, dann konnte ich die perfekt nachsingen. Sie hat gesagt, ich bin musikalistisch oder wie zum Teufel das heißt. Aber fuck, jetzt pfeifen mir die Zivilbullen und die ganzen Singvögel im Kopf herum, sodass ich da drin nix mehr höre. Bald gibt’s nichts mehr von mir. Nicht mal naiße tunes.«
Nikola versuchte rauszukriegen, wie ernst dieses Gerede war. Er dachte an George Samuel und dass das Anstrengendste, was er heute gemacht hatte, war, vier Kabel in ein PVC-Rohr zu friemeln.
Und Nikola wusste: Er hatte die richtige Wahl getroffen. Bald Elektriker.
Das Leben war nichts für ihn.
3
Emelie erhob sich, strich die Falten ihrer Anzughose glatt und ging hinaus, um Marcus zu empfangen. Anneli, die Sekretärin, die für sie und die anderen Anwälte zuständig war, hatte ihn bereits per Knopfdruck durch das Gittertor unten hereingelassen. Wenn Marcus die Treppe hochstieg, müsste er ungefähr in sieben Sekunden an der Tür klingeln. Sollte er stattdessen den Aufzug wählen, würde es noch ein paar Sekunden länger dauern. Das war ein kleiner Lackmustest, der erste, dem Marcus unterworfen wurde. Emelie hatte es sich persönlich zum Prinzip gemacht, immer die Treppe zu nehmen, ganz gleich, wie schwer die Akten in ihrer Tasche wogen. Allerdings spielte das alles eigentlich keine Rolle, denn sie hatte ihm bereits die Anstellung auf Probe als Anwalt bei ihr angeboten. Fraglos ein großer Schritt. Emelie betrieb erst seit knapp anderthalb Jahren ihr eigenes Unternehmen, doch die Fälle strömten deutlich besser herein, als sie erwartet hatte. Sie schaffte es nicht mehr, alle Aufträge selbst zu bearbeiten, was ein Luxus war. Und doch auch ein ungeheures Risiko – von heute an war sie nicht mehr nur für ihr eigenes Einkommen verantwortlich. Die Anwaltskanzlei Emelie Jansson musste jeden Monat genügend Geld einbringen, um ein weiteres Gehalt zu decken, und zwar eines, das Vorrang vor ihrem eigenen hatte. Der Fluch des Kleinunternehmers, dachte sie. Wenn Marcus krank wurde, dem Job nicht gewachsen war oder es ganz simpel nicht hinbekam, ordentliche Rechnungen zu schreiben, dann würde die Firma darunter leiden und vielleicht sogar nicht überleben. Dann wäre ihr Traum geplatzt. Doch sie brauchte jemanden, der sie entlastete, das war einfach ein Muss – sie hatte zu viel zu tun.
Marcus war lang und groß, trug einen schmalen, gepflegten Bart, und als sie einander die Hände schüttelten, bemerkte Emelie, dass er gut roch. Offenbar hatte er die Treppe genommen. Einen kurzen Augenblick dachte sie, dass er vielleicht eine Umarmung von ihr erwartete, doch sie war seine Chefin und Arbeitgeberin, auch wenn sie nur ein paar wenige Jahre trennten. Außerdem war sie niemand, der gerne umarmte.
»Willkommen. Wie schön, dass Sie heute schon anfangen konnten.«
Marcus trug einen dunkelblauen Anzug, dessen Hosenbeine Hochwasser hatten, aber das war ja gerade in Mode. Der oberste Hemdenknopf war offen, und er hatte keinen Schlips, was okay war, da er heute nicht ins Gericht musste. Er würde sich in der nächsten Zeit schon in alles einfinden. Seine Art, sich zu bewegen, erinnerte sie irgendwie an Teddy: ruhig und zielgerichtet.
»Wir können in mein Zimmer gehen«, sagte Emelie. »Möchten Sie etwas zu trinken?«
Sie hatte Anneli gebeten, für frischen Kaffee aus der Maschine und ein paar Flaschen Sprudel im Kühlschrank zu sorgen.
»Danke, haben Sie vielleicht koffeinfreien Tee?«, fragte Marcus.
Koffeinfreien Tee, auch das noch, dachte Emelie, das war ein wenig untypisch für einen Anwalt – obwohl wahrscheinlich auch das gerade in Mode war. Sie wandte sich Amelie zu und gab die Frage weiter.
»Na ja, also ausgerechnet Koffeinfreies ist heute leider etwas knapp«, stellte die Sekretärin mit einem schiefen Lächeln fest. Das Einzige, was Emelie und die anderen Anwälte hier tranken, war Kaffee, Kaffee und nochmals Kaffee.
Sie setzten sich in Emelies Zimmer. An der Wand hing ein gerahmter Mark Rothko. Das war natürlich nur ein Plakat, ein dumpfrotes Farbfeld, das in ein braunes Farbfeld überging, das in etwas Gelbliches überging. Emelie mochte es, der Raum bekam dadurch eine Ruhe, auch wenn die Tatsache, dass es sich nur um ein Plakat handelte, sie an ihren früheren Arbeitsplatz, die Kanzlei Leijon erinnerte. Der Teilhaber, dem sie dort unterstand, Magnus Hassel, sammelte internationale Kunst, und in seinem Zimmer hatten sowohl Warhol- als auch Karin-Mamma-Andersson-Bilder gehangen, und das neben Werken von Giacometti und Bror Hjorth. Doch das war jetzt Geschichte. Sie hatte bei Leijon gekündigt, weil das Unternehmen nicht damit einverstanden gewesen war, dass sie die Verteidigung in einem Strafrechtsfall übernommen hatte. Dann hatte sie getan, was in der Welt der Rechtsanwälte als ein riesenhafter Schritt betrachtet wurde: von der Anstellung in einer der vornehmsten Geschäftskanzleien Europas zu einem Zimmer und einem Viertel Sekretariat in einer Bürogemeinschaft mit drei alten Strafrechtlern. Die ehemaligen Kollegen bei Leijon zogen die Augenbrauen hoch. Ein Rückschritt, der verzweifelte Fall aus der A-Elite auf das D-Niveau. Sie hätte ja wohl wenigstens eine Anstellung bei einer renommierten Kanzlei suchen oder bei Gericht oder in der Staatsanwaltschaft anfangen können, wenn sie sich nun schon mit so etwas wie Strafrecht abgeben wollte. Nur passte das Emelie einfach nicht – sie wollte es alleine schaffen, das war ihr wichtig. Sie hatte die Nase voll von Chefs, die sich einmischten. Und sie wusste, dass sie eine der Besten werden konnte.
Marcus stellte seine Tasche aus dunkelgrüner Leinwand ab, die sehr schick aussah. Eigentlich wusste sie nichts über ihn, außer dass er das Gymnasium in Kärrtorp besucht hatte und mittlerweile auf Södermalm wohnte. Das Gehalt, das sie ihm bot, lag einen Tausender unter dem, was er in der kleinen Familienrechtskanzlei bekommen hatte, in der er zuvor angestellt gewesen war – dass er sich darauf eingelassen hatte, war an sich schon ein Beweis für sein commitment. Und wenn er so gut war, wie sie hoffte, dann würde er ja bald Provision bekommen.
»So«, sagte sie und schob ihm einen Laptop zu. »Das hier ist Ihr Rechner, Sie müssen sich ein Passwort und so weiter anlegen. Ihr Büro ist nebenan, ich habe Schreibtisch und Stuhl für Sie bestellt, aber die werden erst nächste Woche geliefert. Tut mir leid, aber heute müssen Sie hier drinnen bei mir sitzen. Ich hoffe, das ist okay.«
»Absolut, aber könnten wir vielleicht die Lampe ausschalten?«
Emelie sah auf. Jetzt verstand sie ihn nicht wirklich.
»Also, ich bin Elektroallergiker. Ich vertrage keine Elektrizität. Am liebsten arbeite ich im Kerzenschein oder mit einer Petroleumlampe und sehr gerne mit Papier und Stift anstelle eines Computers.«
Emelie starrte den jungen Anwalt an, der da vor ihr saß. Sie hatte sich direkt nach dem Vorstellungsgespräch für Marcus Engvall entschieden. Er hatte beste Noten von der Station im Gericht, schöne Referenzen von seinem früheren Arbeitgeber, und er brannte für Strafrecht. Außerdem schien er Humor zu besitzen, eine nette Art und die nötige Portion Mut – die erstgenannten Charakterzüge waren wichtig für die Klienten, Letzteres war unabdingbar für den Beruf insgesamt. Mut – davon sprachen nicht viele, doch war es die wichtigste Eigenschaft des Verteidigers. Und jetzt das: Schon bei dem koffeinfreien Tee hätte sie hellhörig werden müssen. Was ging hier vor? Elektroallergiker? Das gab es doch gar nicht.
Marcus grinste und zwinkerte ihr zu. »Das war ein Witz. Ich sitze gern hier in Ihrem Zimmer. Und das Licht darf auch anbleiben.«
Er legte ein Handy mit Spider-App auf den Tisch. »Und ich habe auch nichts gegen elektronische Dinge, im Gegenteil, ich bin ein bisschen ein Gadgetfreak.«
Emelie lachte. Auch Marcus lachte laut. Er hatte eben doch Humor.
Tatsächlich war der Kontakt zu Marcus vor einigen Monaten über Magnus Hassel gekommen. Emelie saß im Pocket City und wartete auf Josephine, die immer noch bei Leijon arbeitete, als sie plötzlich ihren Namen hörte. Sie drehte sich um und erkannte, dass zwei ihrer ehemaligen Chefs am Nebentisch saßen. Magnus Hassel und Anders Henriksson. Wie hatte sie die übersehen können? Als sie noch in der Kanzlei Leijon war, hatte sie mit eben diesen beiden ihre jährlichen Entwicklungsgespräche geführt, eine Tradition, die sie nicht wirklich vermisste. Sie erinnerte sich gut an die beiden.
Anders Henriksson war ein fünfzigjähriger Meganerd, der in zweiter Ehe mit einer siebenundzwanzigjährigen Sekretärin verheiratet war und so tat, als wäre er dreißig, aber dennoch meinte, Zara Larsson sei eine spanische Billigkleidermarke. Gleichzeitig war er einer der absolut führenden Experten Schwedens in Mergers & Acquisitions. Im Legal 500 – der Rangliste, die bei Leijon von größerer Wichtigkeit war als der Ausgang der Reichstagswahl – wurde er als ein Leading Individual geführt, und das Zitat lautete A brilliant analyst – creative and authoritative. Emelie hatte immer gefunden, dass er rein IQ-mäßig sicher brillant war, doch was den sogenannten EQ betraf, musste man doch von einem äußerst verbesserungswürdigen Zustand sprechen.
Magnus Hassel auf der anderen Seite hatte nie eine besondere Präsentation gebraucht. Alle in der Welt der Wirtschaftsjuristen kannten ihn. Das Zitat über Magnus war seit vielen Jahren konstant. The clearest shining M&A star in Sweden und Incredibly impressive waren die Urteile, die mit der Zeit ebenso solide geworden waren wie die Finanzlage des Teilhabers. Laut Dagens Industri hatte Magnus Hassel allein im vorigen Jahr fünfundzwanzig Millionen Kronen Ausschüttung bezogen.
Doch das alles gehörte zu ihrem alten Leben. Emelie hatte eine neue Arena betreten. Weit entfernt von protzigen Büros, milliardenschweren Klienten und exotischen Jurisdiktionen. Und mit nur halb so viel Gehalt.
Magnus war es gewesen, der sie genötigt hatte, zu kündigen. Und Magnus war auch bei der Gerichtsverhandlung gegen Benjamin Emanuelsson, den sie verteidigt hatte, aufgetaucht und hatte einen ganzen Tag auf einem Zuhörerplatz gesessen und das Geschehen verfolgt. Sie müsste ihn eigentlich hassen. Dennoch wusste sie, dass er große Stücke auf sie hielt und dass er wirklich versucht hatte, sie zum Umdenken zu bewegen und sie in der Kanzlei Leijon zu halten. Emelie konnte nicht durch und durch schlecht von Magnus Hassel denken. Nur zu achtundneunzig Prozent.
»Und ich dachte, Sie würden sich nicht mehr in diesen Breiten aufhalten«, hatte Magnus gesagt. Er war leger gekleidet: grünes Tweedjackett, Jeans und rosa Hemd. Jeans – Emelie konnte sich nicht erinnern, ihn während ihrer drei Jahre bei Leijon jemals in etwas so Sportlichem gesehen zu haben. »Ich dachte, Leuten wie Ihnen begegnet man ausschließlich auf Kungsholmen und in den Satelliten.«
Im Grunde genommen hatte er recht. Die meisten Verteidiger in Stockholm hatten ihre Büros auf Kungsholmen. Die Nähe zum Oberlandesgericht, zum Polizeihaus und zum Untersuchungsgefängnis Kronobergshäktet machten dies zum selbstverständlichen Stadtteil für alle, die zu Fuß zu Besuchen, Vernehmungen und Verhandlungen spazierten. Die restliche Zeit verbrachte sie oft draußen im Amtsgericht Södertörn und im Gefängnis Huddinge oder im Amtsgericht Attunda und dem Gefängnis Sollentuna.
Die »Satelliten«, wie Magnus die nahe gelegenen Vororte zu nennen beliebte, ließen Emelie an das ehemalige Osteuropa denken. Die Satellitenstaaten, die Vasallen der Sowjetunion.
»Ich bin mit Jossan verabredet«, erklärte Emelie, »und die bewegt sich nur ungern aus diesem Bezirk heraus.«
Magnus lachte. Anders Henriksson hingegen verzog keine Miene. Emelie musste an sein hochrotes Gesicht denken, als er und Magnus sie zum ersten Mal damit konfrontierten, dass sie sich herausgenommen hatte, Emanuelsson zu verteidigen.
»Ich höre, es läuft gut für Sie«, sagte Magnus und erhob sein Weinglas, um ihr zuzuprosten.
»Ja, ich habe wirklich viel zu tun. Ich sollte einen Assistenten einstellen.«
»Da können Sie sich ja freuen. Aber wahrscheinlich sind Sie immer noch nicht in derselben Gehaltsklasse gelandet wie bei uns, oder?«
Emelie fragte sich, ob er sie nur freundschaftlich neckte oder wirklich zu provozieren versuchte. Sie erhob ihr noch leeres Glas in seine Richtung. »Es ist einfach teuer, an der Spitze zu liegen.«
Die Gesichtsfarbe von Anders Henriksson verdunkelte sich bei ihrem letzten Kommentar, doch Magnus kicherte nur.
»Übrigens«, sagte er und beugte sich vor, »ich glaube, ich hätte jemanden, der ausgezeichnet zu Ihnen passen würde. Er hat sich vorige Woche bei uns beworben, ist frisch gebackener Anwalt, hat im Gericht gesessen und scheint schlau zu sein und hart zu arbeiten, so wie Sie.«
»Warum haben Sie ihn nicht genommen, Sie lieben doch Workaholics.«
Magnus beugte sich noch weiter vor, sodass sein Mund fast Emelies Ohr berührte. »Er hat davon gesprochen, dass er für die Rechte des Individuums einstehen wolle und ein System befürwortet, das alle unterstützt. Tatsächlich klang er auf besorgniserregende Weise ähnlich wie Sie. Außerdem ist er Veganer, und Menschen, die keine toten Dinge essen wollen, sollte man nie vertrauen.«
Emelie zog den Kopf zurück und sah Magnus Hassel forschend an. Seine Augen glitzerten.
Emelie antwortete: »Sagen Sie ihm, dass er sich bei mir bewerben soll.«
Anneli rief an. »Ich habe eine total verzweifelte Frau in der Leitung, die Sie sprechen will.«
»Spreche ich mit Emelie Jansson?«, fragte eine helle Stimme am anderen Ende.
»Ja, Sie sprechen mit mir.«
»Gut. Sehr gut. Ich heiße Katja und muss Sie treffen. Heute.«
Emelie lehnte sich in ihrem Stuhl zurück. Marcus saß ihr schweigend gegenüber und machte mit seinem Rechner herum.
Alle fanden immer, dass ihr Anliegen besonders eilig war. Das war vielleicht nicht verwunderlich – wenn man eines Verbrechens verdächtigt oder Gewalt ausgesetzt war, dann erlebte das jeder ausnahmslos als traumatisch und als eine Sache, die man sofort angehen wollte.
»Heute bin ich beschäftigt, denn mein neuer Anwalt hat gerade angefangen. Hätten Sie nächste Woche Zeit?«
»Nein, nein. Wir müssen uns sofort treffen. Für Warten ist keine Zeit.«
»Darf ich fragen, worum es geht?«
In der Leitung wurde es still.
Emelie wiederholte ihre Frage. »Worum geht es?«
Sie hörte, wie die Frau namens Katja tief Luft holte. Als sie dann wieder sprach, klang es, als würde ihre Stimme zittern. »Das kann ich am Telefon nicht sagen. Wann haben Sie denn Zeit?«
Der Tonfall der Stimme war es, der Emelies Aufmerksamkeit fing, nicht der Inhalt dessen, was sie sagte.
»Wie wäre es am Montag? Samstags und sonntags nehme ich für gewöhnlich keine Termine an.«
»Ich weiß nicht. Sie dürfen absolut niemandem sagen, dass Sie mit mir gesprochen haben.«
»Hier herrscht vollkommene Schweigepflicht.«
Emelie fragte sich, worum es wohl ging. Die junge Frau hatte kaum etwas gesagt – dennoch vibrierte ihre Stimme vom offenkundigen Stress.
»Ich würde Sie gern so bald wie möglich treffen, geht es auch früher als Montag?«, fragte Katja.
Emelie wusste, dass man in seiner Haltung den Klienten gegenüber bei seinen Prinzipien bleiben sollte, sonst riskierte man, dass sie einen auffraßen. Dennoch fühlte sich das hier besonders eilig an. Sie sagte: »Okay. Wir sehen uns morgen.«