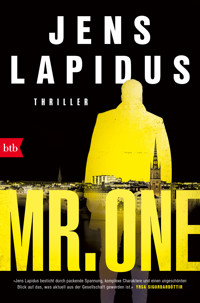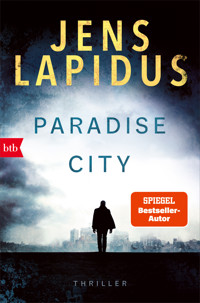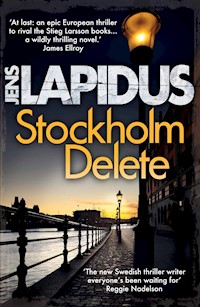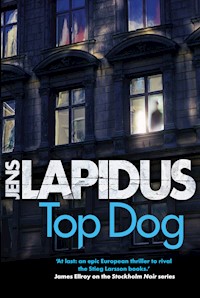9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Stockholm Reihe
- Sprache: Deutsch
Emelie Jansson ist frisch gebackene Anwältin – und hoffnungsvoller Nachwuchs einer der angesehensten Anwaltsfirmen des Landes. Teddy ist ein Ex-Knacki, der für diese Firma Spezialnachforschungen betreibt und sich fortan auf der anständigen Seite des Lebens bewegen will. Doch dann wird in einem Sommerhaus auf den Stockholmer Schären ein schrecklich zugerichteter Toter gefunden, ein bewusstloser Mann wegen dieser Tat in U-Haft genommen, und ein Karussell setzt sich in Fahrt, das alles in Frage stellt, wofür Emelie und Teddy angetreten sind: Karriere, Freiheit, eine Zukunft. Wird es den beiden gelingen, die richtigen Entscheidungen zu treffen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 718
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Zum Buch
Der erste Fall ihres Lebens. Ein Klient im Koma. Und der Einzige, der ihr zur Seite steht, ist kriminell.
Emelie Jansson ist frisch gebackene Anwältin – und hoffnungsvoller Nachwuchs einer der angesehensten Anwaltsfirmen des Landes. Teddy ist ein Ex-Knacki, der für diese Firma Spezialnachforschungen betreibt und sich fortan auf der anständigen Seite des Lebens bewegen will. Doch dann wird in einem Sommerhaus auf den Stockholmer Schären ein schrecklich zugerichteter Toter gefunden, ein bewusstloser Mann wegen dieser Tat in U-Haft genommen, und ein Karussell setzt sich in Fahrt, das alles in Frage stellt, wofür Emelie und Teddy angetreten sind: Karriere, Freiheit, eine Zukunft. Wird es den beiden gelingen, die richtigen Entscheidungen zu treffen?
»Lapidus spielt in einer ganz eigenen Liga. Das ist nicht nur spannend, sondern auch sprachlich genial, das ist einzigartig.« SYDSVENSKAN
Zum Autor
Jens Lapidus (geboren 1974) hat eine der erstaunlichsten Karrieren Schwedens inne. Er ist nicht nur einer der angesehensten Strafverteidiger des Landes, sondern auch einer der erfolgreichsten Autoren. Durch seine anwaltliche Tätigkeit verfügt er über mannigfaltige Kontakte zu Schwerverbrechern und genuine Einblicke in die schwedische Unterwelt, die Normalsterblichen normalerweise verwehrt bleiben. Die Authentizität, Schnelligkeit und Direktheit seiner Romane suchen ihresgleichen. Seine Bücher wurden in 30 Sprachen übersetzt, vielfach preisgekrönt und mehrfach verfilmt.
JENS LAPIDUS
SCHWEIGEPFLICHT
Thriller
Aus dem Schwedischenvon Susanne Dahmann
Värmdö
Tony Catalhöyük mochte seinen Job, mehr aber auch nicht. Eigentlich hatte er Polizist werden wollen, doch dann war er zweimal durch die Aufnahmeprüfung gerasselt. Zu Unrecht, wie er fand. Er sah und hörte perfekt, die physischen Tests hatte er problemlos gemeistert. Eine achtzig Kilo schwere Puppe im Prüfungsraum über den Linoleumfußboden ziehen? Ein Witz war das gewesen! Er hatte keine schwerwiegenden Gesundheitsprobleme, sein Abschlusszeugnis war in Ordnung, und vorbestraft war er auch nicht. Nicht einmal Drogen hatte er genommen, damals als seine Kumpels von der Schule kiffen sogar interessanter fanden, als Mädchen aufreißen.
Aber die Psychotests, die hatten ihn in die Scheiße geritten. Angeblich ließ seine Persönlichkeitsentwicklung zu wünschen übrig, was sich möglicherweise negativ auswirkte, da er sich nicht als Teil des Ganzen begriff. Angeblich war er ein Einzelkämpfer. Als er bei der Prüfungskommission anrief, hatten sie ihn mit einer Mitarbeiterin verbunden, die den ganzen Scheiß einfach wiederholte, der im Bericht gestanden hatte, wieder und wieder. Tony ließ sich nicht abwimmeln, machte Druck. Sagte: »Wenn Sie mir nicht gleich mit einem anständigen Grund kommen, explodiere ich hier auf der Stelle, und zwar gewaltig.« Schließlich hatte die Prüfungstussi gemeint: »Abgesehen von dem, was ich schon gesagt habe, kann ich nun noch hinzufügen, dass Sie anscheinend ernsthafte Probleme in der Zusammenarbeit mit anderen haben.«
Und das war jetzt echt kompletter Bullshit. Tony hatte sein halbes Leben Mannschaftssportarten betrieben, bevor er dann mit Submission Wrestling anfing. Klar konnte er Team, klar konnte er in einer Gruppe funktionieren. Aber diese verdammten Psychotussen mit ihren Tests und Fragen wollten einfach nicht, dass er auf die Polizeihochschule kam. Wollten nicht, dass er etwas beitrug zum Ganzen.
Er hatte keinen Schimmer, warum.
Der Himmel hellte sich langsam auf, aber der Wald um ihn herum war immer noch dunkel. Er fuhr ein gutes Stück schneller als erlaubt, was seine Chefs insgeheim billigten, zumindest nachts, auch wenn sie es natürlich nie offiziell sagten. »Wir können doch nicht auf den Straßen rumtrödeln«, meinten sie. »Wir müssen entweder in der Zentrale sein oder bei den Kunden, da werden wir gebraucht. Und die Menschen schätzen es, dass wir schnell zu ihnen kommen, auch wenn wir eigentlich nur bessere Hausmeister in Uniform sind.«
Tony hasste diese Bezeichnung: Hausmeister in Uniform. Er war kein Hausmeister – er war einer, der den Bösen was auf die Finger gab, genau wie ein Polizist, der er eines Tages auch sein würde.
Der Alarm war vor ungefähr fünfzehn Minuten eingegangen, und zwar aus einem Haus in den Wäldern um Ängsvik im Norden der Insel Värmdö. Die Anlage meldete Stromausfall, wobei der Strom nach ungefähr einer Minute wieder eingeschaltet worden war. Auf der Straße herrschte kaum Verkehr, und laut seinem Kollegen Robin waren hier die Blitzer nicht aktiv. Außerdem kannte Tony die Strecke, und dank seines Navis kam er zügig voran.
Ohne Tempo rauszunehmen, bog er bei einem Haus rechts auf eine kleinere Straße ab. Diese Gegend kannte er zwar nicht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ihm einer entgegenkam, war gleich null. Laut Karte gab es hier so gut wie keine Häuser.
Jetzt waren es nur noch vierhundert Meter bis zum Haus. Der Wald stand wie eine dunkle Mauer links und rechts am Straßenrand. Hinter einem großen Gebüsch weiter vorne sah er etwas im Straßengraben. Ein Auto. Anscheinend hatte jemand auf der rechten Seite geparkt. Sollte er anhalten und nachschauen, ob etwas passiert war? Nein, besser nicht, der Alarm musste unabhängig vom Wetter und der Lage des Hauses binnen fünfundzwanzig Minuten abgeklärt werden, so die Kundengarantie.
Der Kies auf dem Vorplatz knirschte, als er in die Einfahrt bog. Das rot gestrichene Haus mit den weißen Ecken erinnerte ihn an die Fußballfreizeit, die er als Kind besucht hatte. Fünf Sommer lang waren sein Bruder und er in den ersten beiden Ferienwochen nach Väddö im äußeren Schärengarten rausgefahren, hatten Fußball gespielt und in roten Holzhäuschen geschlafen. Sie stammten aus Fisksätra, und ihre Eltern hatten keine große Lust gehabt, sich von dort wegzubewegen. Was übrigens mit ein Grund dafür war, warum er gern auf Värmdö arbeitete: wenn die gegen Einbruch gesicherten Hütten nach irgendwelchen Meldungen, die sich in neunzig Prozent aller Fälle als falscher Alarm herausstellten, kontrolliert werden mussten, befiel ihn oft dasselbe Gefühl wie damals in diesen Fußball-Sommern.
Weiter hinten auf dem Grundstück gab es einen Carport, Autos konnte er allerdings keine entdecken.
Kein Alarm. Hat der Besitzer bestimmt schon abgestellt, dachte Tony, das war meistens so. Von der Zentrale aus hatte es auch einen Kontrollanruf gegeben, aber es war niemand rangegangen, und auch das war nicht ungewöhnlich. Diese Sorte Alarm hatte meist mit einem Stromausfall zu tun, und wenn es mitten in der Nacht passierte, schliefen die Kunden in der Regel einfach weiter.
Doch hier war es irgendwie zu still. Als würde alles mit angehaltenem Atem auf ihn warten. Miese Vibes. Er griff zu seinem Handy und wählte noch einmal die Nummer des Kunden. Es klingelte, aber niemand ging ran.
Die Haustür war gelb gestrichen und hatte oben ein kleines Fenster. Drinnen war alles dunkel. Tony drückte auf die Klingel, ein sanftes Läuten erklang.
Auf der Veranda stand ein Paar Stiefel, und auf einem Stuhl konnte er einen Stapel mit Sitzpolstern erkennen, die wahrscheinlich bei besserem Wetter in einem Boot oder auf Gartenmöbeln lagen.
Niemand öffnete, er drückte wieder auf die Klingel. Diesmal noch länger.
Er wusste, was in einer solchen Situation zu tun war. SP, die Standardprozedur, war angesagt. Inaugenscheinnahme des Gebäudes von außen, Kontrolle der Gegebenheiten. Dokumentation. Meldung an die Zentrale.
Verdächtige Autos, ins feuchte Gras geworfene Einbruchswerkzeuge, zerstörte Sicherungskästen. Aufgebrochene Türen, Lehmspuren auf der Terrasse, kaputte Fenster.
Das waren so die Sachen, nach denen er Ausschau halten sollte.
Sein Blick fiel auf eine typische Quelle für einen falschen Alarm – eines der Fenster im Untergeschoss stand einen Spaltbreit offen. Das vergaßen die Kunden oft zu schließen, so dass es aufwehte. Aber hier hatte es ja wegen Stromausfalls Alarm gegeben und nicht, weil ein Fenster offen stand.
Tony ging hinüber, das Gras stand halbhoch, und seine Springerstiefel wurden nass, was aber letztlich egal war, die hielten alles aus. Das Zimmer drinnen: dunkel.
Als er sich auf die Zehenspitzen stellte, um hineinzuschauen, entdeckte er, dass in beide Scheiben des Doppelfensters ein kreisrundes Loch geschnitten worden war. Eine klassische, aber durchaus verfeinerte Einbruchstechnik, die er erst zweimal zuvor gesehen hatte. Wahrscheinlich hatte man mit einem Glasschneider um einen Saugpfropfen herum geschnitten, um dann die kreisförmigen Stücke einfach herauszuheben, die Hand hineinzustecken und den Fenstergriff zu öffnen.
Das hier war also offenkundig kein falscher Alarm. Jemand hatte versucht, den Strom zu kappen, um die Sensoren im Haus auszuschalten, woraufhin die automatische Meldung an die Zentrale rausgegangen war. Aber dieser Kunde besaß einen sogenannten Sabotage-Alarm, und genau so sollte das auch funktionieren. Tonys Puls stieg.
Er entfernte sich ein paar Meter von dem Haus und rief die Zentrale an, um zu berichten, was er entdeckt hatte. Hier handelte es sich definitiv um einen Einbruch.
»Noch im Gang oder abgeschlossen?«, fragte Robin, der diese Nacht in der Zentrale Dienst tat.
»Weiß nicht. Könnte noch jemand drin sein, der grad das Haus ausräumt.«
»Schon klar. Ist der Kunde zu Hause?«
»Keine Ahnung, ist nicht aufgetaucht, obwohl ich wie der übelste Stalker geklingelt habe.«
Tony schob das Handy ins Holster und ging ums Haus herum zur Eingangstür.
Sie bekamen immer mehr Einbruchsmeldungen, obwohl die Leute eigentlich zu Hause waren. Meist stiegen die Täter im Obergeschoss ein, weil es da oft keine Sensoren gab. Heimtückische, listige Parasiten. Das hatten die armen Kunden nicht verdient.
Tony beschloss, der Sache hier, sollte sie denn immer noch laufen, ein Ende zu setzen.
Nun stand er wieder vor der Haustür. Packte die Klinke und stellte fest, dass die Tür nicht verschlossen war.
Betrat das Haus.
Jacketts und Mäntel, die in der kleinen Diele am Haken hingen, flatterten, als er die Tür aufschob, und es roch nach altem Holz und offenem Kamin.
Er nestelte seine Taschenlampe heraus. Das Licht fiel auf etwas Unförmiges auf dem Boden, sah aus wie eine Tasche.
Rechts ging eine Treppe zum oberen Stockwerk. Direkt vor ihm war die Küche zu erkennen. Tony griff zu seinem Teleskopschlagstock und hielt ihn fest in der Hand. Schwarzer, gehärteter Stahl, die längste Variante: sechsundzwanzig Inch. Im Training übten sie damit oft Verteidigung und Angriff. Dienstlich hatte er ihn noch nie anwenden müssen, aber durchaus ein paarmal in Bereitschaft gehabt, als es um irgendwelche Junkies ging, die versuchten, die Heimkinoanlage eines armen Villenbesitzers aus dem Fenster zu hieven oder seine Alkoholvorräte auszusaufen. Egal – irgendwann ist immer das erste Mal, dachte er.
Er tat einen Schritt nach vorne. Hörte das Knirschen von zerbrochenem Glas. Im Schein der Taschenlampe: kleine Glasscherben auf dem Dielenfußboden.
Die Küche wirkte sauber und aufgeräumt. Da, beim Esstisch, das offene Fenster. An der Wand eine große runde Uhr. Viertel nach vier.
Wohnzimmer und Küche ein großer Raum.
Nicht gerade viele Möbelstücke.
Ein Sessel. Ein Couchtisch.
Hinter dem Couchtisch lag etwas.
Er trat näher heran.
Ein Körper.
Tony leuchtete.
Es war das Grässlichste, was er jemals gesehen hatte.
Er fühlte die Übelkeit ruckartig in sich hochsteigen.
Der Kopf. Gesichtslos. Jemand hatte diesem Menschen den Schädel weggeschossen.
Seine Kotze platschte auf den Teppich.
Er sah zu Boden.
Überall Blut.
Tony schrie und heulte ins Telefon.
»Jetzt mal immer mit der Ruhe, ich versteh ja gar nicht, was du sagst«, versuchte es Robin.
»Ein verdammter Mord ist das, ein Massaker. Der atmet nicht mehr, da bin ich mir sicher. Schick die Polizei, den Krankenwagen, so was Widerliches hab ich noch nie gesehen.«
»Ist noch jemand vor Ort?«
Tony sah sich um. Das hatte er verdrängt. Wer immer das getan hatte, er konnte noch da sein.
»Ich seh niemand, soll ich das Haus durchsuchen?«
»Das musst du selbst entscheiden. Hast du draußen was Seltsames bemerkt?«
»Nein, eigentlich nicht.«
»Und auf dem Weg zum Haus?«
Er lief wieder raus auf die Veranda. Das hatte er fast vergessen, aber Robins Frage erinnerte ihn daran.
»Was machst du, Tony? Was ist los?«
Weiter die Straße entlang, die er gekommen war.
»Fuck, Robin, als ich ankam, stand ein Auto im Straßengraben.«
Jetzt rannte er.
»Ich rufe die Polizei, aber bleib dran«, sagte Robin, und Tony hörte, wie er auf einer anderen Leitung redete.
Hier an der frischen Luft ging es ihm besser. Er versuchte wegzuschieben, was er in dem Haus gesehen hatte, darum mussten sich die richtigen Polizisten kümmern, und ausnahmsweise war er einmal richtig froh, keiner von denen zu sein.
Sondern nur ein Hausmeister in Uniform.
Im schwachen Morgenlicht wirkte der dunkelblaue Wagen, als würde er sich neben dem Gebüsch in den Boden graben. Als er das Buschwerk beiseite gebogen hatte, sah er, dass die halbe Front eingedrückt war. Das Auto musste im Graben mindestens fünfzehn Meter weit geschliddert sein.
Tony betrachtete die aufgewühlte Erde in den Reifenspuren. Die Tannen im Hintergrund standen immer noch dunkel. Als er vorhin vorbeigefahren war, hatte das Gebüsch verborgen, wie zerschmettert das Auto war.
Er bewegte sich weiter. Jetzt wieder mit dem Schlagstock in der Hand.
Es sah aus, als würde es aus der Motorhaube qualmen. Vielleicht war es auch nur Staub, der im Schein der Taschenlampe aufstob.
Der Lehm glitschte, er musste sich am dünnen Gras festhalten, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren.
Ein Volvo V60.
Er konnte nicht erkennen, ob jemand drinsaß, es war zu dunkel.
Er trat an die Seite des Wagens und schaute von dort.
Jetzt sah er es. Auf dem Fahrersitz saß jemand, vornübergebeugt.
»Hallo?«
Die Person rührte sich nicht.
Die Windschutzscheibe war eingedrückt, aber nicht gesplittert, die tausend Risse im Glas erinnerten an Eis.
Tony beugte sich hinunter und öffnete die Fahrertür. Der Airbag war aufgegangen.
Es schien ein jüngerer Mann zu sein, vielleicht so um die zwanzig. Blond.
Das aufgeblasene Aufprallkissen sah aus wie eine weiße Plastiktüte, die jemand über das Steuer gelegt hatte.
Bewusstlos. Oder tot.
Tony berührte den Arm des Mannes mit der Spitze des Schlagstocks.
Keine Reaktion.
TEIL I
Mai
1
Scheiße fressen.
Nikola musste jetzt schon so lange Scheiße fressen.
Seit einem Jahr hockte er hier.
Aber bald war Schluss. Morgen: letzter Tag. Gott sei gepriesen – fast war er bereit, ab jetzt immer mit Opa Bojan zur Kirche zu gehen.
Er war neunzehn. Schweden war so ein krankes Land, hier wiesen sie einen ein, obwohl man volljährig war. Das war alles die Schuld von seiner Majka. Linda, the never ending Jammermama. Sie hatte damit gedroht, ihn rauszuschmeißen, den Kontakt abzubrechen. Und was noch schlimmer war: sie hatte mit Teddy gedroht. Das war so ziemlich das Einzige, was Nikola echt angefasst hatte – dass Teddy enttäuscht sein könnte. Er liebte Teddy mehr als den absolut frischesten Snus im Laden, mehr als alle Joints auf der Welt, manchmal sogar mehr als die Jungs, die Typen, mit denen er aufgewachsen war, seine Bros.
Teddy: sein Onkel.
Teddy: sein Idol. Eine Ikone. Ein Vorbild. Er kannte nur einen Menschen, den man mit Teddy vergleichen konnte, und das war Isak.
Aber es hatte trotzdem nicht gereicht. Zu viel Gemecker, zu viele Jugendstrafen. Die Geldstrafen zu hoch. Das Gejaule vom Jugendamt zu laut. Linda wollte, dass er eingewiesen wurde. Sie wollte, dass ihr eigener Sohn in ein drogenfreies, spaßbefreites, komplett bräuteloses Heim geschickt wurde.
Da hatte er also das letzte Jahr verbracht. LBZ Spillersboda.
Eine freiheitsentziehende Unterbringung kann verhängt werden, wenn der Jugendliche in seiner Gesundheit oder Entwicklung einem deutlichen Risiko durch den Konsum suchterzeugender Mittel, gewalttätigem oder anderem sozial herabsetzenden Verhalten ausgesetzt ist.
Fuck FamFG, den Paragraphen hatte er jetzt schon ein paar Millionen Mal gehört.
Und er war immer noch komplett wertlos.
Jede zweite Minute mahlte der gleiche Gedanke in seinem Kopf. Wie ein zu Tode gespielter Hit von irgend so einem müden House-DJ. Der Refrain in Dauerschleife: verdammte Mama. Verdammte Mama. Verdammte Mama.
»Ich habe versucht, alles für dich zu tun, Nikola«, sagte sie immer, wenn er Freigang hatte. »Vielleicht wäre es anders gekommen, wenn du einen Papa gehabt hättest, der hier ist.«
»Aber ich hatte doch Teddy.«
Die Mutter schüttelte den Kopf. »Glaubst du? Von den letzten neun Jahren hat dein Onkel acht gesessen. Nennst du das hier sein?«
Nikola saß ganz hinten im Klassenzimmer. Wie immer. Er fraß S-c-h-e-i-ß-e. Die versuchten wirklich, ihn runterzuziehen.
Manchmal kehrte eine neue Phrase in den Refrain ein: verdammte Sandra. Verdammte Sandra. Verdammte Fotzen-Sandra.
Sandra war seine sogenannte Kursberaterin. Die quatschte von Bewerbungen auf Jobs. Du musst dich gut darstellen können, einen persönlichen Brief schreiben, einen Arsch lecken. Nikola konnte nichts Wesentliches in all dem Gerede erkennen. Er hatte gerade deshalb ein berufsvorbereitendes Programm gewählt, weil er nicht lange rummachen und auf der Stelle treten wollte. Und außerdem hatte er keinen Bock auf ein Neun-bis-fünf-Leben und auch nicht auf irgendwelche Tagelöhner-Jobs als Handwerker. Es gab entschieden schnellere Wege, an Kohle zu kommen, das wusste er aus eigener Erfahrung. Die Sachen, die sie für Yusuf machten, zahlten sich sofort aus.
Eine Minigesprächsgruppe, nur Nikola und fünf andere Typen, einmal die Woche. Den Rest der Zeit erwartete man von ihm, dass er an einem Praktikumsplatz aufkreuzte, den sie für ihn in Åkersberga arrangiert hatten: George Samuels Elektroservice. George war okay, aber Nikola hatte einfach keinen Bock.
Der Leiter von Spillersboda und Linda fanden es offensichtlich gut für ihn, wenn er außer dem Praktikum noch ein paar Gruppenstunden hatte. »Das vergrößert deine Möglichkeiten, das fokussiert dich. Vielleicht bekommst du keine guten Noten in Schwedisch, aber es ist auf jeden Fall gut, wenn du lernst, ordentlich zu lesen.« Die lallten ja schlimmer als die Alkis auf den Parkbänken in Ronna. Klar konnte er lesen. Sein Großvater war der größte Bücherfresser überhaupt, das Lesegenie aus Belgrad. Als Nikola sechs Jahre alt gewesen war, hatte er ihm die literarische Buchstabenmagie beigebracht, auf seinem Bett gesessen und alte schöne Sachen gelesen. Die Schatzinsel, 20 000 Meilen unter den Meeren, Die geheimnisvolle Insel.
Nikola wollte unter dem Radar gleiten, wie Öl auf Wasser fließen. Er wollte ein Schatten sein, sein Leben so leben, wie es ihm passte. Nicht eingeschlossen in einem Klassenzimmer. Nicht kontrolliert von irgendwelchen widerwärtigen Abkürzungen.
Aber wie gesagt: bald war es so weit. Seine zwölf Monate in diesem öden Arschloch der Langeweile würden bald vorüber sein.
Das Leben würde wieder Sinn bekommen.
Das Leben würde wieder Leben werden. Und es ging schon los. Sie wussten, dass er auf dem Weg war. Yusuf hatte von sich hören lassen und gefragt, ob Nikola in ein paar Tagen bei einem Ding dabei sein könnte.
Irgendein Wachmann-Auftrag. Aber nicht irgendein kleiner Laufburschendienst. Es ging um eine Verhandlung. Ihr eigenes Gerichtswesen. Ein Gerichtsverfahren zwischen rivalisierenden Gruppen in Södertälje.
Und Isak würde der Richter sein. Er würde die Sache entscheiden – nicht das System, das Nicko hier eingesperrt hatte.
Isak, echt. Das war eine Stufe die Leiter rauf.
Noch hatte Nikola nicht zugesagt.
Polizeibehörde Kreis Stockholm
Vernehmung von Mats Emanuelsson, 10. Dezember 2010
Zuständiger: Joakim Sundén
Ort: Untersuchungsgefängnis Kronoberg
Zeit: 14.05 – 14.11
VERNEHMUNG
Gesprächsprotokoll
JS: Nur damit es klar ist – ich nehme alles auf, was heute hier gesagt wird.
ME: Aha.
JS: Wir befinden uns im Vernehmungsraum, Untersuchungsgefängnis Kronoberg, es ist der 10. Dezember 2010, und hier bei mir habe ich den Verdächtigen Mats Emanuelsson, 44 Jahre alt. Ist das richtig?
ME: Ja.
JS: Und Sie sind einverstanden, dass diese Vernehmung ohne Anwalt abgehalten wird?
ME: Ähh, was bedeutet das?
JS: Das heißt, keine Besonderheiten. Sie werden viel schneller hier wegkommen, wenn wir das Gericht nicht einschalten müssen, das erst einen Anwalt finden muss, der dann Zeit haben muss, hierherzukommen. Ich sage mal so, wenn Sie einen Anwalt haben wollen, dann kann ich nicht versprechen, dass diese Vernehmung heute oder auch morgen stattfinden kann. Und dann müssen Sie eben hier so lange warten.
ME: Aber … ich kriege Panik, wenn ich eingeschlossen bin. Ich bin schon mal entführt worden, wissen Sie das?
JS: Nein, das wusste ich nicht. Was ist passiert?
ME: Kidnapping, sie haben mich in eine Kiste gesperrt. Das ist ungefähr fünf Jahre her. So was hier, das halte ich nicht aus … Ich bin wegen meiner Klaustrophobie schon zum Psychologen gegangen, ich muss so schnell wie möglich hier raus.
JS: Nun, dann denke ich, wir fangen auf jeden Fall schon mal ohne Anwalt an, und wenn Sie das Gefühl haben, wir sollten abbrechen, dann tun wir das.
ME: Ja, in Ordnung, dann machen wir das. Ich muss hier raus.
JS: Dann fange ich mal damit an, Ihnen zu erklären, unter welchem Verdacht Sie stehen. Sie sind also der Beihilfe zum Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgestern in Gamla stan verdächtig, weil Sie zusammen und im Einverständnis mit Sebastian Petrovic, oder Sebbe, wie er anscheinend genannt wird, eine unbekannte Menge Drogen bei sich getragen haben. Haben Sie das verstanden?
ME: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz?
JS: Ja, so lautet die Anklage.
ME: Sind Sie sicher?
JS: Ganz sicher. Sollte ich das nicht sein?
ME: Gibt es noch andere Verdächtigungen?
JS: Das kann ich im Moment nicht sagen. Doch ich wüsste gern, was Sie zu der Anschuldigung sagen.
ME: Ich habe nichts damit zu tun.
JS: Sie streiten also alles ab?
ME: Ja, natürlich.
JS: Dann würde ich gern noch ein paar Fragen stellen.
ME: Okay.
JS: Was haben Sie eigentlich in Gamla stan gemacht?
ME: Nichts Besonderes, ich war einfach da.
JS: Kennen Sie Sebastian Petrovic?
ME: Dazu möchte ich mich nicht äußern.
JS: Wissen Sie, wer er ist?
ME: Kein Kommentar. Ist er festgenommen worden?
JS: Sie wollen keinen Kommentar abgeben, ob Sie ihn kennen, aber Sie fragen, ob er festgenommen wurde?
ME: Ja.
JS: Dann kann ich Sie darüber informieren – da es sowieso bekannt werden wird, wenn er festgenommen werden muss –, dass er sich nicht in Untersuchungshaft befindet, sondern auf freiem Fuß ist. Doch ich habe noch mehr Fragen an Sie.
ME: Aha.
JS: Gehört der Range Rover mit dem amtlichen Kennzeichen MGF 445 Ihnen?
ME: Dazu möchte ich mich nicht äußern.
JS: Wissen Sie, mit wem Sebbe sich in Gamla stan getroffen hat?
ME: Kein Kommentar.
JS: Wissen Sie, was er dort wollte?
ME: Kein Kommentar.
JS: Haben Sie zu gar nichts einen Kommentar?
ME: Nein, eigentlich nicht. Wie gesagt, habe ich nichts damit zu tun. Ich weiß nicht, warum ich hier sitze. Ich muss nur raus, mein Kopf explodiert …
JS: Sie waren in die Sache von vorgestern verwickelt.
ME: Ich weiß nichts. Drogen, das ist nicht meine Welt …
JS: Nein, das weiß ich. Um ehrlich zu sein, bin ich auch ein wenig erstaunt. Vielleicht sollten wir die Sache anders angehen. Warten Sie, ich schalte das Tonbandgerät aus, dann machen wir mal eine kleine Pause.
Vernehmung beendet: 14.11
AKTENNOTIZ 1
Gesprächsprotokoll
JS: Das Tonbandgerät ist ausgeschaltet, somit ist das hier nicht mehr länger eine formelle Vernehmung. Ich nenne das hier ein Gespräch, das ausschließlich zwischen Ihnen und mir stattfindet.
ME: Was bedeutet das?
JS: Das bedeutet, dass wir in dem, was wir sagen, freier sein können. Wenn Sie es nicht möchten, dann werde ich über das hier mit niemandem reden. Und ich will ganz ehrlich sein, Mats, ich habe mich ein wenig über Sie informiert. Sie haben zwei Kinder, Sie hatten einen ganz gewöhnlichen Job, und es stimmt, dass Sie vor ein paar Jahren entführt wurden, das muss schrecklich gewesen sein. Sie sollten an einem Ort wie diesem nicht eingesperrt sein.
ME: Können Sie mich dann nicht einfach laufen lassen? Ich sitze hier bald schon zwei Tage. Ich bin traumatisiert von damals. Ich habe so viel Scheiße miterleben müssen. Bitte, ich flehe Sie an. Hier drinnen geht es mir richtig schlecht.
JS: Aber Sie müssen auch verstehen, dass es sich um einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz handelt. Wir haben in dieser Ermittlung gegen gewisse Personen geheime Observationsmittel angewendet, nicht gegen Sie, aber gegen andere.
ME: Was heißt das?
JS: Lauschangriff auf Wohnungen, Telefonüberwachung und Observation. Wir haben handfeste Beweise. Sie werden für das hier verurteilt werden, das kann ich mit Sicherheit sagen. Das gibt mindestens zehn Jahre Freiheitsentzug. Und ich glaube, auch ein Gefängnis ist kein besserer Ort für Sie.
ME: Also … (man hört Weinen) … hier kann ich nicht bleiben … das geht jetzt schon seit mehreren Jahren.
JS: Sie werden erst einige Jahre in Kumla landen, das ist die heftigste Anstalt Schwedens, und … jetzt hören Sie mal gut zu, Sie wissen ja wahrscheinlich selbst, wie es Leuten wie Ihnen da ergeht, das ist nichts für Softies …
ME: Aber … aber … (nicht verständlich).
JS: Ich verstehe. Das kann nicht leicht für Sie sein. Warten Sie kurz, ich hole ein paar Taschentücher.
ME: (unverständlich)
JS: Bitte schön.
ME: Danke … (Schluchzen).
JS: Ich verstehe ja, dass sich das furchtbar anfühlt, aber ich bin offen. Es ist so, dass ich ein Angebot für Sie habe. Das ist ein bisschen was Ungewöhnliches, aber wie gesagt, ich glaube, Sie gehören nicht hier rein.
ME: Bitte, sagen Sie es mir. Ich mache alles.
JS: Es ist ganz einfach. Wir wissen, dass Sie umfassenden Kontakt zu gewissen Personen haben, für die wir uns interessieren, das haben wir sowohl gesehen als auch gehört, wenn ich es mal so formulieren darf. Ich will alles über die wissen, ich will alles wissen, was ihr vorhabt. Und wenn Sie mir dabei helfen können, dann verspreche ich Ihnen, dass ich das hier flach halte. Kein Verhör, keine Tonbandaufnahme, keine Staatsanwaltschaft, keine Anwälte. Ihr Name wird nirgends vorkommen. Und im Gegenzug kann ich Ihnen auch noch helfen.
ME: Werde ich freigelassen?
JS: Wenn Sie hier mitmachen, dann lasse ich Sie raus und werde nicht weiter gegen Sie vorgehen. Wir machen einen Deal, Sie und ich, verstehen Sie, was ich meine?
ME: Ich weiß nicht …
JS: Denken Sie drüber nach. Wägen Sie die verschiedenen Möglichkeiten gegeneinander ab. Acht, zehn Jahre in Kumla gegen ein paar Stunden Gespräche mit mir.
ME: Das kann schwierig werden … das ist gefährlich. Glauben Sie mir, ich habe schon viel erlebt.
JS: Ja, das habe ich befürchtet. Aber Sie sind ja kein Krimineller, Sie sind doch normal. Und wenn Sie auf meinen Vorschlag eingehen, dann muss es auch wirklich Ihre eigene Entscheidung sein. Ich kann Sie nicht dazu zwingen, mitzuarbeiten. Aber ich kann Ihnen Garantien geben. Garantien, die Sie brauchen.
ME: Und meine Kinder?
JS: Also, ich werde das, was Sie sagen, nur als Grundlage für weitere Ermittlungen nutzen, Sie werden niemals als Zeuge aussagen müssen oder auf irgendeine andere Weise namentlich genannt werden. Sie werden unter einem Alias, nämlich »Marina«, laufen, das nur ich allein kenne. Hundertprozentige Geheimhaltung. Also werden Sie sich weder um sich selbst noch um Ihre Kinder Sorgen machen müssen. Aber wir können eine Pause einlegen, ich gehe kurz raus, und dann können Sie nachdenken.
ME: Ja, vielleicht.
JS: Gut. Aber vergessen Sie nicht. Mindestens zehn Jahre. Kumla. Oder ein paar Stunden lockere Unterhaltung mit mir.
2
Sie hatten alle auf den samtüberzogenen Sesseln und Sofas gesessen und sich unterhalten. Ein paar von den Juristen kannte Emelie schon von früher, mit einigen hatte sie zusammen studiert, andere hatte sie auf den Kursen der Anwaltskammer kennengelernt, einer war sogar ein Kollege aus ihrer Kanzlei.
Doch unter all der Nettigkeit lauerte auch eine Anspannung. Natürlich: einer nach dem anderen wurde zu den Prüfern und Beisitzern reingerufen. Sie hatten ihre Handys in kleine Plastiktüten auf einen Tisch am Anfang des Korridors abgeben müssen. Ab da waren nur noch Papier, Stift und der Ordner mit dem Regelwerk und den Entscheidungen der Disziplinarbehörde erlaubt.
Denn jetzt war es so weit: bald würde sie in den Prüfungsraum gerufen werden. Die mündliche Prüfung, die zeigen sollte, ob sie Anwältin werden würde oder nicht. Alle Studien bis hierher waren mehr oder weniger eine Reise auf dem Weg zu diesem Ziel gewesen. Zwölf Jahre Grundschule und Gymnasium, gefolgt von Studienjahren in Paris – wo sie zwar mehr im Bastille-Viertel gefeiert, aber immerhin auch fließend Französisch gelernt hatte. Dann dreieinhalb Jahre Jurastudium bis zum Examen. Und schließlich: knapp drei Jahre als Assessorin in der Anwaltskanzlei Leijon. Während dieser Zeit hatte sie Kurse in Ethik und Arbeitsrecht besucht und gleichzeitig alle Referenzen gesammelt, die sie benötigen würde. Es war nicht gerade so, wie wenn man sich auf einen gewöhnlichen Job bewarb und dabei den Namen seiner beiden bevorzugten Chefs angab. Nein, die Schwedische Anwaltskammer wollte Namen und Adressen von allen Anwälten und Richtern haben, mit denen man während seiner gesamten Laufbahn zu tun gehabt hatte, dazu einen Report, in welchem Zusammenhang man ihnen begegnet war. Für Emelie war das nicht sonderlich aufwendig gewesen, denn vorwiegend waren es die Partner der Kanzlei gewesen, die die Fälle, an denen sie beteiligt war, geleitet hatten. Aber immerhin handelte es sich doch um an die zwanzig Personen. Sie alle würden von der Kammer befragt werden und durften sich darüber auslassen, ob sie es wert wäre, in ihre heiligen Hallen eingelassen zu werden.
Und jetzt heute: die Abschlussprüfung. Wenn sie das hier schaffte, wäre der Rest eine Formalie. Dann würde sie sich bald Anwältin nennen dürfen.
»Emelie Jansson«, rief eine Stimme vom Korridor.
Sie war an der Reihe.
Der Prüfer reichte ihr ein einfaches DIN-A4-Blatt mit Text. Jetzt durfte sie zwanzig Minuten lang über die Fragestellung nachdenken und sich auf ihre Präsentation und die Gegenfragen des Prüfers vorbereiten. Sie ging in einen gesonderten Raum mit grünen Tapeten, der lediglich mit einem Eichenschreibtisch und einem Schreibtischstuhl ausgestattet war. An der Wand hing ein Kupferstich, der einen alten Gerichtssaal darstellte. Sie überflog den ersten Punkt.
Frage A
Diskutieren Sie die ethischen und berufsrelevanten Fragen, die in den unten beschriebenen Situationen auftauchen.
Der britische Geschäftsmann Mr. Sheffield hat Kontakt zur Anwaltskanzlei Schwupps aufgenommen und um Hilfe beim Erwerb eines Immobilienkomplexes in Göteborg gebeten.
Mr. Sheffield berichtet der Anwältin Mia Martinsson, dass er bereits vor zirka zehn Jahren die Hilfe der Anwaltskanzlei in Anspruch genommen habe. Damals habe ihm der frühere Partner Sune Storm bei einem komplizierten Anliegen geholfen. Mr. Sheffield sagt, dass er sich als Klient der Kanzlei betrachte und eine entsprechende Behandlung erwarte.
Nach einigen Wochen der Korrespondenz mit Mr. Sheffield beginnt Mia sich zu fragen, wer Mr. Sheffield eigentlich ist. Er wünscht keinerlei Finanzierung durch eine Bank, sondern möchte die gesamte Kaufsumme von 220 Millionen Kronen auf ein Treuhandkonto bei der Anwaltskanzlei überweisen. Die Überweisung erfolgt jedoch nicht von Mr. Sheffields Konto in Großbritannien, sondern von einer Firma mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln.
Emelie unterstrich einige Wörter in der Aufgabe und griff zum Regelheft, um es danach gleich wieder wegzulegen. Ehe sie anfing, nach Klauseln zu suchen, musste sie erst einmal selbst nachdenken. Die Fragestellung identifizieren und die ethischen Fallgruben.
Hätten nicht die Kanzlei und die Anwältin eine Überprüfung des Klienten durchführen müssen? Eine Kopie seines Ausweises erbitten, eine hausinterne Kontrolle durchführen müssen? Durfte Mr. Sheffield wirklich als Klient der Kanzlei betrachtet werden, nur weil er das vor zehn Jahren schon einmal gewesen war? Wie und wann entstand eigentlich ein Mandantenverhältnis? Und wie stand es um die Regeln der Finanzbehörde in Sachen Kontrolle und Verhinderung von Geldwäsche?
Sie machte sich Notizen auf ihrem Block.
Es klopfte an der Tür – die Zeit war um. Die zwanzig Minuten waren schneller vergangen, als sie erwartet hatte. Sie hatte die Fragen, die vier ähnliche Situationen um die Anwältin Martinsson und Mr. Sheffield behandelten, abgearbeitet. Alle beinhalteten unterschiedliche Problemgebiete. Anwaltspartnerschaft, Umgang mit Zeugen, Personalführung, Tatbestände. Interessenskonflikte.
Der Prüfer war ein Anwalt um die sechzig mit einem fast unwirklich gut gepflegten Schnurrbart, und die Beisitzerin, die wahrscheinlich zehn Jahre jünger war, versuchte so auszusehen, als wäre sie zwanzig. Sie waren formell gekleidet: er in dunkelblauem Anzug mit Schlips, sie in weinrotem Kleid.
»Nun, dann beginnen wir mal mit der Anwältin Mia Martinsson. Wie sollte sie sich verhalten?«, fragte der Prüfer.
Das war vor drei Wochen gewesen.
Heute saß Emelie in der Kanzlei. Sie sollte eigentlich arbeiten, doch sie war abgelenkt. Sie konnten jederzeit anrufen.
Das Telefon klingelte.
»Hallo, hier ist Mama.«
»Hallo.«
»Wie geht es dir?«
»Ich dachte, es wäre jemand anders. Heute werde ich es erfahren.«
»Was denn? Geht’s um die Arbeit?«
»Ja, das kann man wohl sagen. Ob ich die Prüfung geschafft habe und meine Bewerbung durchgegangen ist. Ob ich Anwältin werde.«
»Nein, das ist ja großartig. Herzlichen Glückwunsch. Kriegst du dann mehr Geld?«
»Ich habe die Antwort ja noch nicht. Und mehr Geld wird es wohl nicht geben, in dieser Kanzlei hat das nicht so viel Bedeutung. Anwältin zu sein hat am meisten Bedeutung, wenn es um Strafsachen geht, dann kann man nämlich als Pflichtverteidiger und so gerufen werden. Für mich ist es hauptsächlich von symbolischem Wert. Ich bin dann sozusagen fertige Anwältin.«
»Ja, aber das ist doch aufregend.«
Emelie hörte an der Stimme, dass irgendwas nicht stimmte.
»Und wie geht es euch?«
»Geht so.« Ihre Mutter sprach langsamer. »Ich habe Papa seit fast drei Tagen kaum mehr gesehen.«
»So wie früher?«
»Ja, so wie früher. Er poltert mitten in der Nacht rein, und neulich ist er nicht mal nach Hause gekommen. Kannst du nicht am Wochenende zu uns kommen?«
»Zu euch?«
»Ja, zu uns.«
»Aber wird Papa denn da sein?«
Im Hörer wurde es still.
So hatte Emelies Welt während ihrer ganzen Kindheit und Jugend ausgesehen. Die Quartalssäuferei ihres Vaters. Das war ihr eigentlich erst richtig klar geworden, als sie von zu Hause ausgezogen war, an der Universität Stockholm studierte und wirklich anfing, nachzudenken. Aber sie wusste, wie er sein konnte. Wie sie selbst sein konnte.
Das durfte in der Kanzlei nie ruchbar werden.
Emelie beendete das Gespräch mit ihrer Mutter. Sie betrachtete sich selbst in dem runden Spiegel an der kurzen Seite des Bücherregals. Das dunkelblonde Haar war zum Seitenscheitel gekämmt und hinter den Ohren zusammengebunden. Vielleicht hatte sie sich heute etwas zu wenig geschminkt; wenn sie es genau bedachte, eigentlich gar nicht, doch ihre grünen Augen sahen trotzdem groß aus. Sie sollte wirklich runter nach Jönköping fahren. Sich um ihren Vater kümmern. Versuchen, ihn ein für alle Mal zur Vernunft zu bringen.
Eine Stunde später. Die Tür flog auf, und Josephine stolperte herein. Sie teilten sich ein Büro, obwohl Jossan Senior Associate war und schon längst ein eigenes Büro haben sollte. Vielleicht könnte man das als schlechtes Zeichen auch für sie betrachten.
Doch Emelie teilte sich gern das Zimmer mit Jossan, auch wenn diese extrem selbstbezogen sein konnte und ungefähr siebenmal mehr über ihre Nagelstylistin auf der Sibyllegatan und den Sale bei Net-a-Porter reden konnte als über wichtige Dinge. Aus irgendeinem Grund stolperte sie immer wie Kramer in Seinfeld in die Tür, und schon alleine das war mindestens einen Lacher pro Tag wert.
»Pippa«, brüllte Josephine, nachdem sie die Tür hinter sich geschlossen hatte. »Ich sehe dir an, dass etwas Gutes passiert ist. Du hast Lachgrübchen, obwohl du nicht lachst. Haben sie gerade angerufen?«
Emelie nickte. Fünf Minuten zuvor hatte endlich jemand von der Kammer angerufen und ihr mitgeteilt, dass sie als Mitglied der Schwedischen Anwaltskammer angenommen worden sei.
Jetzt hatte sie den Titel – die Reise war beendet.
»Glückwunsch, Pippa. Du bist Anwältin! Das müssen wir mit einem Glas Bollinger beim Abendessen feiern.«
Jossan nannte sie immer Pippa, weil sie der Ansicht war, Emelie würde Pippa Middleton so außerordentlich ähnlich sehen.
»Du weißt doch, was mein Lieblingsschriftsteller zu sagen pflegt: Glück multipliziert sich, wenn es geteiltwird.«
»Was für ein Unsinn, von wem ist das denn?«
»Das ist gar kein Unsinn, und es ist vom scharfsinnigsten Mann der Welt. Paulo Coelho.« Jossan zwinkerte. Und dann fing sie an, von all seinen Büchern zu erzählen und wie diese ihr Leben verändert hätten. Sie hatte sich selbst gefunden, und sie konnte sich jetzt sogar in schlechten Zeiten freuen, sie war sich viel bewusster über ihr geistiges Ich geworden und hatte ihren materialistischen Lebensstil loslassen können.
Emelie zeigte auf die drei Handtaschen, die hinter Josephine an einem Haken an der Wand hingen – Céline, Chanel, Givenchy. »Und was ist mit denen?«
Jossan strich zärtlich liebkosend mit der Hand über das Leder der Céline-Tasche. »Das ist kein Materialismus«, erklärte sie. »Eine Frau braucht doch etwas, worin sie ihr Zeug transportieren kann.«
Neunzehn Uhr dreißig: auf dem Weg zur Bar Riche zündete Emelie sich eine Zigarette an. Drinnen saßen schon Jossan und die anderen Mädels aus der Kanzlei über ihren Moules Frites und warteten darauf, mit ihr anstoßen zu können.
Sie hielt inne. Zögerte. Vielleicht hatte sie gar keine Zeit für so was. Sie arbeitete wie eine Wahnsinnige. Die Aufteilung der Husgrens AG – bei der die ertragsreichen Teile an ein chinesisches Industriekonglomerat verkauft und die verlustreichen Teile von einem der Opportunityfonds der EQT übernommen werden sollten – hatte drei Wochen lang vierzehnstündige Verhandlungen mit den Chinesen mit sich gebracht. Der Verkauf von Airborne Logistics an einen amerikanischen Giganten bedeutete achtzehnstündige Schichten im Due Diligence-Raum ohne Pause, nicht einmal am Sonntag. Emelie war Teamleiterin der anderen Associates, und die Luft im Raum war manchmal so schwer, dass sie abends an ihr Team Aspirin verteilte.
Ihr Telefon klingelte. Unterdrückte Nummer.
Sie meldete sich mit ihrem Vornamen.
»Hallo, hier Kriminalinspektor Johan Kullman. Spreche ich mit Anwältin Emelie Jansson?«
Anwältin Emelie Jansson, das klang gut. Aber warum rief ein Kriminalinspektor sie an?
»Das ist richtig, worum geht es?«
»Ich rufe von der Abteilung sechs im Untersuchungsgefängnis Kronoberg an, wir haben einen Insassen, der Sie als Anwältin angefordert hat.«
»Was sagen Sie da? Ein Untersuchungshäftling wünscht mich als Anwältin?«
»Antwort: jawohl.«
»Um diese Uhrzeit?«
»Er hat das Recht, einen Anwalt zu verlangen. Und wir verstehen es so, dass er Sie angefordert hat. Und da ist es unsere Pflicht, zu eruieren, ob Sie den Auftrag annehmen.«
»Aber ich arbeite nicht an Kriminalsachen.«
»Dazu kann ich nichts sagen. Ich weiß nur, dass der Insasse Sie verlangt hat.«
»Wessen wird er verdächtigt?«
»Mord. Er soll gestern Nacht draußen auf Värmdö einen Mann ermordet haben.«
»Und warum verlangt er nach mir?«
»Ich fürchte, das ist schwer zu beantworten. Er ist nämlich mehr oder weniger bewusstlos, er hatte einen Autounfall.«
Emelie nahm einen letzten Zug von der Zigarette.
Sie stand jetzt direkt vor dem Lokal.
Es sah aus, als hätten sie es ganz lustig da drinnen.
3
Seit fünf Uhr früh saß er im Auto. Schob sich General-Snus unter die Oberlippe und kaute Xylitol-Kaugummi. Wartete auf Fredric McLoud.
Der Mann, den er beschattete, folgte heute nicht seinem üblichen Muster. Es war schon zehn nach neun.
Teddy fragte sich, was passieren würde, wie er es schaffen könnte, mit diesem Job zum Ziel zu kommen – etwas Schwerwiegendes gegen McLoud zu finden –, ohne sich selbst in Schwierigkeiten zu bringen. Was auch immer geschah: er hatte sich entschieden. Er würde ein neues Leben beginnen. Er würde nicht zurück in den Knast gehen.
Er schob sich einen neuen Snus rein. Snus und Kaugummi, das war derzeit seine Dauerkombination. Als würde der Snus sonst zu dreckig. Als müsste das Grobe von etwas anderem ausgeglichen werden.
Die Banérgatan an einem gewöhnlichen Morgen im Mai, das war nicht gerade ein Ort, an dem es rockte. Von fünf bis sieben Uhr früh völlig menschenleer, als würde in all den fetten Wohnungen in diesem Viertel rein gar niemand wohnen. Vor fast einem Jahr hatte er sich auch hier befunden, allerdings in einer anderen Sache. Das war ein schräger und unangenehmer Start in sein Leben als frisch Entlassener gewesen. Doch irgendwie schien das schon lange her. Teddy war seit fast anderthalb Jahren ein freier Mann.
Als Erstes kamen die Hundebesitzer aus den Hauseingängen. Ältere Herren mit Hüten und grünen Regenmänteln, die geduldig warteten, während ihre kleinen Dackel den nächstbesten Laternenpfahl anpieselten. Jüngere Frauen in Sneakers und federleichten Daunenwesten, die sich schnell hinunterbeugten und mit Tüten die Hundekacke aufkratzten, ehe sie mit ihren Golden Retrievern Richtung Djurgårdsbron entschwanden. Gegen Viertel vor acht kamen die Männer in Anzügen und die Frauen im Businessdress, die schnell zu den in der Nähe geparkten Edelkarossen eilten oder sich zu Fuß Richtung Innenstadt aufmachten. Eine Viertelstunde später wiederum strömten die Kinder die Straße entlang, abgesehen von denen, die direkt vor den Haustüren von Taxis aufgesammelt wurden. Es waren aber nicht die umweltschonenden Volvos von Taxi Stockholm oder die klimaneutralen Toyota Prius mit Zertifikat, die auf die Siebenjährigen warteten, sondern andere Marken, andere Firmen. Teddy wusste nicht, wie sie hießen, aber er hatte schon davon gehört. Die Autos wurden über eine dazugehörige App vorbestellt und direkt über die Kreditkarte bezahlt.
Ganz oben, in einer toprenovierten Dachwohnung von über dreihundert Quadratmetern, wohnte die Familie. Es war für Fredric McLoud in den letzten Jahren steil bergauf gegangen. Aber damit war jetzt vielleicht Schluss. Je nachdem, wie gut Teddy seinen Job machte.
Um halb zehn kam er dann endlich: Fredric McLoud. Nicht in Anzug und Schlips, wie man es vielleicht von dem Geschäftsführer und Milliardär erwarten würde, der er war. Stattdessen trug er etwas, das wie Jogginghosen aussah, und ein Piqué-Shirt mit großen Segelemblemen darauf.
Teddy bemerkte sofort, dass Fredrics Verhalten heute anders war. Er stand mehrere Augenblicke still und schaute nur, dann ging er zum gegenüberliegenden Bürgersteig und begann die Riddargatan hinunter zu spazieren. Ungefähr alle hundert Meter hielt er an und schaute sich um.
Teddy stieg in genau dem Augenblick aus dem Auto, als sein Bewachungsobjekt vorüberging. Er trat an den Parkautomaten und begann mit seiner Parkkarte zu kämpfen, während McLoud hinter ihm die Straße weiterlief.
Mit dem Handy bezahlen – EasyPark stand auf dem Automaten. Wenn ich das nächste Mal jemanden beschatten soll, dann nehme ich verdammt noch mal das Fahrrad, dachte Teddy nur.
Kurz darauf begann er gemächlich, McLoud zu folgen. Sowie Fredric langsamer wurde, holte Teddy sein Handy heraus und tat so, als würde er stehen bleiben, um eine SMS zu schreiben.
So sah jetzt sein Alltag aus. Der Job bei der Anwaltsfirma Leijon war ihm von Markus Hassel, einem der dortigen Partner, angeboten worden, den er von früher her kannte. Er war nicht in der Kanzlei angestellt, das hatte Hassel dann doch zu heftig gefunden, aber die hatten so eine Art Jobagentur namens Leijon Juristische Dienste AG, die sie für sogenannte freie Aufträge benutzten. Der Deal war wirklich großzügig. Das Unternehmen übernahm die Kosten für den Dienstwagen und hatte ihm auch zur Kreditkarte verholfen, obwohl sämtliche Prüfungen seiner Kreditwürdigkeit todsicher ergeben hatten, dass seine gemeldeten Einkünfte in den letzten zehn Jahren nicht einmal in die Nähe des Existenzminimums gekommen waren.
Seine Arbeit für die Kanzlei bestand hauptsächlich aus sogenannten personal due diligences.
Fredric McLoud war einer der Gründer von Superia, einem Internet-Bezahldienst, der in den letzten Jahren offensichtlich enorm gewachsen war. Laut Magnus Hassel war das Unternehmen mehr als »ein Yard« wert, wie er sich ausdrückte, »und damit meine ich Euro«.
Ein Klient der Kanzlei wollte sich mit zwanzig Prozent in das Unternehmen einkaufen. Nun ging aber das Gerücht, der junge Fredric McLoud wäre ein fröhlicher Kokser, und dies nicht nur einmal im Monat. Vielmehr war von täglichem Gebrauch die Rede und dass der Typ keine vormittägliche Besprechung durchhalten konnte, ohne vorher auf der Toilette zwei Linien zu ziehen.
Teddy beschattete ihn nunmehr seit drei Wochen, ohne etwas Merkwürdiges festzustellen. Entweder hatte McLoud ein Riesen-Kokslager zu Hause, oder er bekam den Stoff auf eine Weise geliefert, die für Teddy nicht ersichtlich war. Oder aber er kokste nicht in dem Ausmaß, wie getratscht wurde. Gerüchte waren eben doch nur Gerüchte, und die wurden oft bewusst gestreut, um eine Karriere zu ruinieren.
Doch heute hatte Teddy Witterung aufgenommen. Jetzt durfte nur nichts schiefgehen.
Sein Kunde wanderte weiter über die Nybrogatan und runter zur Birger Jarlsgatan. Wenn McLoud sich vorsichtiger verhalten hätte, wäre es Teddy schwergefallen, ihm zu folgen, doch alle seine Gesten und Bewegungen waren überdeutlich. Er wurde langsamer, um dann stehen zu bleiben und sich in alle Richtungen umzusehen. Solange Teddy langsam ging, würde er McLoud nicht stören.
An der Ecke Nybrogatan/Riddargatan saß eine Bettlerin. Buntes Kopftuch im Kontrast zu faltiger dunkler Haut. Pappstücke als Unterlage unter dem sich ausbeulenden lila Rock. Die Frau summte eine Melodie wie einen Trauergesang aus einer anderen Welt. Ehe Teddy eingefahren war, hatte es die Bettler in dem Ausmaß in Stockholm nicht gegeben, die waren neu. Er bemerkte die Blicke der Passanten: sie sahen zu Boden, wandten das Gesicht ab, taten so, als gäbe es die Frau nicht.
Die Räume der Kanzlei Leijon waren nicht weit von hier. Doch heute musste Teddy nicht hingehen. Er hatte dort kein eigenes Büro und war froh darüber. Solche Ermittlungen regelte er im Großen und Ganzen selbst, und oft genügte es, wenn er per Mail Bericht erstattete oder den verantwortlichen Anwalt anrief. Außerdem wollte er nicht so gern Emelie Jansson begegnen. Vor ungefähr einem Jahr hatten sie sich zum Abendessen verabredet, was auf ihre Initiative hin geschehen war. Doch dann hatte sie angerufen und den Termin verschoben, und beim nächsten Mal musste er verschieben, woraufhin wiederum sie das nächste Treffen sehr kurzfristig absagen musste. Und so verschwanden die Essenspläne wie Seifenreste im Abfluss der Dusche.
Es war erst Viertel vor zehn, und die meisten Tische der Straßencafés waren noch leer. Dennoch waren erstaunlich viele Menschen auf den Straßen unterwegs. Teddy kam nicht umhin zu denken, dass diejenigen, die in diesen Vierteln arbeiteten und die am allermeisten verdienten, es auch am ruhigsten angehen ließen. Für manche begann der Arbeitstag einfach erst jetzt.
Viele waren gut gekleidet, die Männer, die vorbeieilten, trugen schmale Anzüge, deren Hosenbeine zu kurz wirkten, aber vielleicht sollte das ja so sein. Die Frauen trugen hochhackige Schuhe, fluffig frisch gewaschene Haare und Rolex-Uhren mit rosa Gehäuse.
Er dachte an seine Schwester und seinen Neffen Nikola. Am Tag zuvor war er zum Abendessen bei Linda gewesen. Sie hatte die Haare zu einem Knoten gedreht und sah so sonnengebräunt aus, dass Teddy der Verdacht kam, sie sei wieder solariumsüchtig.
»Morgen wird Nikola rauskommen«, sagte sie. »Und ich weiß nicht, was ich tun soll.«
Teddy teilte eine Kartoffel, die er eben gepellt hatte, und tat ein wenig Butter darauf. »Er ist jetzt erwachsen, das ist nicht mehr deine Verantwortung. Aber er wird schon klarkommen.«
»Woher willst du das wissen?«
»Ich weiß gar nichts. Aber wir müssen an ihn glauben. Er braucht unsere Unterstützung.«
Linda schnitt ihren Hackbraten sorgfältig in fünf gleich große Teile, ihre Hände sahen nicht mehr jung aus. »Er schaut zu dir auf, er will so werden wie du. Und meine einzige Hoffnung ist, dass er nicht so wird wie du.«
»So wie ich war, meinst du ja wohl, oder?«
Linda sah auf ihren Teller. »Ich weiß nicht, was ich meine«, erwiderte sie.
Fredric McLoud betrat das Espresso House.
Teddy blieb stehen. Sollte er ihm folgen und damit riskieren, dass sein Objekt misstrauisch wurde? Fredric müsste den kräftigen Mann bemerkt haben, der ihm bis hierher gefolgt war. Bis jetzt war nichts Merkwürdiges daran, aber wenn Teddy nun auch noch im selben Café auftauchte, könnte das wie ein unwahrscheinlicher Zufall wirken.
Trotzdem folgte er ihm. Die Muster des Objekts waren heute verändert. Das bedeutete etwas.
Außerdem schien Fredric McLoud so von der Rolle zu sein, dass er die Hälfte der Zivilfahnder Stockholms auf den Fersen gehabt haben könnte, ohne auch nur zu bemerken, dass außer ihm noch jemand anders auf der Straße unterwegs war.
Teddy stellte sich in die Schlange am Tresen. Er sah, dass Fredric sich an einen Tisch setzte, an dem bereits ein junger Mann mit einer Flasche Cola Zero vor sich saß.
Unter dem Tisch stand eine Plastiktüte.
Fredric schüttelte dem Typen die Hand. Der andere sah jung aus, dunkle Haare, dunkle Augen. Windjacke und softe Adidas-Hosen.
Jogginghosen: Teddy musste daran denken, wie er selbst in dem Alter ausgesehen hatte. Einmal war Dejan wegen Gewalttätigkeit in einer U-Bahnstation vor Gericht gekommen. Eine Scheißangelegenheit, aber Teddy und ein paar andere Kumpels hatten beschlossen, sich das Verfahren anzusehen. Um Dejan zu unterstützen, aber auch aus Spaß, denn es gab an dem Tag nichts Besseres zu tun. In der Pause kam Dejans Anwalt zu Teddy. »Haut ab, ich will hier nicht einen Haufen Leute mit euren Hosen auf den Zuhörerplätzen haben.«
»Wie, mit unseren Hosen?«, fragte Teddy.
»Ja, ihr seht doch alle gleich aus, und der Richter weiß genau, was ihr für welche seid. Verschwindet. Es hilft eurem Freund nicht, wenn er mit Jogginghosen in Verbindung gebracht wird. Glaubt mir.«
Die Ironie des heutigen Tages war nur, dass Fredric McLoud mindestens genauso jogginghosenmäßig aussah wie der Jogginghosentyp selbst.
Teddy hielt sein Telefon in der Hand, die Videofunktion war eingeschaltet. Er tat wieder so, als würde er auf dem Gerät tippen, doch in Wirklichkeit richtete er die Linse auf Fredric und den Jogginghosentyp. Diese neuen Dinger, die konnten wirklich zaubern.
Alles muss dokumentiert werden, so lautete die Anordnung der Kanzlei. Hier ging es um das Sammeln von Beweisen. Aber ohne sich selbst zu erkennen zu geben.
Es dauerte nur einen Moment. Fredric sagte etwas. Der Joggingtyp antwortete. Fredric griff sich die Tüte unter dem Tisch, stand auf und ging davon.
Teddy sah ihn durch die großen Fenster draußen auf der Straße. Ein ungewöhnlicher Anblick – einer von Stockholms reichsten Mittdreißigern mit einer versifften Supermarkttüte in der Hand. Doch er hatte alles auf Video.
Er blieb am Glastresen stehen. Jetzt war er an der Reihe. Macadamianüsse, Rawfood-Bällchen und grüne Säfte. Früher einmal, ante Knast, hatten Süßigkeiten noch Mehl und Zucker enthalten.
»Was darf es sein?«, fragte das Mädchen an der Kasse.
»Haben Sie eine ganz normale Zimtschnecke?«
»Ja, aus Sauerteig.«
»Das klingt zu gesund.«
Der Blick des Mädchens flackerte.
Teddy verließ den Laden.
Zehn Meter vor ihm wanderte Fredric »der Koksfreier« McLoud wieder die Riddargatan hinauf.
Warum war es für Leijon wohl so wichtig, dass Teddy das hier tat? Er wollte einen hundertprozentigen Beweis, selbst wenn es die Ermittlungen gefährden würde.
Das Wetter war klar, weiter oben in den Häusern blitzte die Sonne in den Fenstern. Teddy spürte, wie sein Stresslevel stieg. Er ging zu einer Frau mittleren Alters, die an einem der Parkautomaten stand.
»Entschuldigen Sie, wenn ich störe, aber darf ich Sie um einen Gefallen bitten?«
Die Frau wandte sich um. Sie sah gestresst aus – vielleicht fragte sie sich, welche App ihr Problem würde lösen können –, doch sie antwortete mit sanfter Stimme: »Natürlich.«
»Wie schön. Sehen Sie den Mann, der da vorne geht?«
Teddy zeigte auf Fredric.
»Ja, wieso?«
»Achten Sie auf ihn.«
Er nahm wieder sein Telefon heraus, diesmal schaltete er die Tonaufnahme ein. Das Handy stammte ebenfalls von der Kanzlei Leijon, und er hatte den Umgang damit schneller gelernt als gedacht. Doch manchmal hätte er das Ding am liebsten ins Wasser geworfen oder von irgendeinem Balkon. Den Kalender verweigerte er hartnäckig, hatte aber ansonsten den Widerstand weitgehend aufgegeben. In diesem Job war das Teil einfach eine großartige Bereicherung.
Er hatte jetzt zu Fredric McLoud aufgeschlossen. Tippte ihm auf die Schulter.
»Entschuldigen Sie, aber ich glaube, Sie haben meine Tüte mitgenommen.«
Fredric zog die Tüte an sich.
»Wer sind Sie? Wovon reden Sie?«
»Ich habe meine Tüte verloren, und das da ist, glaube ich, meine.«
Fredric glotzte ihn an. In einem Augenwinkel zuckte es.
»Sind Sie verrückt? Auf keinen Fall ist das Ihre.«
»Darf ich mal reinschauen?«
»Nie im Leben.«
Teddy handelte schnell. Er packte Fredrics Arm und streckte die andere Hand nach der Tüte aus.
Fredric erhob die Stimme. »Was zum Teufel machen Sie da? Lassen Sie meine Tüte los.«
»Ich will nur eben reinschauen, das kann doch kein Problem sein.«
»Auf keinen Fall. Das ist MEINETÜTE.«
Teddy durfte jetzt nicht lockerlassen. Er musste im Moment bleiben – einfach agieren, nicht analysieren. M.E.M. – machen, einfach machen, wie Dejan immer sagte.
Er griff noch einmal nach der Tüte und zog gleichzeitig an Fredrics anderem Arm, um ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen. Sie stolperten herum. Teddy war mächtiger, stärker. Aber Fredric McLoud war auch kein kleiner Wicht. Und er kämpfte für sein Unternehmen, seine Familie, sein Leben.
Sie stolperten weiter herum.
Dann verspürte Teddy einen üblen Schmerz in der Hand, die die Tüte hielt. Er sah hinunter. Fredric hatte ihn in den Daumen gebissen.
Nein, nein, er durfte nicht schreien. Nicht brüllen. Das hier musste anständig abgehen, das hatte er sich geschworen.
Er hätte Fredric einen Zeigefinger ins Auge stechen können. Ihm mit voller Kraft eins auf die Nase geben. Seinen Adamsapfel packen und einfach rausreißen. Stattdessen presste er Fredrics Kopf hinunter, drückte seine große Hand an seine Wange und versuchte ihn so einzuklemmen, dass er gehorchte.
Am Ende ließ Fredric seinen Daumen los. Teddy sah Blut an den Zähnen des Typen.
Jetzt galt es, die Sache unter Kontrolle zu bringen. Die Situation abzukühlen. Er stand dicht bei McLoud.
Die Frau rief etwas im Hintergrund. »Hören Sie auf damit. Ich habe die Polizei gerufen.«
Teddy keuchte. »Sie haben sie gehört. Ich bin ziemlich sicher, dass Sie nicht möchten, dass die Polizei hier aufkreuzt und feststellt, was Sie in Ihrer Tüte haben. Lassen Sie mich nur reinschauen.«
Panik. McLouds Augen wurden riesig. Der Typ begriff.
Zu spät – für Teddy. Fredric McLoud rannte los.
Noch war nichts verloren. Teddy raste hinterher.
Die Riddargatan hinauf. Links in die Artillerigatan.
Bergauf. McLoud hatte lange Beine. Und Teddy wusste, dass er dreimal die Woche im schicken Takkei-Fitness-Studio am Grand Hôtel trainierte.
Er selbst war zu schwer, das merkte er jetzt.
Erst den Hügel hinauf. Links das Armeemuseum. Dann rechts ein Elektroladen.
Rein in die Storgatan. Bald würde ihm die Puste ausgehen.
Die Leute sahen ihnen nach. Ein paar riefen.
Dann plötzlich war er weg.
Verdammt, wohin war McLoud verschwunden?
Weiter unten in der Straße ein Polizeiauto.
Shit, Shit, Shit. So durfte das hier nicht enden.
Er ging langsamer. Links der Schwedische Wirtschaftskontrolldienst. Rechts ein Herrenausstatter. Der Erste, den sich die Bullen greifen, ist einer, der rennt. Er versuchte, Atem zu holen. Zu analysieren.
Wo versteckte sich McLoud? Er musste hier irgendwo sein, nur wenige Meter entfernt. Er konnte doch nicht einfach verschwinden.
Die Streife war jetzt dreißig Meter hinter Teddy. Sie fuhr Schneckentempo.
Er musste etwas tun.
Zwanzig Meter.
Teddy sah sich um. Die Leute hatten ihn rennen sehen, sie könnten auf ihn zeigen. Es gab keine Alternative: er betrat den Herrenausstatter. So ruhig und gelassen, wie er konnte.
Tweedjacketts, Manchesterhosen, Jägerkappen. Hier drinnen herrschte nicht gerade Frühlingsstimmung. Er tat ein paar Schritte in den Laden hinein – immer noch total konzentriert darauf, was hinter seinem Rücken draußen auf der Straße geschah.
Die Polizeistreife – hoffentlich fuhr sie vorbei.
Und plötzlich musste er fast lachen. Weiter drinnen im Laden, bei den Anzügen, stand Fredric McLoud und hatte ihm den Rücken zugedreht. Er hielt immer noch seine Plastiktüte in der Hand. Offenbar hatte er dieselbe Idee wie Teddy gehabt.
Dieser tippte ihm jetzt wieder auf die Schulter. »Ich glaube, sie fahren vorbei. Zumindest, wenn wir uns ruhig verhalten.«
McLoud sah nicht mehr panisch aus. Jetzt war er den Tränen nahe.
»Wer sind Sie, und warum tun Sie das?«
Teddy: »Tut mir leid. Schweigepflicht.«
4
Als die Gesprächsrunde für den Tag vorüber war, stand Nikola schon vorm Klassenzimmer. Leben in konzentrierter Form, das war er: immer als Erster raus. Sein Bild vom Ende der Schulstunden im Laufe seiner Jugend, das waren leere Flure, vollgekritzelte Schränke, die Stille, ehe der Rest der Klasse einen Moment später aus dem Raum stürmte. Nikola hatte schon immer zu viel Energie in der Hose, um ruhig sein Zeug zusammenzupacken und noch hocken zu bleiben und mit den Klassenkameraden zu klönen. Ihn setzte immer eine unsichtbare Kraft unter Druck, sich eine Mikrosekunde lärmfreien Korridors zu erkämpfen. Einen kleinen Splitter Ruhe.
Doch das war alles lange her. In den letzten Jahren hatte es für ihn nicht viel Schule gegeben.
Die Mutter und die Schulleiterin nannten sein Verhalten leichtes ADHS. Doch Nikola nahm weder Ritalin noch irgendwelche Selbstmedikation mit A, wie einige der anderen Jungs hier. Die wollten doch nur ihr Etikett auf die Lebenskraft kleben, die unter dem Goldkreuz auf seiner Brust brannte. Das goldene Kreuz, das er von Teddy bekommen hatte, ehe der für seine acht Jahre einfuhr.
Doch die ganze Schwanzlutscherei interessierte heute nicht mehr. Das Leben: krass naiß, denn heute war der Tag. Der LETZTE Tag.
Bald würde Chamon ihn abholen und aus diesem Loch wegbringen.
Ein einziger letzter kleiner Scheiß stand noch aus: ehe Nikola abreisen durfte, musste er noch das Abschlussgespräch mit dem Anstaltsleiter abhaken.
Irgendwie schaffte es Anders Sanchez Salazar, dass sein Zimmer jedes Mal exakt gleich aussah, wann immer Nikola dort hineingenötigt wurde.
Nicht nur, dass die beiden Besucherstühle auf die gleiche Weise unter den Schreibtisch geschoben oder die Gardinen zur Hälfte vorgezogen waren, genau wie letztes Mal. Alles war exakt eine Kopie vom letzten Mal. Die Stapel Papier, der Stifteköcher hinter dem Computerbildschirm, die Fotos von all seinen Kindern: alles stand genau an derselben Stelle. Sogar der Kaffeebecher mit dem Hammarby-Emblem war in derselben Ecke des Schreibtisches platziert wie beim letzten Mal.
Das Einzige, was wechselte, war die Farbe der Strickjacke von Anders. Heute war es ein Hellrot. Letztes Mal war es Weinrot gewesen.
»Nun, Nikola, wie fühlst du dich?«
Nikola bemühte sich, nicht allzu breit zu grinsen.
»Ich fühl mich super, echt.«
»Es kann einem ja auch ein bisschen Angst machen, Spillersboda zu verlassen, wenn man hier so lange war wie du, oder?«
Jetzt musste Nicko richtig an sich halten.
»Ja«, sagte er. »Ein bisschen.«
»Aber es wird schon alles gut gehen. Und wie ich gehört habe, wirst du jetzt bei deiner Mutter wohnen?«
»Ja, sie hat versprochen, mich aufzunehmen. Und ich hab ihr versprochen, mich anzustrengen.«
»Ist denn die Beziehung zu deiner Mutter jetzt besser?«
»Absolut. Sie ist echt die Beste der Welt.«
Jahre der Kontakte mit Jugendamts-Tussen, Rektoren, Beratern und Bullen hatten ihn ausgebildet – er war der Experte für die Experten. Es war nicht schwer, sich auszurechnen, was die gern hören wollten. Die Kunst war, es auf eine glaubwürdige Weise rüberzubringen. Das Einzige, was hier stimmte, war tatsächlich irgendwie, dass seine Mutter auf eine Art die Beste von allen war.
»Und noch was, Nikola«, sagte Anders. »Halt dich fern von deinen alten Kumpels. Das sind sicher alles gute Jungs, das meine ich nicht. Aber das gibt nur Schwierigkeiten. Oder Stress, wie ihr sagt.«
Chamon fummelte an seiner Gebetskette herum. Er hatte erst seit knapp drei Monaten einen Führerschein, aber der Audi, an den er gelehnt stand, wirkte jünger als das. Die 20-Zoll-Felgen glänzten, wie Nikolas Goldkreuz es getan hatte, als es noch neu gewesen war. Er wusste, dass der A7er dem Cousin seines Kumpels gehörte, aber wenn man an einen Ort wie diesen fuhr, dann markierte man doch gern, dass man ein anderes Leben führte.
»Meksthina?«
Nikola grinste und schob sich einen Snus unter die Oberlippe und antwortete in derselben Sprache. »Abri, lass uns abhauen, wir machen es wie Zlatan.«
Die meisten kannten ihn nur als Nicko. Aber seine Neffen nannten ihn manchmal den Bibelmann, weil sie fanden, er würde ein Syrisch wie in den alten Büchern reden. Alle anderen waren beeindruckt, denn Nicko war der einzige Typ, den sie kannten, der ihre Sprache beherrschte. Aber was war daran denn so verwunderlich, er war doch schließlich mit ihnen aufgewachsen? Sein Großvater hatte ihn gelehrt, alles mitzunehmen, was man kann.
»Wie Zlatan?«
»Hattrick, Bro. Ich hab von einem Typen hier drin, der mir was schuldig war, drei Joints gekriegt. Die ziehen wir uns rein, wenn wir zu Hause sind.«
»Du bist echt witzig. Aber du machst auch bei dem Ding mit, oder?«
Nikola wusste, wovon er sprach. Die Anfrage von Yusuf. Das Ding.
Direkt für Isak. Geiler Scheiß.
Sie gingen aufs Tor zu.
Die Jungs auf dem Hof wichen beiseite, als Nikola und Chamon vorbeisofteten.
»Hast du da eigentlich was am Laufen gehabt? Bei deinem letzten Ausgang hab ich dich gar nicht getroffen.«
»Hell, yeah. Ich hatte mehr Ärsche als die Damentoilette im The Strip.«
Chamon lachte laut. »Walla.«
Das Tor wurde geöffnet, und sie traten hinaus. Die Frühlingssonne stach heute. Das Laub an den Bäumen da draußen war hellgrün und erinnerte in der Form ein bisschen an Marihuana, nur größer. Sandra sagte, die Bäume würden Kastanien heißen.
»Verdammt, ich sollte sofort ein Insta machen und das posten, um zu feiern. Schließlich ist es das letzte Mal, dass ich meinen Fuß hierhin setze, und ein Jahr lang hab ich von meinem Fenster auf diesen Baum gestarrt.«
»Du hast Instagram?«, fragte Chamon.
Noch ehe er antworten konnte, hörten sie eine Stimme hinter sich. »Nikola, kannst du mal kurz zurückkommen?«
Sie drehten sich um. Sandra war es, die am Zaun stand und übers ganze Gesicht strahlte. Seltsam, eigentlich war sie richtig süß.
»Wassnlos?«, fragte Nikola.
»Ich müsste mit dir noch über eine letzte Sache reden. Wäre super, wenn das ginge.«