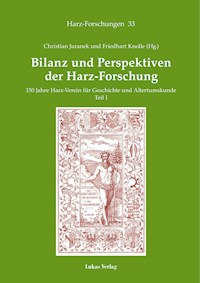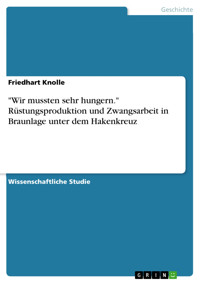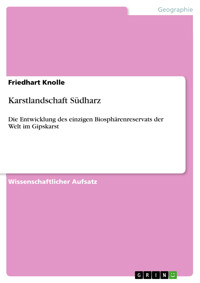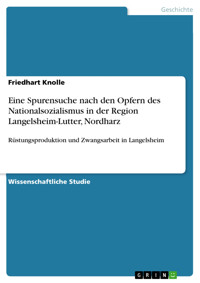15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Skript aus dem Jahr 1999 im Fachbereich Geschichte Deutschlands - Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg, , Sprache: Deutsch, Abstract: Am 2. Juni 1945 übersandte das Erzbergwerk Rammelsberg der provisorischen Nachkriegs-Stadtverwaltung Goslar eine Liste der im „Ostarbeiterlager“ im Bergtal unterhalb des Herzberger Teiches untergebrachten ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus der Ukraine. „Displaced Persons“, kurz DPs, wurden diese Menschen nun genannt, die das Naziregime von 1939 bis 1945 aus ganz Europa zusammengetrieben hatte, um für die deutsche Kriegswirtschaft zu arbeiteten. Viele der DPs wußten nicht wohin. Sie waren seit Jahren fern ihrer Heimat, insbesondere diejenigen, die aus dem Osten Europas ins Reich zwangsverschleppt worden waren. Viele hatten Angst zurückzukehren, denn in der Sowjetunion wurden sie, so zynisch es auch war, als Verräter angesehen und oft genug in Stalins GULAG gesteckt. So wurden sie von den Alliierten zusammengefasst und kamen in ehemaligen Zwangsarbeiterlagern unter. Nach der genannten Liste war die älteste Arbeiterin 69 Jahre alt, das jüngste Kind gerade ein Jahr. Nach einer amtlichen Statistik des Gauarbeitsamtes Südhannover-Braunschweig vom Juni 1944 waren im Gau bei einer Anzahl von insgesamt 868.000 Beschäftigten knapp 300.000 Ausländer tätig, davon 227.000 „Zivilarbeiter“ und 70.500 Kriegsgefangene. Sie arbeiteten in großen und kleinen Fabriken, in der Landwirtschaft, bei Handwerkern, bei der Reichsbahn und in städtischen Betrieben. In Goslar waren es nach Mitteilung an die Gestapo Braunschweig im Juni 1944 2.300 Ausländerinnen und Ausländer. Insgesamt arbeiteten während des Krieges etwa 5.000 Menschen aus dem europäischen Ausland in der Stadt und ihrer Umgebung. 61 Betriebe bedienten sich in diesem Zeitraum ihrer Arbeitskraft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2000
Ähnliche
Page 1
„Gebt uns unsere Würde wieder“ - Kriegsproduktion und
Zwangsarbeit in Goslar 1939 - 1945Eine Begleitbroschüre zur gleichnamigen Ausstellung
von Dr. Peter Schyga unter Mitarbeit von Frank Jacobs und Friedhart Knolle
Einleitung
Am 2. Juni 1945 übersandte das Erzbergwerk Rammelsberg der provisorischen Nachkriegs-Stadtverwaltung Goslar eine Liste der im „Ostarbeiterlager“ im Bergtal unterhalb des Herz-berger Teiches untergebrachten ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus der Ukraine. „Displaced Persons“, kurz DPs, wurden diese Menschen nun genannt, die das Nazi-regime von 1939 bis 1945 aus ganz Europa zusammengetrieben hatte, um für die deutsche Kriegswirtschaft zu arbeiteten. Viele der DPs wußten nicht wohin. Sie waren seit Jahren fern ihrer Heimat, insbesondere diejenigen, die aus dem Osten Europas ins Reich zwangsverschleppt worden waren. Viele hatten Angst zurückzukehren, denn in der Sowjetunion wurden sie, so zynisch es auch war, als Verräter angesehen und oft genug in Stalins GULAG gesteckt. So wurden sie von den Alliierten zusammengefasst und kamen in ehemaligen Zwangsarbeiter-lagern unter. Nach der genannten Liste war die älteste Arbeiterin 69 Jahre alt, das jüngste Kind gerade ein Jahr. Nach einer amtlichen Statistik des Gauarbeitsamtes Südhannover-Braunschweig vom Juni 1944 waren im Gau bei einer Anzahl von insgesamt 868.000 Beschäftigten knapp 300.000 Ausländer tätig, davon 227.000 „Zivilarbeiter“ und 70.500 Kriegsgefangene. Sie arbeiteten in großen und kleinen Fabriken, in der Landwirtschaft, bei Handwerkern, bei der Reichsbahn und in städtischen Betrieben. In Goslar waren es nach Mitteilung an die Gestapo Braunschweig im Juni 1944 2.300 Ausländerinnen und Ausländer. Insgesamt arbeiteten während des Krieges etwa 5.000 Menschen aus dem europäischen Ausland in der Stadt und ihrer Umgebung. 61 Betriebe bedienten sich in diesem Zeitraum ihrer Arbeitskraft.
Die größten Arbeitgeber waren die Chemische Fabrik Gebr. Borchers A.G./H.C. Starck, die Unterharzer Berg- und Hüttenwerke G.m.b.H. mit dem Erzbergwerk Rammelsberg, der Flie-gerhorst Goslar, ab August 1944 die Betriebe bzw. Ämter Büssing, Chemische Fabriken Oker & Braunschweig, Harzer Weinbrunnen, Harzer Grauhof-Brunnen, Greifwerke, Dr. Genthe & Co., Luther-Werke & Jordan, Bleiwerk Goslar, Ernst Schmutzler, Reichsbahnbetriebsamt Goslar, Maschinenfabrik H. Weule, Stadtforstamt Goslar, Joseph Gastrich und List. Die Arbeiterinnen und Arbeiter waren in folgenden Sammellagern untergebracht:
- Lager des Erzbergwerks Rammelsberg
- Unterkünfte der Firma Borchers Im Schleeke und Sudmerberg 7 und 8a
- Unterkünfte der Greifwerke in der Zehntstraße 6 und Bergstraße 4
- Baracken auf dem Flugplatz und an der Astfelder Straße
- Wohnlager Petersberg
- Goslarhalle
- Lager auf den Domänen.
Page 2
Etliche wohnten auch in anderen speziellen Unterkünften ihrer Arbeitgeber.
Seit dem Überfall auf Polen rekrutierten die Häscher des NS-Regimes aus den besetzten Ländern Arbeitskräfte, um die zur Wehrmacht eingezogenen Arbeiter und Angestellten zu ersetzen und die Rüstungsmaschinerie am Laufen zu halten. Noch waren es nicht viele, denn noch war die Kriegsrüstung nicht „total“. Doch mit dem Überfall auf die Sowjetunion änderte sich das, erst recht nach der Niederlage von Stalingrad. Die Betriebe mussten ihr Personal an die Wehrmacht und Waffen-SS abgeben. Ersetzt wurden die Deutschen durch ausländische Arbeitskräfte, die systematisch über die Arbeitsamtsverwaltung des Reichs in die Zwangsarbeit gepresst wurden. Wo die Wehrmacht auch hinmarschierte, das Stadtbild wurde „bunter“. Erst kamen Tschechen und Slowaken, dann Polen. Nach dem „Frankreichfeldzug“ kamen Holländer, Belgier und Franzosen. Im „Balkanfeldzug“ wurden Slowenen und Serben überwältigt und ins Reich ge-schafft. Nach dem Überfall auf die Sowjetunion bemächtigten sich die Organisationen Todt und Sauckel der Menschen der Völker der Sowjetunion; nach Goslar kamen im wesentlichen Ukrainer und Russen. Goslar wurde aus einer verträumten, mittelalterlich anmutenden, von Handwerk, Mittelstand und Fremdenverkehr geprägten Stadt zu einem wichtigen Ort der Rüstungsproduktion des Naziregimes. Blei, Kupfer und Zink des Rammelsberges und der Hütten im Okertal waren begehrt, die Stahlveredelungsprodukte und Arsenverbindungen der Firma Borchers A.G./ H.C. Starck ebenso. Beide Betriebe wurden mit staatlichen Mitteln ab 1935/36 ausgebaut, Produktion und Belegschaften mehr als verdoppelt.
Das „Rammelsbergprojekt“ und seine historische Aufarbeitung
Am 13. Dezember 1935 widmete die Goslarsche Zeitung (GZ) der Ankündigung eines neuen Industriekonzepts am Rammelsberg zwei Druckseiten. Bergrat v. Scotti hatte Teile einer Denkschrift zum sogenannten "Rammelsbergprojekt" einer ausgesuchten Öffentlichkeit aus Goslar vorgestellt:„Der Rammelsberg ist die bedeutendste Erzlagerstätte in Deutschland. Aufgeschlossen in Form von Erz ist dort ein Metallvorrat von nahezu 2.000.000 t an Zink, Blei und Kupfer, von 1.000.000 kg Silber und 7.500 kg Gold nachgewiesen. Alles spricht dafür, daß außerdem noch einmal die gleiche Erzmenge unaufgeschlossen der späteren Erschließung harrt. Trotzdem wurde der Rammelsberg bisher nicht genügend zur deutschen Metallversorgung herangezogen, obwohl mehr als die Hälfte des deutschen Metallverbrauchs aus dem Ausland bezogen werden müssen. Er konnte unserer Volkswirtschaft bisher jährlich nur 23.000 t an Zink, Blei und Kupfer, 16.000 kg Silber und 130 kg Gold liefern. Der Grund dafür liegt darin, daß eine Steigerung der Erzeugung durch bloße Erweiterung der Anlagen unter Beibehaltung des alten und veralteten Gewinnungsverfahrens heute nicht mehr zulässig ist und noch dazu ein wirtschaftlicher Unsinn wäre.
Die Rammelsberger Erze sind zwar metallreich, in sich aber so unendlich fein verwachsen, daß ihre Verarbeitung auf Metall sehr schwierig ist. Erst neuerdings ist es gelungen, für die Verarbeitung der mengenmäßig bei weitem überwiegenden Bleizinkerze ein befriedigendes Verfahren zu finden. Erst dieses neue Verfahren bietet technisch die Möglichkeit zur Steigerung der Erzeugung. Wir haben uns deshalb entschlossen, dieses jetzt unverzüglich durch- zuführen.
Page 3
Unser Rammelsbergprojekt sieht eine Steigerung unserer Metalljahreserzeugung auf 66.000 t Zink, Blei und Kupfer, 35.000 kg Silber und 200 kg Gold vor. Für ein Viertel der Erzförderung, nämlich für die auf unserer Okerhütte verhütteten kupferhaltigen Melierterze, genügt eine Ergänzung der Anlagen ohne wesentliche Veränderung des Verfahrens. Für die übrigen drei Viertel, nämlich für die bisher auf unseren beiden anderen Hütten verhütteten Bleizinkerze, müssen eine Aufbereitung und eine Hütte von Grund auf neu gebaut werden. Für die Metallerzeugung ergibt sich hierbei neben der Steigerung vor allem auch eine wesentliche Verbilligung ... Dabei wird der Devisenwert einer einzigen Jahreserzeugung an Metallen aus dem Rammelsberg nach heutigen niedrigen Weltmarktpreisen berechnet, von bisher 5.500.000 RM auf 14.000.000 RM steigen. Hierzu ist eine einmalige Aufwendung von 19.000.000 RM für Neuanlagen erforderlich. Neben diesen bedeutenden nationalwirtschaftlichen und privatwirtschaftlichen Gründen sprechen dringende wehrpolitische und soziale Gründe für die Durchführung des Projekts.“
Die Kosten waren viel zu niedrig angesetzt. 98,87 Mio. RM an Förderprämien steckte das NS-Regime in das Projekt. Noch drei Jahre vorher war das Bergwerk und mit ihm die Hütten von der Schließung bedroht. Nur mit Fördermitteln der damaligen Länder Preußen und Braun-schweig sowie des Reichs in Höhe von 8 Mio. RM konnte im Juni 1932 eine Schließung der Betriebe verhindert werden.
Heute gehört das Bergwerk zusammen mit der Goslarer Altstadt zum Weltkulturerbe der UNESCO. Über 1.000 Jahre Bergwerksgeschichte werden im Rammelsbergmuseum dem