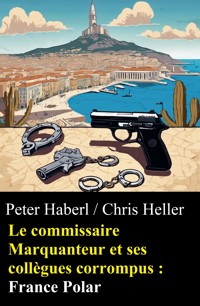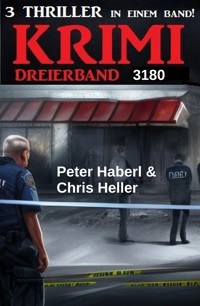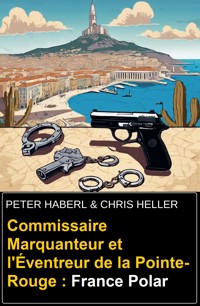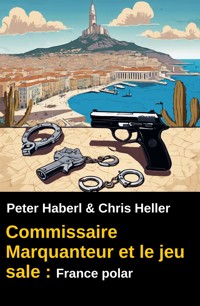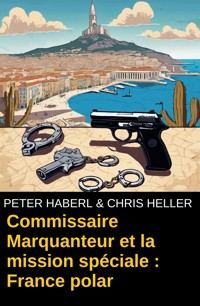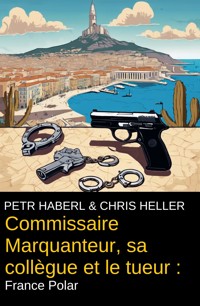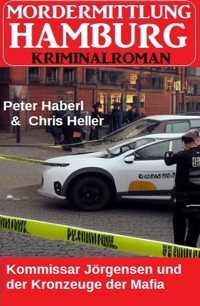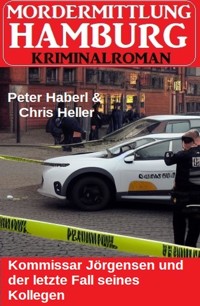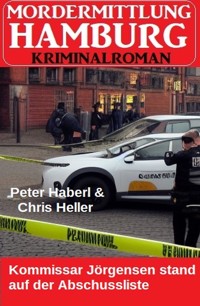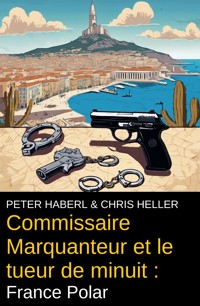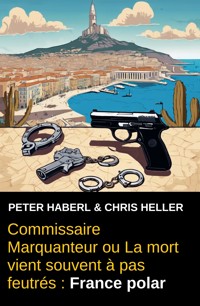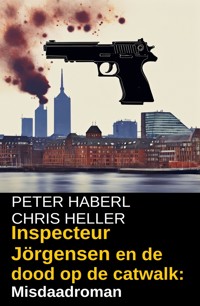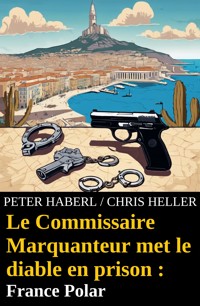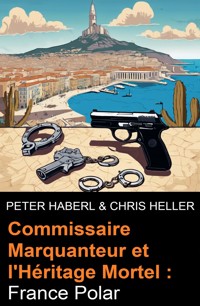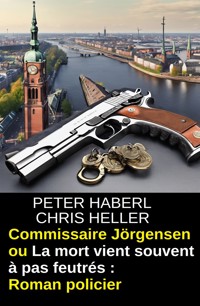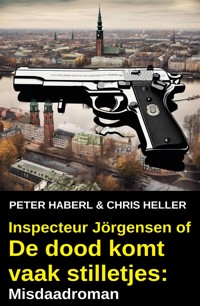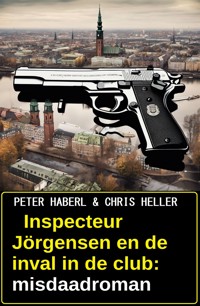: Mordermittlung Hamburg
Kriminalroman
Krimi von Peter Haberl & Chris Heller
Melanie ist achtzehn Jahre alt und kriminell. Ein Straßenraub
wird ihr zum Verhängnis. Nun hat sie die Wahl: zwei Jahre Gefängnis
oder drei Monate Jugendhilfeeinrichtung. Melanie entscheidet sich
für die Jugendhilfeeinrichtung. Doch was sie – und einige andere
Mädchen - dort erwartet, ist schlimmer als Gefängnis ...
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books,
Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Cassiopeia-XXX-press,
Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition,
Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints
von
Alfred Bekker
© Roman by Author
Kommissar Jörgensen ist eine Erfindung von Alfred
Bekker.
Chris Heller ist ein Pseudonym von Alfred Bekker.
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress,
Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich
lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und
nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
1
Ich betrat die Kantine des Präsidiums und sah mich um. Der
Raum war voller Menschen, alle trugen Uniformen oder Anzüge - ich
kannte sie alle. Doch mein Blick blieb an einem Mann hängen, der am
Ende des Raumes stand und sich etwas zu essen holte.
Als er näher kam, erkannte ich ihn sofort: Tobias Schmitz. Ein
alter Kollege von mir, der vor ein paar Jahren eine Auszeit
genommen hatte und in den letzten Monaten im Ausland verbracht
hatte.
Ich trat auf ihn zu und wir begrüßten uns herzlich. "Lange
nicht mehr gesehen", sagte ich lächelnd.
"Ja, das stimmt", antwortete Tobias grinsend. "Aber es ist gut
wieder hier zu sein."
Wir führten Smalltalk über seine Reise ins Ausland und was bei
der Polizei in Hamburg passiert war während seiner
Abwesenheit.
Doch plötzlich wurde unsere Unterhaltung unterbrochen als ein
lautes Geräusch durch den Raum hallte - es klang fast wie eine
Explosion.
Sofort sprang ich auf die Beine und blickte mich um. Die
anderen Gäste schienen verwirrt zu sein, doch meine jahrelangen
Erfahrungen als Ermittler sagten mir: Das war kein Zufall.
Tobias musterte mich besorgt mit seinen Augen: "Was zum Teufel
war das?"
"Ich weiß es nicht genau", antwortete ich knapp zurück,
während wir uns langsam aus dem Raum begaben." Aber lass uns besser
schnell rausfinden was da los ist."
Wir rannten durch die Flure bis wir endlich in Sicherheit
waren - nur um herauszufinden dass unser Verdacht bestätigt wurde.
Es war ein Anschlag auf das Präsidium.
Ich blickte zu Tobias und sagte ernst: "Wir müssen rausfinden,
wer hinter all dem steckt."
Und so begann meine Ermittlung - getrieben von der
Überzeugung, dass ich den Täter finden werde. Gemeinsam mit meinem
alten Kollegen an meiner Seite würde ich alles tun um die
Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Ich wusste, dass es
kein einfacher Fall werden würde. Die Spuren waren verworren und
die Verdächtigen zahlreich. Doch ich war entschlossen, jeden Stein
umzudrehen und jede Möglichkeit zu prüfen.
Tag für Tag arbeiteten wir hart an dem Fall - analysierten
Beweise, befragten Zeugen und durchsuchten Datenbanken. Immer
wieder stießen wir auf neue Hinweise, doch keiner davon führte uns
direkt zum Täter.
Doch ich gab nicht auf. Ich wusste genau: Je länger der Täter
ungestraft blieb, desto größer wurde die Gefahr für unsere
Gesellschaft.
Und schließlich hatte meine Beharrlichkeit Erfolg: Wir konnten
den Drahtzieher des Anschlags überführen und ihn vor Gericht
bringen.
Es war ein harter Kampf gewesen - aber am Ende hatten sich all
unsere Mühen gelohnt. Der Gerechtigkeit war Genüge getan worden und
ich konnte mit einem guten Gewissen zurückblicken auf das was wir
erreicht hatten.
Für mich stand fest: Wenn man wirklich etwas verändern will in
dieser Welt muss man bereit sein alles dafür zu tun - auch wenn es
bedeutet bis ans Äußerste zu gehen um seine Ziele zu
erreichen!
Und dann wachte ich auf.
*
Besser gesagt: Jemand rüttelte mich an der Schulter.
“Was ist los?”
Ich setzte mich im Bett auf.
Neben mir war Rita.
Ich hatte sie vor ein paar Tagen kennengelernt. Rita hatte
dunkles Haar, hammermäßige große Brüste und ein bezauberndes
Lächeln.
Und sie schlief normalerweise nackt, was ich als eine gute
Angewohnheit ansah.
Ihre Brüste hoben sich im Halbdunkel deutlich ab. Das
Neonlicht, das von draußen hereinschien, spielte mit den Formen
ihres Körpers.
Aber ihr bezauberndes Lächeln zeigte sie im Augenblick
nicht.
Ihre Züge drückten Besorgnis aus.
“Was war los?”
“Keine Ahnung…”
“Du hast gestöhnt und geredet…”
“Im Schlaf?”
“Ja.”
“Ich habe geträumt.”
“Ein Albtraum?”
“Nein.”
“Was dann?”
“Es war kein Albtraum, aber er war trotzdem seltsam.”
“Was meinst du damit, Uwe?”
“Ich habe geträumt, dass ich einen alten Kollegen
wiedertreffe.”
“So?”
“Und zwar in der Kantine des Polizeipräsidiums.”
“Das ist ja noch nichts Ungewöhnliches.”
Ich zuckte mit den Schultern. “Der Kollege hieß Tobias
Schmitz.”
“Das ist auch nichts Ungewöhnliches.”
“Ungewöhnlich ist, dass ich noh nie einen Kollegen hatte, er
Tobias Schmitz hieß.”
“Wenn wir träumen, dann träumen wir Dinge, die nie passiert
sein können. Das geschieht. Dafür sind es doch Träume.”
“Ja. Aber während des Traums, da war ich vollkommen davon
überzeugt, diesen Tobias Schmitz gut zu kennen. Er hat ein
Sabbatical gemacht, um sich eine Weile die Welt ansehen zu
können.”
Sie lachte. Und ihre Brüste wippten dabei. “Vielleicht
solltest du das auch mal machen, Uwe.”
“Was?”
“Ein Sabbatical. Ein Jahr Pause. Vielleicht hast du das nötig
bei all dem Stress, den du ausgesetzt bist. Kriminalhauptkommissar
bei einer Sonderabteilung gegen das organisierte Verbrechen. Das
zewhrt auf die Dauer an den Nerven, wie ich mir denken
könnte.”
Ich sah sie an.
“Ein Jahr lang auf einer einsamen Insel mit dir? Meinst du,
das könnte mich kurieren?”
“Bestimmt!”, hauchte sie.
“Und was ist mit all den Verbrechern, die deshalb nicht
gefasst werden und stattdessen frei herumlaufen?”
“Du hältst dich für unersetzbar, nicht wahr?”
“Bin ich das nicht?”
“Kommissar Uwe Jörgensen, der Unersetzbare, ohne den es in
Hamburg drunter und drüber geht. Das ist es, was du glaubst?”
Ich musste lächeln.
“Naja…”
“Was?”
“Ich will nicht übertreiben.”
“Willst du nicht?”
“Nein.”
“Und warum tust du es dann?”
Sie schmiegte sich an mich. Ihre Brüste drückten gegen meinen
Oberarm.
“Du musst morgen früh raus, oder?”
“Ja”, sagte ich.
“Dann sollten wir die Zeit nutzen.”
“Nutzen?”
“Schlafen kannst du morgen noch im Dienst”, grinste sie.
*
Hamburg. Ein warmer sonniger Tag im März. Auf den Bänken in
den Anlagen und in der Fußgängerzone saßen die Menschen, hielten
die Gesichter in die Sonne und entspannten. Kinder und auch
Erwachsene hielten Eistüten in den Händen und leckten die kalte
Köstlichkeit. Eine Frau um die sechzig Jahre stand an einem
Fußgängerüberweg und wartete darauf, dass die Ampel auf grün
umschaltete.
Plötzlich rollte ein Motorrad heran. Fahrer und Mitfahrer
trugen Helme mit heruntergeklappten Visieren. Bei der Frau an der
Ampel bremste der Fahrer das Motorrad ab, der Mitfahrer griff nach
der Tasche der Frau, entriss sie ihr, dann gab der Fahrer wieder
Gas. Ehe sich jemand richtig besann, verschwand die Maschine mit
den beiden Dieben in der Seitenstraße.
Die Frau, der die Tasche entrissen worden war, war zwei
Schritte auf die Straße getaumelt, gestrauchelt und gestürzt. Ein
Auto hielt im letzten Moment mit quietschenden Rädern an.
Auf der anderen Seite der Straße standen ein etwa
zwölfjähriges Mädchen, ein Mann mittleren Alters und eine Frau um
die Zwanzig.
Hinter dem Wagen, der die ältere Frau um ein Haar überrollt
hätte, hielten weitere Fahrzeuge an. Auch auf der Gegenfahrbahn
wurde ein Pkw abgebremst. Der Fahrer verließ das Fahrzeug und eilte
zu der Frau hin. Das Mädchen, der Mann und die junge Frau von der
anderen Straßenseite rannten auf die Fahrbahn. Weitere Fahrer
sprangen aus ihren Fahrzeugen.
»Ist sie bei Rot über die Ampel gelaufen?«, rief jemand.
»Ich habe sie nicht angefahren!«, verteidigte sich der Mann,
vor dessen Wagen die Frau auf dem Asphalt lag.
»Ich hab's gesehen!«, rief der Mann, der auf der anderen
Straßenseite gestanden hatte. »Es war ein Motorrad mit einem
Soziusfahrer. Dieser hat der Frau die Handtasche entrissen. Beide
trugen Helme, bei dem Soziusfahrer hat es sich aber wahrscheinlich
um eine Frau oder ein Mädchen gehandelt. Er hatte lange Haare und
sah ziemlich zierlich aus.«
Jemand half der Frau hoch. Sie schluchzte und klagte über
unerträgliche Schmerzen im linken Arm. Auf der Wange war eine
Hautabschürfung zu sehen. Der Autofahrer, der im letzten Moment
angehalten hatte, ehe er sie überrollte, führte sie zu seinem Wagen
und half ihr, sich auf den Rücksitz niederzulassen.
Es dauerte keine Viertelstunde, dann kam ein Streifenwagen mit
heulender Sirene und rotierendem Blaulicht ...
Straßenräuberbande hat wieder zugeschlagen!, hieß es am
folgenden Tag in der Zeitung. Opfer bei Überfall verletzt, so
lautete der Untertitel. In dem Artikel wurde ausgeführt, dass es
sich um den zwölften Überfall dieser Art handelte und dass sicher
zu sein schien, dass es sich um eine Motorradgang handelte, die die
Straßen von Hamburg unsicher machte. Der Journalist, der den
Artikel verfasste, wies darauf hin, dass die Bande mit immer
größerer Brutalität vorging. So habe sich das jüngste Opfer beim
Sturz vom Gehsteig den Arm gebrochen und sich Schürfwunden im
Gesicht zugezogen. Die Beute habe etwas über fünfundzwanzig Euro
betragen.
Drei Tage später. Eine gebeugte Frau ging am Rand des
Gehsteiges entlang. Sie stützte sich schwer auf einen Stock. Jeder
Schritt schien ihr Mühe zu bereiten. Sie hatte weiße Haare, die am
Hinterkopf zu einem Knoten zusammengebunden waren. In der Linken
hielt sie eine lederne Handtasche. Mit der Rechten führte sie den
Stock. Etwa fünfzig Meter entfernt war eine Omnibushaltestelle, an
der einige Leute standen.
Das Dröhnen einer schweren Maschine näherte sich der alten
Frau von hinten. Sie schaute sich nicht um. Das Motorrad kam
schnell, wurde abgebremst, fuhr dicht an den Straßenhand heran und
der Mitfahrer auf der Maschine griff nach der Handtasche der alten
Frau. Und in diese geriet plötzlich Leben. Sie ließ den Stock
fallen, ihre rechte Hand schnappte nach dem Arm des Soziusfahrers,
erwischte ihn, ein Ruck und der Bursche wurde von der Maschine
gerissen. Aufschreiend landete er am Boden. Die Maschine kam ins
Schleudern, doch der Fahrer konnte sie abfangen und gab Gas.
Die alte Frau hatte die Handtasche fallen lassen und warf sich
auf den am Boden liegenden Gangster.
»Polizei Hamburg!«, stieß sie hervor. »Kommissarin Pauscher!«
Die Polizistin drehte dem Gangster am Boden den linken Arm auf
den Rücken, holte unter ihrer Jacke Handschellen hervor und
fesselte ihn. Dann nahm sie ihm den Motorradhelm ab. Zum Vorschein
kam – das Gesicht eines Mädchens von höchstens achtzehn Jahren. Es
hatte kurze, dunkle Haare und ein hübsches gleichmäßiges Gesicht,
braune Augen und volle sinnliche Lippen.
»Wie ist Ihr Name?«, fragte die Polizistin, als sie sich von
ihrer Überraschung erholt hatte. Menschen näherten sich von der
Bushaltestelle. Aufgeregtes Stimmendurcheinander erfüllte die
Atmosphäre und vermischte sich mit dem Motorenlärm vorbeifahrender
Autos. Der Motorradfahrer war verschwunden. Das Dröhnen des Motors
war nur noch fern zu vernehmen.
»Melanie Krüger«, presste das Mädchen zwischen den Zähnen
hervor. »Du dreckige Schlampe ...«
»Okay, Melanie Krüger«, sagte Angelika Pauscher, die junge
Kommissarin, die sich im Rahmen einer groß angelegten
Fahndungsaktion zusammen mit einer Reihe weiterer weiblicher
Polizisten als Köder zur Verfügung gestellt hatten. »Sie sind
verhaftet. Sie haben das Recht zu schweigen ...«
Sie klärte Melanie Krüger über ihre Rechte auf. Dann forderte
sie Verstärkung an, damit das verhaftete Mädchen in die
Untersuchungshaft überführt wurde.
Das letzte Wort sprach der Richter. Obwohl Melanie geständig
war und auch die Namen der anderen Gangmitglieder verriet, schickte
er sie für zwei Jahre hinter Gitter. Doch dann stellte man sie vor
die Wahl: Zwei Jahre absitzen oder ein Vierteljahr in eine
Jugendhilfeeinrichtung. Diese Jugendhilfeeinrichtungen waren
berühmt-berüchtigt. Drill – von morgens bis abends. Das Leben dort
war minutiös reglementiert, es herrschte eine militärische Ordnung,
die Jugendlichen sollten durch verschiedene Formen der
Einschüchterung dazu veranlasst werden, Selbstdisziplin,
Selbstvertrauen und ein Selbstwertgefühl zu entwickeln.
Melanie entschied sich für die Jugendhilfeeinrichtung. Es
befand sich in der Nähe von Holm und wurde ,Das Mädchen-Camp‘
genannt.
Leiter der Jugendhilfeeinrichtung war ein Mann namens Braun –
Arthur Braun. Die Ausbilderinnen und Wärterinnen waren in der
Überzahl weiblich. Es gab aber auch einige Männer unter dem
Lagerpersonal.
Melanie Krüger war im Fegefeuer gelandet ...
2
Es war Sommer, genauer gesagt August. Das Wetter spielte
verrückt. Es hatte im Juni und Juli eine wochenlange Hitzeperiode
gegeben, dann wurde es kalt und regnerisch, hin und wieder zogen
furchtbare Gewitter- und Hagelstürme und sogar Orkane über das Land
hinweg.
Der letzte Brief, den ihre Eltern von Melanie erhalten hatten,
trug den Poststempel vom 29. Juni. Melanie sollte am 5. August aus
der Jugendhilfeeinrichtung entlassen werden. Ihre Eltern hatten ihr
Geld geschickt, damit sie mit Omnibus und Bahn nach Hause fahren
konnte. Sie hatten ihrer Tochter verziehen und waren voll Hoffnung,
dass sie der Aufenthalt in dem Erziehungslager geläutert
hatte.
Melanie kam zu Hause nicht an. Am 10. August wandten sich die
besorgten Eltern an die Polizei und meldeten ihre Tochter als
vermisst. Der Polizist, der die Anzeige aufnahm, meinte: »Es kommt
hin und wieder mal vor, dass diese Mädchen spurlos verschwinden.
Sie haben einfach keinen Bock, nach Hause zu fahren und ein
bürgerliches Leben zu führen. Wahrscheinlich hat sich Ihre Tochter
in eine andere Stadt abgesetzt. Es lässt sich ja leicht
feststellen, ob sie am 5. entlassen worden ist.«
Er nahm Verbindung mit der Polizei in Holm auf. Ergebnis
seiner Ermittlungen war, dass Melanie am 14. Juli zusammen mit
einem anderen Mädchen aus dem Lager geflohen war. Die beiden
Mädchen seien spurlos verschwunden, hieß es. Man habe zwar die
Fahndung nach ihnen eingeleitet, aber sie hatte zu keinem Ergebnis
geführt.
Der Beamte erklärte es Melanies Eltern.
»Wie ich schon sagte«, endete er. »Manche werden vernünftig,
wenn sie die Jugendhilfeeinrichtung hinter sich gebracht haben. Man
bricht die jugendlichen Straftäter dort regelrecht. An einigen
anderen jedoch geht der Drill spurlos vorüber. Ihre kriminelle
Energie ist stärker als alles andere. Sie tauchen irgendwo unter,
stehlen, rauben oder gehen auf den Strich und irgendwann erwischt
man sie und sie werden wieder verurteilt. Bei dieser Sorte ist das
ein ewiger Kreislauf. – Der Kollege in Holm hat mir mitgeteilt,
dass innerhalb der vergangenen vier Monate insgesamt sechs Mädchen
das Weite gesucht haben. Und keines dieser jungen Dinger ist mehr
aufgetaucht. Tragisch für die Familien, aber leider nicht zu
ändern.« Er zuckte mit den Schultern. »Tut mir echt leid.
Vielleicht meldet sich Ihre Tochter bei Ihnen, wenn sie am Ende ist
und nicht mehr weiter weiß.«
Die Eltern des Mädchens waren ziemlich am Boden zerstört. Sie
wollten sich damit nicht abfinden. Jörg Krüger, der Vater Melanies,
nahm mit der Leitung der Jugendhilfeeinrichtung telefonisch
Verbindung auf. Das andere Mädchen hieß Jenny Wolters, war
ebenfalls 18 Jahre alt und stammte aus Bremen. Man erklärte Jörg
Krüger, dass Melanie während der Zeit ihres Aufenthalts in der
Einrichtung ziemlich renitent gewesen sei und man schon
Überlegungen angestellt habe, sie ins Gefängnis zurückzuschicken.
»Manche dieser Jugendlichen ändern sich eben nie«, sagte
Arthur Braun, der Lagerleiter. »Sie sind verdorben bis in ihren
Kern, uneinsichtig und stur und sie werden zu 100 Prozent wieder
rückfällig.«
Jörg Krüger telefonierte mit Jenny Wolters' Vater. Dieser
bestätigte ihm, dass seine Tochter seit dem 14. Juli spurlos
verschwunden sei und er kein Lebenszeichen von ihr erhalten
habe.
»Sie wird sich schon melden, wenn sie wieder mal mit der Nase
im Dreck liegt«, erklärte Daniel Wolters und es hörte sich nicht so
an, als machte er sich große Sorgen wegen seiner Tochter.
»Machen Sie sich keine Sorgen?«, fragte Krüger angesichts des
Desinteresses Wolters'.
»Sorgen machen? Um Jenny? Die war als fünfjährige schon
kriminell und stahl im Supermarkt Süßigkeiten. Sie hat zusammen mit
ihrem Freund Tankstellen überfallen und ausgeraubt. Bis zu ihrem
siebzehnten Lebensjahr befand sie sich in einem Heim für schwer
erziehbare Mädchen. Bei der ist Hopfen und Malz verloren. Kommt sie
nach Hause, soll es mir recht sein. Kommt sie nicht, kann ich es
nicht ändern. Früher oder später landet sie wieder hinter Gittern.«
Jörg Krüger war wie vor den Kopf gestoßen. Die Sorge um
Melanie zerfraß ihn innerlich. Sicher, sie hatte zu einer Gang
gehört und war straffällig geworden. Die Schuld schob er auf ihren
Umgang. Melanie war im Grunde nicht schlecht.
Jörg Krüger glaubte an den guten Kern seiner Tochter.
3
Wir hatten den Club Barbados umstellt. Wenn ich sage wir, dann
meine ich sechs Kollegen von der Kriminalpolizei Hamburg und zwei
Dutzend Kollegen von der Sitte, dem Rauschgiftdezernat und der
Drogenfahndung.
Da Stefan Czerwinski mit von der Partie war, leitete er den
Einsatz.
Der Club befand sich in Altona. Wir hatten von einem V-Mann
einen Hinweis bekommen, dass in dem Etablissement nicht nur mit
Kokain gehandelt werden sollte, sondern dass dort auch einige
Mädchen aus Asien und Osteuropa der Prostitution nachgingen. Nicht
immer freiwillig - und anhgemeldet schon gar nicht.
Besitzer des Clubs war Martin Nickel, ein Mann, der
polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten war.
Wir standen per Walkie-Talkie miteinander in Verbindung.
Stefan Czerwinski befand sich zusammen mit Ollie und einem weiteren
Kollegen an der Hintertür, Roy, ein Kollege namens Tom Berringer
und ich wollten durch die Vordertür den Laden stürmen. Die Kollegen
vom Polizeikommissariat und von der Drogenfahndung hatten das
Gebäude hermetisch abgeriegelt.
»Seid ihr bereit?«, fragte Stefan an.
Ich hielt das Walkie-Talkie vor meinem Gesicht. »Ja. Wir
können ...«
»Also dann, Zugriff!«
Die Vordertür war verschlossen. Aus den Fenstern fiel kein
Licht, da sie mit Holztafeln abgedunkelt worden waren, die man mit
roter Folie überzogen hatte und auf denen die Fotos von
Striptease-Tänzerinnen klebten. Sie muteten an wie Schaukästen. Ich
läutete. Eine Klappe in der Tür wurde geöffnet, Licht sicherte
durch das kleine Viereck heraus, ein Gesicht zeigte sich.
»Kriminalpolizei!«, stieß ich hervor. »Öffnen Sie!«
Die Klappe flog zu. Durch die Tür hörte ich die laute Stimme
des Türstehers brüllen: »Die Bullen stehen draußen!
Kriminalpolizei! Sie machen eine Razzia ...«
Roy richtete seine Walther P99 auf das Türschloss und drückte
ab. Im nächsten Moment warf er sich mit der Schulter gegen die
Türfüllung. Krachend flog sie auf. Wir stürmten, die Waffen in den
Fäusten, in das Lokal. Zunächst aber mussten wir durch einen
Vorraum, in dem sich wahrscheinlich die Türsteher aufhielten, denn
es standen zwei Stühle herum, dann durch einen kurzen Flur und dann
befanden wir uns im Gastraum. Lampen mit rotem Glas in den Wänden
sorgten für diffuses Licht. Nur die Theke war hell beleuchtet.
Dahinter standen zwei Keeper mit südländischem Aussehen. Leise
Musik wurde gespielt. In den Nischen, die den Gastraum teilten,
saßen hauptsächlich Männer. Rötlicher Schein von den Lampen lag auf
den Gesichtern.
An der Hintertür, durch die man wahrscheinlich die Toiletten
und den Ausgang zum Hof erreichte, erschienen Stefan, Ollie und der
dritte Kollege.
»Licht an! Musik aus!«, rief Stefan. »Keiner verlässt das
Lokal!«
Jetzt erst schien den Gästen klar zu werden, dass die Polizei
dabei war, den Laden hops zu nehmen. Wildes Stimmendurcheinander
erklang plötzlich. Einige Kerle sprangen auf.
»Bleiben Sie auf Ihren Plätzen!«, rief Stefan mit Tenorstimme.
»Das Gebäude ist umstellt. Sie werden überprüft und wenn nichts
gegen Sie vorliegt, haben Sie nichts zu befürchten.«
Es wurde schnell ruhig.
Nach einiger Zeit flammten die Neonstäbe an der Decke auf, die
Musik war abgestellt worden. Einige Beamte vom Polizeikommissariat
und der Drogenfahndung übernahmen es, die Gäste zu überprüfen und
nach Rauschgift zu durchsuchen.
Roy und ich hatten die Bar durchquert und stiegen nun zusammen
mit Stefan und Ollie die Treppe nach oben. Der Bordellbetrieb
sollte sich in der ersten und zweiten Etage abspielen.
Oben, auf der Treppe, erwartete uns ein vierschrötiger Bursche
mit Bürstenhaarschnitt und Oberarmen, die fast seine Hemdsärmel
sprengten. Sein Gesicht war verkniffen, in seinen Augen flackerte
Unruhe.
Stefan richtete die Waffe auf ihn.
»Versuchen Sie nicht, Widerstand zu leisten«, warnte er.
Der menschliche Büffel hob die Hände. Gleich darauf hatte ihm
Ollie Handschellen verpasst.
Es handelte sich um zwei gegenüberliegende Wohnungen. Ein Teil
der Wand zum Treppenhaus hin war herausgebrochen und zu einer
großen, zur Treppe hin offenen Diele umfunktioniert worden. Eine
schwere Polstergarnitur aus Leder stand da um einen niedrigen Tisch
herum gruppiert. Pflanztröge und -kübel mit exotischen Pflanzen und
einigen billigen, allerdings recht freizügigen Bildern an den
Wänden vervollständigten die Einrichtung.
Mehrere Türen zweigten von der Diele ab. Ich öffnete eine und
sah im diffusen Rotlicht ein nacktes Pärchen auf einem breiten
Bett. Sie nahmen mich gar nicht wahr. Wahrscheinlich hatten sie den
Schuss, mit dem Roy das Türschloss zerschmetterte, nicht gehört
oder für die Fehlzündung eines Motors gehalten.
Ich räusperte mich und jetzt hielt der Mann in seinem
Bestreben, sich für teures Geld körperliche Befriedigung zu holen,
inne und drehte den Kopf zu mir herum.
»Was soll das?«, herrschte er mich an.
»Kriminalpolizei Hamburg«, sagte ich. »Ziehen Sie sich an und
kommen Sie dann aus dem Zimmer!«
Es dauerte fast eine Viertelstunde, bis sich sämtliche Freier
und Freudenmädchen in der Diele eingefunden hatten. Es waren zehn
Leute. Fünf Kerle und fünf Mädchen. Die Männer schauten betreten
drein und es war deutlich, dass sich keiner von ihnen wohlfühlte in
seiner Haut.
Aus dem darüber liegenden Stockwerk war Stefans dunkle Stimme
zu vernehmen.
Die Überprüfung ergab, dass sich keines der Mädchen einer
gesundheitsamtlichen Überwachung unterzogen hatte und über den
sogenannten Bockschein verfügte. Es handelte sich um vier Mädchen
aus der Ukraine und Thailand, die weder über eine
Aufenthaltsgenehmigung noch eine Arbeitserlaubnis verfügten. Das
fünfte Mädchen war rothaarig und Deutsche. Ich schätzte es auf
achtzehn, höchstens zwanzig Jahre.
»Wie ist Ihr Name«, fragte ich.
»Cindy.«
»Sie haben sicher auch einen Familiennamen.«
»Antoni. Cindy Antoni.«
Mir fielen die geweiteten, starren Pupillen des Mädchens sowie
ihre Unruhe auf und ich ahnte, dass es unter Drogen stand.
Einige Kollegen von der Sitte tauchten auf. Insgesamt waren es
elf Prostituierte, die keine Lizenz hatten, dem horizontalen
Gewerbe nachzugehen. Keines der Mädchen war über zwanzig. Der
Geschäftsführer des Clubs und die Türsteher wurden verhaftet. Drei
Kollegen von der Kriminalpolizei fuhren in die Wohnung Martin
Nickels und verhafteten ihn. Die Beamten fanden einiges an
Rauschgift, vor allem Amphetamine, also synthetisch hergestellte
Drogen, aber auch Heroin und Kokain. Personalien wurden
aufgenommen.
Die Mädchen wurden in verschiedene Krankenhäuser verbracht.
Ihnen wurde Blut entnommen, um ihnen eventuellen Drogenkonsum
nachzuweisen. Am nächsten Tag erhielten wir die Ergebnisse der
toxischen Untersuchungen. Sämtliche der Mädchen hatten unter Drogen
gestanden. Amphetamin-Intoxikation lautete durchwegs das
Ergebnis.
Cindy Antoni befand sich im Krankenhaus. Um die illegal nach
Deutschland eingereisten Mädchen kümmerte sich die
Ausländerpolizei.
Wir besuchten Cindy Antoni im Krankenhaus. Bleich lag sie im
Bett. Sie wirkte abwesend und lethargisch. Ohne Interesse schaute
sie Roy an, ihr Blick wechselte zu mir, dann sagte sie mit lahmer
Stimme: »Ihr wart in der Nacht dabei, nicht wahr?«
»Mein Name ist Uwe Jörgensen. Das ist mein Kollege Roy Müller.
Wir sind von der Kriminalpolizei. Fühlen Sie sich in der Lage, uns
einige Fragen zu beantworten?«
»Was für Fragen?«
Ich wusste, dass nach dem Absetzen von Amphetaminen einige
Entzugserscheinungen auftreten, meist psychischer Natur wie
Depressionen und Suizidneigung, aber auch Erschöpfungszustände,
übersteigertes Schlafbedürfnis, Heißhunger.
Damit erklärte ich mir auch den apathischen Zustand des
Mädchens.
»Wie kamen Sie in den Club Barbados?«
»Man hat mich dorthin gebracht und Olaf, dem Geschäftsführer,
übergeben.«
»Seit wann sind Sie vom Rauschgift abhängig?«
»Ich ... ich wollte das alles nicht. Ich war in einer
Jugendhilfeeinrichtung in der Nähe von Holm. Mädchen-Camp wurde die
Jugendhilfeeinrichtung genannt. Ich hatte die Wahl zwischen
Gefängnis und der Einrichtung. Eines Nachts brachte man mich weg.
Ich habe die Männer nicht gekannt. Sie spritzten mir Speed. Nach
einigen Stunden Fahrt landeten wir irgendwo. Ich wurde Olaf
übergeben und der versorgte mich auch weiterhin mit Drogen
...«
»Olaf ist der Geschäftsführer des Clubs«, sagte ich, als das
Mädchen abbrach.
Cindy nickte.
»Ja. Ich ... ich musste irgendwelchen Kerlen zu Willen sein.
Olaf schlug mich auch. Er versorgte mich aber auch mit
Drogen.«
»Seit wann arbeiteten Sie in dem Club?«
»Seit April. Bitte, lassen Sie mich schlafen. Ich ... ich
fühle mich total erschöpft. Bitte ...«
Ich war ziemlich perplex.
Der Arzt, der uns begleitet hatte, sagte: »Dieser
Erschöpfungszustand ist deutliches Zeichen des Entzugs. Sie sollten
Cindy jetzt wohl tatsächlich in Ruhe lassen.«
Wir verließen das Krankenhaus.
4
Ich hatte den Chef des Polizeidienststelle, der in Holm seinen
Sitz hatte, an der Leitung. Sein Name war Tilo Kreuzer.
»Sieh an«, sagte er. »Das junge Ding ist also in einem Bordell
gelandet. Nun, es ist nicht der erste Fall des spurlosen
Verschwindens eines Mädchens aus der Jugendhilfeeinrichtung. In den
vergangenen vier Monaten wurden sechs Ausbrüche gemeldet. Was diese
Cindy Antoni anbetrifft, so erzählt sie sicher Märchen, wenn sie
behauptet, aus der Jugendhilfeeinrichtung entführt worden zu sein.
Natürlich. Denn nach dem Ausbruch hat sie sich die Chance, die ihr
mit der Jugendhilfeeinrichtung geboten wurde, verscherzt. Auf sie
wartet das Gefängnis.«
»Warum wurde Cindy verurteilt?«, fragte ich.
»Autodiebstahl, Wiederholungstäterin. Die Einrichtung war ihre
letzte Chance.«
»So einfach kann man die Behauptung, dass sie aus der
Einrichtung entführt wurde, nicht unter den Tisch kehren«, wandte
ich ein. »Sie kann ebenso gut wahr wie unwahr sein. Ich glaube
fast, dass uns Cindy nicht belogen hat. Sie war körperlich und
psychisch viel zu fertig, um uns Lügen aufzutischen.«
»Von mir aus, Herr Jörgensen. Finden Sie die Kerle, die sie
aus der Einrichtung entführt haben, beweisen Sie ihnen die
Entführung und dann will ich gerne glauben, dass das kleine Luder
nicht einfach ausgerissen ist. Solange Sie mir das nicht beweisen
können, werde ich von Flucht ausgehen und die Einweisung ins
Gefängnis veranlassen.«
Ich hatte es mit einem halsstarrigen selbstherrlichen
Provinzbeamten zu tun, der in Holm und in der Dienststelle nicht
nur das Gesetz vertrat, sondern der das Gesetz dort war.
Ich ließ mir die Namen der Mädchen geben, die aus der
Jugendhilfeeinrichtung verschwunden waren und notierte sie. Corinna
Finnern, Jenny Wolters, Pamela Sehlent, Pia Barkow und Melanie
Krüger. Sämtliche Mädchen waren unter zwanzig Jahre alt.
Mir stellten sich die Nackenhaare auf, als ich daran dachte,
dass all diese Mädchen irgendwo in Deutschland in einem Bordell
gelandet sein konnten. Wenn Cindy Antonis Aussage zutraf, war das
Treiben der Leute, die ihr das angetan hatten, nur unter dem
Begriff Menschenhandel zu subsumieren.
Ich war geneigt, dem Mädchen zu glauben. Sie war nicht in der
Verfassung gewesen, in der ein Mensch schamlos lügt.
»Vielleicht sollten wir noch einmal mit Cindy reden«, schlug
Roy vor. »Irgendwie klingt ihre Geschichte ziemlich abenteuerlich
und es ist nicht auszuschließen, dass sie sie erfunden hat, weil
sie denkt, dadurch dem Gefängnis zu entgehen und wieder in die
Einrichtung zurückkehren zu können, - andererseits aber ...«
Roy wiegte den Kopf.
»Wir können ihre Aussage nicht einfach ignorieren. Sicher,
sprechen wir noch einmal mit ihr. Vorausgesetzt, sie ist
ansprechbar.«
Also fuhren wir noch einmal ins Krankenhaus. Der Entzug war
fortgeschritten. Der Arzt, an dem wir auch dieses Mal nicht
vorbeikamen, sagte: »Sie ist mitten im Entzug und redet viel wirres
Zeug. Ob sie ihre Aussage verwerten können, ist fraglich.«
»Wir wollen es dennoch versuchen«, beharrte ich auf unserem
Vorsatz, Cindy noch einmal zu befragen.
Der Arzt hob die Schultern.
»Ich bitte Sie, das Mädchen nicht über die Gebühr zu
strapazieren.«
»Mein Wort darauf«, versetzte ich.
Dann standen wir wieder an Cindys Bett. Sie schaute uns mit
erloschenem Blick an. In ihrem Gesicht zuckte kein Muskel. Und ich
fragte mich, ob sie uns überhaupt erkannte.
»Wissen Sie noch, wer wir sind, Cindy?«, fragte ich
daher.
»Bullen«, erwiderte sie und schloss die Augen.
»Kriminalpolizei. Ja, ich kann mich an euch erinnern.«
»Haben Sie sich gewehrt, als man Sie aus der
Jugendhilfeeinrichtung holte?«, wollte ich wissen.
»Nein. Man sagte mir, ich werde verlegt.« Das tonlose Flüstern
klang losgelöst und wimmernd wie ein Windhauch. Ein Krampf überlief
das totenbleiche Gesicht. »Widerstand wurde in der
Jugendhilfeeinrichtung unerbittlich geahndet. Du – du leckst den
Ausbildern sogar die Schuhe, wenn sie es verlangen. Man ist dort
kein Mensch – man ist ein wertloser Gegenstand.«
»Wie viele Männer waren es?«
»Drei.«
»Trugen Sie Uniformen? Hatten Sie die Männer vorher schon
einmal gesehen?« Cindy hatte zwar bei unserem ersten Besuch schon
behauptet, die Männer nicht gekannt zu haben, trotzdem stellte ich
die entsprechende Frage noch einmal.
»Nein, keine Uniformen. Ich kannte sie nicht.«
Cindy rollte den Kopf auf dem Kissen hin und her. Es war
deutlich zu sehen, wie sie unter den geschlossenen Lidern mit den
Augen rollte. Schweiß schimmerte auf ihrer Stirn.
»Haben die Männer irgendwelche Namen gesagt?«
»Einer hieß Louis, ein anderer Florian. Andere Namen fielen
nicht. Sie – sie haben mich ... haben mich ...«
»Was?« Ich stellte die Frage eindringlich. Meine Stimme klang
hart. Ich ahnte, was kommen würde.
»Vergewaltigt. Und dann ... dann haben Sie mir etwas
gespritzt. Ich weiß nichts mehr. Als ich wieder denken konnte,
hatte ich keine Ahnung, wo wir uns befinden. Erst Tage später kamen
wir nach Hamburg, wo ich Olaf übergeben wurde. Auch mit ihm musste
ich schlafen. Er ... er versorgte mich mit Drogen.«
Wenn das alles den Tatsachen entsprach, dann war das Mädchen
nicht durchs Fegefeuer gegangen, sondern durch die Hölle. Cindys
Mundwinkel zuckten. Fahrig wischten ihre Hände über die Bettdecke.
Ich hatte Mitleid mit ihr.
Wir fuhren vom Krankenhaus aus zur JVA, in die Olaf Mahoni als
Untersuchungshäftling eingeliefert worden war. Er war
Geschäftsführer des Clubs, den wir hochgenommen hatten und wir
schoben ihm – neben Martin Nickel – die Verantwortung für das
ungesetzliche Geschehen dort zu.
Im Gefängnis waren wir alte Bekannte. Dennoch mussten wir uns
ausweisen. Es ging durch einige Schleusen, die uns jeweils geöffnet
wurden, dann befanden wir uns in einem kahlen Raum mit einem Tisch
und vier Stühlen. An der Wand hing ein schmuckloses Eisenkreuz. Auf
einem Computertisch stand ein vernetzter PC mit Drucker, in dem die
Vernehmungsprotokolle geschrieben wurden.
Mahoni wurde hereingeführt. Finster musterte er uns.
»Ich hab euch nichts zu sagen«, blaffte er.
»Setzen Sie sich zuerst einmal hin«, sagte Roy und deutete auf
einen der Stühle.
Mahoni setzte sich. Er war achtunddreißig Jahre alt und hatte
blonde leicht gewellte Haare, die bis in seinen Nacken reichten.
Sein Gesicht war ein wenig aufgedunsen und solariengebräunt. Er war
wohl um die eins achtzig groß.
»Cindy hat uns erzählt, dass Sie ihr Speed gegeben haben«,
begann ich und beobachtete ihn scharf.
Er presste sekundenlang die Lippen zusammen. Seine Hände, die
er auf dem Schoß liegen hatte, ballten sich zu Fäusten.
»Sie lügt!«, presste er schließlich hervor.
»Dann ist es sicher auch gelogen, dass sie bei Nacht und Nebel
aus der Jugendhilfeeinrichtung bei Holm entführt und nach Hamburg
gebracht wurde, wo man sie mit Amphetaminen gefügig machte und auf
den Strich schickte.«
»Sie ist achtzehn. Auf den Strich zu gehen war ihr freier
Wille. Von einer Jugendhilfeeinrichtung weiß ich nichts. Sie kam zu
mir und ...«
»Sie wurde Ihnen gebracht!«, fiel ihm Roy ins Wort. »Sie haben
sie mit Speed vollgepumpt. Das Dreckszeug wurde ihr intravenös
verabreicht. Sie wurde von Ihnen geschlagen und Sie haben ihre
Hilflosigkeit ausgenutzt und mit ihr geschlafen. Man spricht hier
von Vergewaltigung, mein Freund. Was sagen Sie zu diesen Vorwürfen.
Eine ziemliche Latte, die ausreichen dürfte, um sie für einige
Jahre hinter Gittern verschwinden zu lassen.«
»Sie war süchtig, als sie zu mir kam«, knurrte Mahoni.
»Versucht nur nicht, mir was am Zeug zu flicken. Ich war nur für
den Barbetrieb zuständig. Was in den oberen Geschossen des Gebäudes
vor sich ging, interessierte mich nicht.«
»Wer war dann für den Bordellbetrieb verantwortlich?«,
schnappte ich.
Er schaute mich verächtlich an.
»Findet es doch heraus, ihr Scheißbullen!«
»Nicht frech werden«, knirschte Roy.
»Also, noch einmal«, sagte ich geduldig. »Wer hat Cindy Antoni
zu Ihnen gebracht und wie viel Geld wechselte den Besitzer?« Ich
beugte mich weit zu Mahoni hinunter. Sein Atem streifte mein
Gesicht. »Sie sollten kooperativ sein, Mahoni. Cindy wird vor
Gericht gegen Sie aussagen. Ihre Geschichte wird die Herzen des
Gerichts rühren, und ...«
»Gib dir keine Mühe, Bulle! Soll ich mir mein eigenes Grab
schaufeln. Ich weiß von nichts. Ich kannte diese kleine Hure gar
nicht. Wendet euch an ...«
Er hatte sich in Rage geredet. Jetzt aber brach er ab. Trotzig
schaute er mich an.
»An wen?«, fragte ich.
»Geh zum Teufel!«
»Haben Sie einen Anwalt, Mahoni?«, wollte Roy wissen.
»Herr Mahoni!«, stieß der Gangster mit Nachdruck hervor. »Ich
darf doch sehr bitten. Wir sind hier doch nicht im Kuhstall!«
Ich hatte mich wieder aufgerichtet und die Arme in die Seiten
gestemmt.
»Vergessen Sie's, Mahoni. Solange Sie uns als Scheißbullen
bezeichnen, haben wir keinen Grund, besonders höflich zu Ihnen zu
sein.«
Er leckte sich über die Lippen, schluckte und einen Moment sah
es so aus, als wollte er mir vor die Füße spucken. Aber er besann
sich eines Besseren, lehnte sich zurück und meinte grinsend: »Von
mir aus. Nenn mich Olaf, Jörgensen! Wie ist dein Vorname?«
»Sie scheinen da etwas missverstanden zu haben, Mahoni«,
knurrte ich. »Sie haben die Frage nach einem Anwalt noch nicht
beantwortet.«
»Ich brauche keinen. Was habt ihr gegen mich vorzubringen?
Dass in der ersten und zweiten Etage des Gebäudes, in dessen
Erdgeschoss eine Bar betrieben wird, deren Geschäftsführer ich bin,
ein Puff betrieben wurde?« Mahoni legte den Kopf schief und
schielte höhnisch zu mir in die Höhe. »Kein Richter der Welt wird
deswegen Haftbefehl gegen mich erlassen.«
»Cindy Antonis Aussage liegt vor. Und sicher wird auch das
eine oder andere der Mädchen, die wir hops genommen haben, den Mund
aufmachen. Und dann sind Sie fällig, Mahoni. Also kommen Sie von
ihrem hohen Ross herunter.«
»Ihr könnt mich mal. Und jetzt möchte ich in meine Zelle
zurück. – Die Weiber, die ihr als Trümpfe im Ärmel zu haben glaubt,
sind alle drogenabhängig. Wenn sie keinen Nachschub kriegen,
brechen sie zusammen. Wer soll denen schon glauben? Ich denke mal,
eure Anklage steht auf recht wackligen Beinen, Jörgensen.«
Ich gab dem Wachtmeister einen Wink. Er kam näher.
»Gehen wir, Mahoni!«
Der U-Häftling erhob sich. Ein hohnvolles Grinsen bog seine
Mundwinkel nach unten. In seinen Augen glitzerte der blanke
Zynismus.
»Ihr habt euch schon groß in den Schlagzeilen gesehen, wie?
Polizeibeamte lassen Mädchenhändlerring auffliegen.« Mahoni lachte
schallend auf. »Pech gehabt! Diese kleinen Huren sind alle
freiwillig gekommen.«
»Dafür, dass sie der Bordellbetrieb nicht interessierte, sind
Sie aber ziemlich aufgeklärt«, antwortete ich. »Sie wissen, dass
die Mädchen drogenabhängig sind und dass sie freiwillig ihrem
Gewerbe nachgingen. Sonst noch ein paar Insider-Kenntnisse?«
Jetzt war die Reihe an mir, höhnisch zu grinsen.
Mahonis Grinsen schien zu gefrieren. Er zeigte Verunsicherung.
Eine ganze Weile starrte er mich feindselig an, dann wandte er sich
abrupt ab und ging zur Tür. Der Wachtmeister folgte ihm.
»Warten wir, was Nickel zu sagen hat«, murmelte Roy und setzte
sich auf einen der Stühle. »Eigentlich schade, dass man die
peinliche Befragung irgendwann im 18. Jahrhundert abgeschafft hat.
Bei dem einen oder anderen dieser Halunken wäre sie durchaus
angebracht.«
Obwohl mir nicht danach zumute war, musste ich grinsen.
5
Martin Nickel wurde in den Vernehmungsraum gebracht. Nickel
war ein Mann Mitte der Vierzig und seine Haare waren an den
Schläfen schon angegraut. Seine Finger wiesen einige weiße Stellen
auf, was verriet, dass er eine Reihe von Ringen getragen hatte, die
ihm aber bei Einlieferung in die U-Haft abgenommen worden
waren.
»Mein Anwalt hat bereits Haftbeschwerde eingelegt«, war das
erste, was er sagte. Dann setzte er sich und schaute herausfordernd
von mir auf Roy.
»Eines der Mädchen, das für Sie anschaffte ...«
»Für mich haben keine Mädchen angeschafft«, blaffte Nickel und
unterbrach mich.
Ich ließ mich nicht beirren. »… heißt Cindy Antoni. Sie
behauptet, aus der Jugendhilfeeinrichtung bei Holm entführt und
nach Hamburg gebracht worden zu sein, wo sie mit Drogen gefügig
gemacht und in dem illegalen Bordell beschäftigt wurde.«
»Den Club führte Mahoni.«
»Aber das Gebäude, in dem der Club etabliert war, gehört
Ihnen. Die beiden Obergeschosse wurden aufwendig umgebaut – mit dem
Ziel, eine angenehme Atmosphäre für die Kunden, die von Ihrem – hm,
Angebot Gebrauch machten, zu schaffen.«
»Ohne meinen Anwalt rede ich mit euch nicht.«
»Was sagen Sie dazu, wenn ich Ihnen sage, dass Mahoni geredet
hat«, warf Roy dazwischen.
Nickel legte den Kopf in den Nacken.
»Vergessen Sie's!«
»Glauben Sie denn, dass Mahoni den Kopf alleine in die
Schlinge steckt?«, fragte ich. »Er wird versuchen, für sich
rauszuholen, was herauszuholen ist.«
Nickel zog den Mund schief.
»Entweder lassen Sie zu, dass ich meinen Anwalt informiere
oder Sie lassen mich in meine Zelle zurückschaffen.«
Da war nichts zu machen. Er war kaltschnäuzig, unverfroren und
arrogant.
Er wurde abgeführt.
Roy und ich verließen die JVA und kehrten ins Präsidium
zurück. Ich nahm mit der für Holm zuständigen Kriminalpolizei
Verbindung auf. Man gab mir die Nummer des Büros und ich rief dort
an. Der Kollege, mit dem ich sprach, hieß Klaus Lemke. Ich
schilderte ihm, was ich von Cindy Antoni erfahren hatte. Er sagte
mir zu, sich zu informieren und mich zurückzurufen.
Der Anruf erfolgte eine knappe Stunde später.
Lemke sagte: »Es sind sechs Mädchen, die in den vergangenen
vier Monaten verschwunden sind. Man behauptet, dass die Mädchen aus
der Jugendhilfeeinrichtung geflohen sind und dass nach ihnen
gefahndet wird, allerdings wird die Fahndung nur ziemlich lasch
gehandhabt, weil man annimmt, dass die Mädchen wieder straffällig
werden und der Polizei sowieso ins Netz gehen.«
»Was ist das für ein Laden?«, fragte ich. »Ich kann mir nicht
vorstellen, dass sich Cindy Antoni die Anschuldigungen, die sie
vorgebracht hat, aus den Fingern saugte.«
»Das Lager wird staatlich geführt. Ein ehemaliger Polizist
leitet die Einrichtung. Sein Name ist Arthur Braun. Er behauptet,
die Mädchen mit rauer Liebe anzufassen. Es kam bereits zu zwei
Todesfällen und die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet, die
jedoch weder ein kriminelles Delikt noch eine mögliche Verletzung
der Bürgerrechte erkannte und nichts unternahm. Der Mutter eines
der toten Mädchen erklärte man, das Mädchen sei an Wundstarrkrampf
gestorben, nachdem es sich verletzte und die Verletzung nicht
meldete.«
»Wurde das Mädchen nicht obduziert?«
»Nein. Der Lagerarzt stellte die Todesursache fest und das
war's. Es gibt eine Reihe von Vorwürfen im Hinblick auf
Autoritätsmissbrauch in der Einrichtung, aber bisher hat sich
niemand gefunden, der das Lager geschlossen hätte.«
»Wer wäre dafür zuständig?«
»Der Leiter der dortigen Polizeidienststelle.«
»Tilo Kreuzer.«
»Richtig. Zu dem Lagerregiment gehören Gewaltmärsche,
unablässiges Anbrüllen, sowie Essensrationen, die für einen ganzen
Tag nur aus einem Apfel, einer Karotte und einer Hand voll Bohnen
besteht. Die Mädchen müssen oftmals im Freien schlafen, sie
bekommen zwar Schlafsäcke, liegen aber auf blankem Boden.«
»Ein kaum tragbarer Zustand«, ließ ich verlauten. »Kaum zu
glauben, dass niemand einschreitet.«
»Einige der Mädchen, die ihre Zeit in der
Jugendhilfeeinrichtung hinter sich gebracht hatten, sagten aus,
dass sie von den Ausbildern gewürgt, getreten und auf andere Weise
gequält worden seien. Noch schlimmer als die körperliche Gewalt sei
jedoch die psychische. Die Insassen werden gedemütigt und
regelrecht zerbrochen. Eines der Mädchen wurde im Rahmen einer
Disziplinarmaßnahme gezwungen, ihre Mahlzeiten auf der Toilette
einzunehmen. Der zweite Todesfall geschah nach einem Gewaltmarsch
über zwanzig Meilen. Herzschlag. Es handelte sich um eine
Neunzehnjährige. Der Arzt bescheinigte, dass ihr Herz in Ordnung
war und mit ihrem Tod infolge Überanstrengung nicht gerechnet
werden konnte.«
»Was den Sinn dieser Lager, den jungen Leuten Disziplin,
Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu vermitteln, auf jeden Fall
verfehlt«, knurrte ich.
»Ich habe einen Artikel darüber gelesen, in dem es sinngemäß
heißt, dass Hinweise darüber, wonach die meisten
Jugendhilfeeinrichtungen überhaupt nicht funktionieren, von
verantwortlicher Seite einfach ignoriert werden. Es ist
nachgewiesen, dass die Lager weder die Rückfälligkeitsrate spürbar
reduzieren, noch zu dem Erfolg führen, den ihre Betreiber
versprechen. Das Personal ist mangelhaft oder gar nicht
ausgebildet. Die nationale Vereinigung für geistige Gesundheit ist
zu dem Schluss gekommen, dass die Anwendung von Einschüchterungs-
und Erniedrigungstaktiken bei den meisten Jugendlichen
kontraproduktiv ist und zu beunruhigenden Vorkommnissen des
Missbrauchs geführt haben. In Frankfurt fanden Ermittler des
Justizdepartements heraus, dass Kinder gezwungen wurden, auf Händen
und Knien zum Essen zu kriechen und mit ihren T-Shirts die Böden zu
putzen. Im Endeffekt heißt das, dass das paramilitärische Modell
nicht nur ineffektiv ist, sondern auch schädlich.«
»Sie sind gut informiert«, musste ich anerkennen.
»Berichte über den Missbrauch in sowohl privaten als auch
staatlichen Erziehungslagern sind weit verbreitet. Man spricht von
zum Teil barbarischen Praktiken wie Fesselungen, Einzelhaft und
regelmäßigen Leibesvisitationen bei Mädchen durch
Wachmänner.«
»Ein vernichtendes Urteil über das staatliche
Jugendhaftsystem«, murmelte ich.
»Das können Sie laut sagen« versetzte Lemke.
»Was Sie mir eben erzählten, Kollege«, sagte ich, »ist auf
jeden Fall dazu angetan, den Aussagen Cindy Antonis einen gewissen
Wahrheitsgehalt zuzuordnen. Ich denke, wir werden uns die
Jugendhilfeeinrichtung mal aus der Nähe betrachten.«
»Heißt das, dass Sie nach Holm kommen wollen?«
»Wir müssen erst mit unserem Vorgesetzten darüber sprechen.
Falls er zustimmt, werden wir sie unterrichten, wann wir ankommen.
Sie können uns dann gerne unterstützen.«
»Es würde mich freuen«, erklärte Lemke.
6
Wir meldeten uns bei Herrn Bock an. Unser Chef fragte uns, ob
wir eine Tasse Kaffee trinken wollten, was wir dankend annahmen.
Der Kaffee stand bereits in einer Thermoskanne auf dem Tisch und
auch das nötige Zubehör wie Tassen, Zucker und Milch waren
vorhanden.
Der Chef wartete, bis wir uns jeder eine Tasse zubereitet
hatten, dann fragte er: »Was gibt es? Wenn Sie bei mir antreten,
ohne gerufen zu werden, ist meistens irgendeine Ka... Ich meine,
dann hat das in der Regel einen wichtigen Grund.«
Ich musste mir ein Grinsen verkneifen. … ist meistens eine
Kacke am Dampfen, wollte Herr Bock sagen, besann sich aber seiner
Position und reduzierte die herbe Redewendung auf das Vorliegen
eines wichtigen Grundes.
»Es geht um Cindy Antoni«, begann ich und dann erzählte ich
dem Chef, was unsere Feststellungen ergeben hatten.
Herr Bock hörte aufmerksam zu, unterbrach mich kein einziges
Mal und sein Gesichtsausdruck wurde mit jedem Satz, den ich von mir
gab, düsterer. Als ich geendet hatte, sagte er: »Das dürfen wir auf
keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen. Wenn diese Cindy
Antoni die Wahrheit spricht, dann hat sie uns auf die Spur eines
Mädchenhändlerrings gebracht. Ich will, dass Sie der Sache
nachgehen, Uwe, Roy. Fahren Sie nach Holm und sehen Sie sich mal
dort um. Ich denke, in dem Lager stinkt einiges zum Himmel.«
»Dieser Auffassung sind wir auch, Chef«, bemerkte ich. »Ich
habe mit dem Leiter der dortigen Polizeidienststelle gesprochen. Er
ist felsenfest davon überzeugt, dass Cindy lügt und nur ihren Hals
aus der Schlinge ziehen will.«
»Sie werden mit dem Beamten zusammenarbeiten müssen«, gab Herr
Bock zu verstehen.
»Klar. Aber wir werden uns wohl eher an Lemke von der
Kriminalpolizei halten. Der Herr Kreuzer kommt mir ziemlich
halsstarrig und von sich eingenommen vor. Natürlich hat er
Interesse daran, zu verhindern, dass Missstände in seinem
Zuständigkeitsbereich an die große Glocke gehängt werden.«
»Wann fahren Sie?«, wollte Herr Bock wissen.
»So bald wie möglich«, antwortete ich. »Am besten gleich
morgen früh.«
»In Ordnung«, sagte Herr Bock und nickte. »Fahren Sie nach
Holm und bringen Sie Licht in die Angelegenheit. Wo Rauch ist, ist
auch Feuer. Ausgehend von dieser alten Weisheit dürfen wir Cindy
Antonis Aussage einfach nicht ignorieren.«
Am nächsten Morgen holte ich Roy von der Ecke ab, wo er immer
auf meine Ankunft wartete. Da wir nicht vorhatten, länger als zwei
oder drei Tage in Holm zu bleiben, war unser Gepäck entsprechend
klein. Von Hamburg-Winterhude bis Holm waren es etwas mehr als
dreißig Kilometer.
Klaus Lemke hatten wir Bescheid gegeben. Er hatte versprochen,
uns zusammen mit seinem Kollegen und Dienstpartner Robert Anders
bei Ankunft in Holm zu empfangen.
Wir benötigten für die Fahrt circa fünfundvierzig Minuten,
denn der Verkehr durch Hamburg war wieder erbarmungslos. Das kleine
Hotel in Holm war schnell gefunden. Wir checkten ein und verstauten
unsere wenigen Habseligkeiten auf den Zimmern. Danach gingen wir in
die Lobby und sahen zwei Männer, von denen ich annahm, dass es sich
um die beiden Kollegen handelte.
Mit unserem Eintreten hatten wir die Aufmerksamkeit der beiden
erregt. Sie näherten sich uns. »Herr Jörgensen und Herr Müller?«,
fragte einer lächelnd.
»Ich bin Jörgensen«, erklärte ich und tippte mit dem Daumen
meiner Linken gegen die Brust. »Das ist Roy Müller.«
Einer der beiden, ein dunkelhaariger Typ mit blauen Augen,
reichte mir die Hand.
»Klaus Lemke. Mein Kollege Robert Anders.«
Wir begrüßten uns. Lemke sagte: »Wir sind mit einem
Dienstwagen hier und fahren sofort zur Polizeidienststelle, um dem
Chef einen Besuch abzustatten.«
Tilo Kreuzer war ein etwa fünfzigjähriger grauhaariger Mann,
hochgewachsen, schlank, fast schlaksig. Er trug in seinem Büro eine
Sonnenbrille.
In seinem Vorzimmer hatten zwei Polizisten gesessen. Sie
musterten uns nicht gerade begeistert. Diese Provinzbeamten sahen
uns nicht so gerne, denn meistens pfuschten wir ihnen auf diese
oder jene Art ins Handwerk.
Kreuzer bot uns Plätze zum Sitzen an. Wir ließen uns auf den
hölzernen Stühlen, die um einen kleinen runden Tisch herum
gruppiert waren, nieder.
»Kaffee oder Tee?«, fragte Kreuzer, nachdem wir uns
gegenseitig vorgestellt hatten. »Oder etwas Schärferes?« Er
lächelte verbindlich.
»Vielen Dank«, lehnte ich ab. »Wir haben bereits einmal
telefoniert«, setzte ich sogleich hinzu und lenkte die
Aufmerksamkeit des Beamten auf mich.
»Richtig. Dann wissen Sie ja, wie ich über die Sache denke.
Die Kleine hat sich die Geschichte ausgedacht, um nicht im
Gefängnis zu verschwinden. Allerdings wird sie wohl kaum darum
herumkommen. Nun, sie hat es sich selber zuzuschreiben.«
»Was ist, wenn Cindy die Wahrheit sagt«, fragte ich.
Kreuzer lachte auf. Für mich klang es ein wenig unecht,
aufgesetzt.
»Schwerwiegende Vorwürfe«, knurrte er dann. »Jeder Beamte, der
sich Derartiges zuschulden kommen ließe, müsste damit rechnen,
eines Tages aufzufliegen und seinen Job zu verlieren und darüber
hinaus vor Gericht zu landen.«
»Es hat Todesfälle in der Einrichtung gegeben«, erhob Klaus
Lemke das Wort.
»Ja. Ein Unfall und ein Herzversagen. Wem wollen Sie dafür die
Schuld geben? Dem Lagerleiter, den Ausbildern, mir vielleicht
sogar?«
Ich sah zwar seine Augen nicht, hatte aber das Gefühl, dass er
Lemke anstarrte wie die Schlange die Felsmaus, die sie im nächsten
Moment verschlingen würde.
»Es sind innerhalb der letzten vier Monate sechs Mädchen
verschwunden«, so ergriff ich wieder das Wort. »Verschwanden vor
diesem Zeitpunkt auch schon Mädchen aus der Einrichtung?«
»Nein.«
»Was haben Sie veranlasst, um der Mädchen wieder habhaft zu
werden?«, erkundigte sich Roy.
»Ich habe sie zur Fahndung ausgeschrieben und vor allem die
Polizeibehörden an ihrem Wohnort mobilisiert. Denn wir erwarteten,
dass sich die Mädchen nach Hause wenden würden. Fehlanzeige. Keines
dieser kleinen Luder ist uns ins Netz gegangen.«
»Sie haben den Lagerleiter und die Ausbilder vernommen?«,
fragte ich.
»Natürlich. Auch andere Mädchen. Ebenfalls vergebliche Mühe.
Braun konnte uns nicht weiterhelfen. Ebenso wenig die Ausbilder und
die Mädchen.«
»Haben Sie Protokolle von den Aussagen angefertigt?«
»Was denken Sie denn?« Er sprach mich direkt an. »Vermittle
ich auf Sie vielleicht den Eindruck, meinen Job nicht ordnungsgemäß
zu erledigen?«
Es war eine glatte Provokation. Kreuzer zeigte mir die Zähne.
Er erinnerte mich jetzt an einen angriffslustigen
Schäferhund.
»War eine rein rhetorische Frage«, wiegelte ich ab. »Ich
wollte Sie nicht kränken oder gar maßregeln.«
»Entschuldigung angenommen«, knurrte Kreuzer. »Ich kann Ihnen
die Protokolle gern zur Verfügung stellen. Aber sicher werden Sie
sich selbst einen Eindruck verschaffen wollen und einen Abstecher
in das Lager machen.«
»Ja, das werden wir. Kommen Sie mit?«
»Nein. Was sollte ich dabei? Ich hab meinen Job da draußen
schon gemacht.«
Mir erschien dieser Mann irgendwie suspekt. Der Grund hierfür
entzog sich meinem Verstand, aber das Gefühl war da und ließ sich
nicht vertreiben.
7
Wir fuhren durch ein Gebiet, in dem bewaldete Hügel buckelten
und sich weitläufige Senken und Ebenen dehnten, weite Flächen
Prärie mit hüfthohem Strauchwerk und kniehohem Gras, das sich im
Wind bewegte wie die Wellen eines Ozeans. Ein schönes Stückchen
Land. Die Straße wand sich vor uns wie der Leib einer Schlange und
bohrte sich zwischen die Hügel. Das Land mutete wild und
ausgestorben an. Es schien, als würden sich hier Fuchs und Hase
gute Nacht sagen.
Wir erreichten die Jugendhilfeeinrichtung nach einer halben
Stunde Fahrt. Langgezogene Baracken mit vielen kleinen Fenstern
boten sich unserem Blick, ein großer, freier und staubiger Platz,
auf dem sich ein Fahnenmast mit der Deutschlandfahne zum Himmel
reckte. Ein drei Meter hoher Drahtzaun mit Schneidedraht auf seiner
Krone sowie ein zweiter, etwas niedrigerer Zaun grenzten das Areal
ein. In dem Streifen zwischen den Zäunen lag etwa einen Meter hoch
ineinander verworrener Schneidedraht. Es gab gleich hinter dem Zaun
einen Hindernisparcours, der wahrscheinlich der körperlichen
Ertüchtigung der Lagerinsassen diente.
Alles mutete trist und menschenfeindlich an. Das Tor war
geschlossen. Es war aus Eisenrohren zusammengeschweißt, zwischen
denen ebenfalls Drahtgittergeflecht gespannt war. Und auch die
beiden Flügel waren an ihrem oberen Ende mit gerolltem
Schneidedraht gesichert. Es gab einen Wachturm, auf dem ich zwei
Gestalten wahrnahm.
Auf dem Exerzierplatz marschierte eine Gruppe von Mädchen im
Gleichschritt, begleitet von einem Ausbilder.
Klaus Lemke stieg aus, ging zum Tor hin, und auf der anderen
Seite kam einer der Wachposten näher. Ich sah, wie Lemke seinen
Ausweis zückte, zu uns her deutete und auf den Wachposten
einsprach. Ein weiterer Mann näherte sich dem Tor. Er trug eine
beigefarbene Uniform. Lemke sprach erneut und unterstrich seine
Worte mit einigen Handbewegungen. Dann kam er zum Wagen und schwang
sich auf den Beifahrersitz.
Das Tor wurde geöffnet, und wir fuhren in die
Jugendhilfeeinrichtung.
Als wir vor der Kommandantur ausstiegen, hörte ich den
Ausbilder auf dem Exerzierplatz brüllen. »Links, zwei, drei, vier!
Links ... Verdammt, Willert, willst du dich nicht endlich dem
Gleichschritt anpassen! Schwing die Hufe, Willert, oder ich mache
dir Beine!«
Ein Mädchen mit einem Putzeimer kam aus einer der Baracken. Es
ging zu einem Gully am Rand der Straße, die zwischen den
Unterkünften hindurchführte und leerte den Eimer aus. Dann kehrte
sie in die Baracke zurück.
Wir betraten das Büro des Lagerleiters. Er musterte uns mit
durchdringenden Blicken, sein Gesicht war verschlossen, es verriet
nicht, was hinter der Stirn des Mannes vor sich ging. Nur eines
glaubte ich, sagte mir der Gesichtsausdruck: Braun war nicht
erfreut über unseren Besuch. Wir waren ihm alles andere als
willkommen.
»Wir kommen wegen der verschwundenen Mädchen«, sagte ich und
machte mich damit einfach zum Wortführer unserer kleinen Gruppe.
Nachdem ich das gesagt hatte, zählte ich die Namen der Mädchen auf,
die ich mir eingeprägt hatte. Zuletzt nannte ich Cindy Antonis
Namen.
Mit kalten Fischaugen schaute mich Braun an. Schwere
Tränensäcke hingen unter seinen Augen. Er hatte aufgeworfene
Lippen, die feucht glänzten, und in seinen Mundwinkeln hatte sich
ein brutaler Ausdruck fest gekerbt.
»Cindy hat schwere Vorwürfe gegen die Aufseher und die
Lagerleitung erhoben.«
Er fuhr sich mit den gespreizten Fingern durch das lichte
blonde Haar, das er streng nach hinten gekämmt trug. Dann
antwortete er: »Es gab Untersuchungen. Die Bundesanwaltschaft hat
sie durchgeführt und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die
Zustände in der Einrichtung okay sind. Es kratzt mich also nicht,
wenn irgendeine Göre irgendwelche Anschuldigungen von sich
gibt.«
»Cindy behauptet, aus der Einrichtung entführt worden zu
sein.«
»Vielleicht hat sie in der Vergangenheit zu viele Schundromane
gelesen oder billige Filme dieses Genres gesehen. Jedenfalls ist
ihre Behauptung erfunden. Ich denke, sie erzählt diesen Unsinn, um
nicht ins Gefängnis eingeliefert zu werden und ihre volle Haftzeit
absitzen zu müssen.«
»Haben Sie sich mit Kreuzer darüber unterhalten?«
»Wieso?«
»Weil er genauso argumentiert.«
Braun schwieg.
Jetzt ergriff Klaus Lemke das Wort. Er sagte: »Ihre
Jugendhilfeeinrichtung ist nicht unumstritten, Herr Braun. Zwei
Mädchen kamen ums Leben und nun diese Behauptung. Insgesamt sind –
wie mein Kollege Jörgensen schon sagte - sechs Mädchen spurlos
verschwunden. Hat man nachvollzogen, wie sie ausgebrochen sind?
Über den Zaun können sie ja kaum gestiegen sein. Sie hätten sich am
Schneidedraht Hände und Füße zerfetzt. Außerdem gibt es einen
Wachturm ...«
»Wir wissen es nicht«, versetzte Braun.
»In Luft können sie sich ja wohl kaum aufgelöst haben«,
knurrte Roy.
»Wahrscheinlich sind sie unter dem Zaun durchgekrochen
...«
»Kaum möglich«, wies ich dieses Vorbringen zurück. »Durch die
Schneidedrahtrollen kommt niemand. Sie müssten sich schon unter
beiden Zäunen durchgegraben haben wie Maulwürfe. Ein solcher
Fluchtweg wäre jedoch nicht verborgen geblieben.«
»Wir wissen es nicht!«, wiederholte Braun, diesmal um einige
Nuancen schärfer, wobei er jedes Wort betonte.
»Außerdem ist es doch sehr verwunderlich, dass die Mädchen nur
alleine beziehungsweise zu zweit geflohen sind«, mischte sich
Robert Anders ein. »Warum haben sich ihnen nicht weitere Mädchen
angeschlossen?«
»Weil die anderen Mädchen clever genug waren, die Chance, die
wir ihnen boten, nicht aufs Spiel zu setzen.«
»Kaum vorstellbar, dass die Mädchen verschwunden sind, ohne
dass ihre Kameradinnen es bemerkten«, trug Roy vor.
»Niemand weiß etwas und wenn, dann schweigen sie. Selbst wenn
wir sie hetzen, bis ihnen die Zungen zu den Hälsen heraushängen –
sie schweigen. Sie dürfen nicht vergessen, Herr Jörgensen, es sind
abgebrühte, hartgesottene und mit allen Wassern gewaschene
Straftäterinnen, die die Besserungseinrichtung dem Strafvollzug
vorgezogen haben. Das sind keine Mauerblümchen.«
Was von dem Lagerleiter kam, erschien mir wenig konkret,
ausweichend, vorgeschoben. Und in mir verstärkte sich die
Gewissheit, dass Cindy Antoni keine Märchen erzählt hatte. Braun
versuchte, die Mädchen als unverbesserliche Kriminelle
hinzustellen. Damit versuchte er uns abzulenken. Wahrscheinlich
hatte er auf diese Weise schon die Ermittler der
Bundesstaatsanwaltschaft für sich eingenommen und geblendet.
Nun, vielleicht war ich auch voreingenommen. Dieser Braun war
keine Erscheinung, die es mir leicht gemacht hätte, ihr
uneingeschränktes Vertrauen zu schenken. Ich besaß genug
Menschenkenntnis, um behaupten zu können, dass dieser Mann über
Leichen ging und dass ihm sein eigenes Wohl wichtiger war als alles
andere. Er war ein autoritärer Egoist, unduldsam, unerbittlich,
mitleidlos.
»Wer war als Ausbilder für Cindy Antoni zuständig?«
»Rainer Kuhlow. Ein integerer Mann, dem die Erziehung der
Jugendlichen ausgesprochen am Herzen liegt. Er ist verheiratet und
hat selbst drei Kinder.«
»Können wir ihn sprechen?«, fragte Klaus Lemke.
»Außerdem hätten wir gerne mit einigen der Mädchen
gesprochen«, fügte ich hinzu.
»Rainer und seine Gruppe befinden sich auf Übung im Gelände.
Ich weiß nicht, ob sie am Abend ins Lager zurückkehren oder im
Freien campieren.«
»Wo können wir ihn finden?«
»Irgendwo im Wald.« Braun grinste höhnisch.
»Eine Frage noch«, sagte ich. »Sind die Mädchen, die angeblich
aus der Einrichtung geflohen sind, vorher schon unangenehm
aufgefallen? Waren sie renitent, aufsässig, ungehorsam?«
»Diese Eigenschaften dulden wir hier nicht«, kam es wie aus
der Pistole geschossen von Braun. »Derartiger Widerstand wird im
Keim erstickt. Hin und wieder gibt es jemand, der unverbesserlich
ist. Er geht ins Gefängnis.«
»Oder er wird zerbrochen«, ergänzte Lemke.
Braun richtete seinen Blick auf ihn.
»Sie zu brechen und dann langsam wieder aufzubauen, ist der
Sinn solcher Jugendhilfeeinrichtungen, meine Herren.« Er machte
eine kleine Pause. »Diese Art Jugenderziehungslager gibt es seit
Mitte der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, als
verschiedene Regierungen sie ausprobierten und Jugendliche sowie
Heranwachsende in eine militarisierte Umgebung versetzten. Diese
Praxis wurde von Politikern aufgegriffen ...«
»Wie Willhelm Jenkow, der einer dieser Politiker und sturer
Befürworter der Jugendhilfeeinrichtungen war, wie?«, stieß Klaus
Lemke hervor. »Er war ausgesprochen bemüht, seinen Ruf als
unerbittlicher Gegner jeder Art von Verbrechen zu festigen.«
»Die Tatsache, dass es seit etwa zwanzig Jahren diese
Jugendhilfeeinrichtungen gibt, führt nicht zwingend zu dem Schluss,
dass diese Einrichtungen gut sein müssen«, erklärte ich. »Wir
werden Kuhlow ins Büro der Polizeidienststelle vorladen. Sicher
wissen Sie, wie Sie ihn erreichen können. Wahrscheinlich geht er
nicht ohne Handy in die Wildnis. Bestellen Sie ihm, dass wir ihn
morgen Vormittag um neun Uhr in Holm sehen möchten.«
»Er wird Ihnen nichts sagen können, nichts, was ich Ihnen
nicht schon gesagt hätte.«
»Das war so gut wie nichts, Herr Braun«, erwiderte ich kalt.
Er grinste ironisch.
»Die anderen Mädchen, die geflohen sind«, so erhob noch einmal
Roy das Wort, »gehörten sie auch zur Gruppe Rainer Kuhlows?«
»Kuhlow ist Oberaufseher, beim Militär würde man sagen
Kompanieführer. Ihm unterstehen vier Gruppen mit jeweils einem
Ausbilder.«
»Drillmeister!«, warf Lemke hin.
Braun schoss ihm einen ärgerlichen Blick zu.
»Aus-bil-der!«, presste er hervor und zerlegte das Wort in
seine Silben.
»Na schön«, sagte Roy. »Dann formuliere ich die Frage anderes.
Gehörten die Mädchen, die angeblich geflohen sind, zur Kompanie
Kuhlows?«
»Nicht alle.«
»Hat man sie verfolgt?«, wollte Anders wissen.
»Nein. Seien Sie mir nicht böse«, knurrte Braun. »Aber diese
Frage habe ich bereits konkludent beantwortet, als ich sagte, dass
wir nicht wissen, auf welchem Weg die Mädchen das Lager verlassen
haben. Wie hätten wir sie also verfolgen sollen.«
Im Klartext wollte er damit zum Ausdruck bringen, dass Anders
eine dämliche Frage gestellt hatte.
Mit Braun kamen wir nicht weiter. Es war vergeudete Zeit. Ich
erhob mich.
»Also, bestellen Sie es Kuhlow. Morgen Vormittag um neun Uhr
in der Polizeidienststelle. Sollte er nicht erscheinen, lassen wir
ihn abholen.«
Braun fixierte mich nur mit einem hintergründigen Blick, dem
ich ein gewisses Maß an Heimtücke zu entnehmen glaubte.
8
Hamburg, eine Wohnung in der Erichstraße, Altona. Die
Mittagszeit war längst vorüber, als Melanie Krüger die Augen
aufschlug. Zunächst starrte sie mit dem Ausdruck des absoluten
Nichtbegreifens zur Decke des Zimmers hinauf. Sie wies einige
Sprünge auf, war ehemals weiß gekalkt worden, jetzt aber war sie
schmutzig-gelb vom Nikotin und den Abgasen, die im Laufe vieler
Jahre durch das verzogene Fenster in den Raum gedrungen
waren.
Bei Melanie stellte sich die Erinnerung ein. Dennis West, ein
Computerchiphersteller, hatte am vergangenen Abend im Club Janin
seinen sechzigsten Geburtstag gefeiert. Eine geschlossene
Gesellschaft. Die Feier war in eine Orgie ausgeartet. Es wurde
getrunken, geschnupft und dem zügellosen Sex gefrönt. Von
irgendeinem Zeitpunkt an wusste Melanie nichts mehr. Jetzt war sie
nur total verkatert. Und noch etwas spürte Melanie. Sie brauchte
einen Schuss.
Reglos lag sie da und starrte zur Decke hinauf. Ihre Gedanken
schweiften zurück. Sie dachte an die Jugendhilfeeinrichtung, an das
Leid, das ihr dort widerfahren war, an die bitteren Tränen, die sie
in den Nächten vergoss, wenn sie vor Übermüdung oder wegen der
psychischen und physischen Beeinträchtigungen nach Gewaltmärschen
oder schwerer Arbeit auf dem Feld, nach körperlichen Züchtigungen
oder stundenlangem Stehen auf einem Fleck unter der heißen Sonne,
nicht einschlafen konnte.
Tag für Tag nur Drill, Zwang und Demütigung. Dann hatte man
sie in Einzelhaft genommen, weil sie angeblich beim Revierdienst
nicht sauber genug gearbeitet hatte. Revierdienst hieß, den Platz
um die Wohnbaracke herum zu säubern und auch vom Unkraut zu
befreien, das zwischen den Betonplatten wucherte.
In der Nacht hatte man sie aus ihrem kleinen stockfinsteren
Gefängnis geholt. Es waren drei Kerle. Sie wurde in einen
Transporter verfrachtet und man verließ mit ihr das Lager. Einer
der Kerle befand sich bei ihr auf der geschlossenen
Transportfläche. Auf ihre Fragen hin gebot er ihr, zu schweigen.
Sie fuhren bis zum Morgengrauen, dann hielten sie auf einem
Parkplatz an der Autobahn an. Man gab ihr eine Spritze in den Arm,
in die Ellenbeuge. Die Angst, die sie fühlte, die Anspannung, die
an ihren Nerven zerrte, verschwand. Sie wurde ruhig, schläfrig und
ergab sich in ihr Schicksal.
Man hielt sie in dem Zustand der Lethargie und brachte sie
irgendwann nach Hamburg. Zwei Männer übernahmen sie und brachten
sie in dieses Gebäude. Auch sie spritzten ihr Heroin. Sie war
süchtig geworden. Man versprach ihr in ausreichendem Maße
Rauschgift, dafür aber müsste sie in einer Bar arbeiten – im Club
Janine. Und zwar als Animiergirl, außerdem hatte sie für besondere
Wünsche zahlender Kunden zur Verfügung zu stehen.
Für einen Schuss Heroin hätte Melanie ihren Peinigern aus der
Hand gefressen.
Gestern hatte sie während der Party zur Verfügung zu stehen.
Dennis West hatte für sie und einige ihrer Kolleginnen gut bezahlt.
Sie bekamen ihren Stoff und boten den Gästen alles, was sie zu
bieten hatten.
Ja, es war eine Orgie; sündig, lasterhaft, pervers.
Es gab noch etwas in der Psyche des Mädchens, das stärker war
als die Sucht. Es war die Abscheu. Die Kerle mit ihren
ausgefallenen Wünschen widerten es an. Es waren perverse Spiele,
die Melanie anekelten. Sie war kriminell, hatte ein hohes Maß an
Brutalität an den Tag gelegt, als sie in Hamburg alte Frauen
überfiel und sie war heroinsüchtig. Aber sie hatte sich noch etwas
bewahrt, an das sie sich klammerte. Es war ein gewisses
Selbstwertgefühl, das ihr sagte, dass sie nur noch benutzt wurde
wie ein Spielzeug, das man irgendwann in die Ecke warf, wo es
liegenblieb und von niemand mehr beachtet wurde, bis es irgendwann
im Müll landete.
Die Angst davor stieg aus dem Unterbewusstsein des Mädchen und
erfüllte es mit düsteren Visionen.
Du musst weg, ehe es zu spät ist!, durchfuhr es Melanie. Du
gehst hier vor die Hunde. Du musst nach Hause. Wenn dir jemand
helfen kann, dann deine Eltern. Großer Gott, was hast du ihnen für
Kummer und Sorgen bereitet? Ich will das ändern und nicht mehr
diesen schmierigen Kerlen hörig sein.
Melanie erhob sich. Sie war nur mit einem Slip bekleidet. Das
bisschen Kleidung, das sie am Abend getragen hatte und das mehr
gezeigt hatte als es verbarg, lag auf dem Boden ihres Zimmers
verstreut herum.
Melanie war ein schönes Mädchen mit einer traumhaften Figur.
Aber jetzt spürte sie den Entzug und sie kam sich wie ausgehöhlt,
wie am Boden zerstört vor. Ihre Hände zitterten. Schweiß perlte auf
ihrer Stirn. Die innere Unruhe war fast schmerzhaft zu
spüren.
Sie überwand sich und ging zu dem Schrank, der an der dem Bett
gegenüberliegenden Wand stand und öffnete ihn. Da lagen einige
Kleidungsstücke, die man ihr zur Verfügung gestellt hatte. Sie zog
eine Jeans und ein weißes T-Shirt an, barfüßig schlüpfte sie in die
schwarz-weißen Sportschuhe, die auf dem Boden des Schranks standen,
und band sie zu.
Melanie ging zu einem Spiegel, der über einem abgestoßenen
Sideboard an der Wand hing und betrachtete sich. Ihr Gesicht war
vom zügellosen Leben der vergangenen Wochen gezeichnet. Die Augen
lagen tief in den Höhlen, dunkle Ringe hatten sich unter ihnen
gebildet. Ein herber Zug hatte sich in ihren Mundwinkeln
eingekerbt. Ihre Wangen muteten eingefallen an.
Sie verließ das Zimmer. Im Haus war es ruhig. Die Tür, durch
die man das Apartment verlassen konnte, war verschlossen. Melanie
ging zu einer der Türen, die von der kleinen Diele abzweigten,
öffnete sie und schaute hinein. Da lag Rebecca im Bett und schlief,
bei ihr befand sich Georg, der Schlägertyp, der für die Mädchen
verantwortlich war, die in dem Gebäude untergebracht waren. Georg
schnarchte.
Über einer Stuhllehne hing Georgs Hose. Melanie nahm sie,
griff in die Tasche und fand den Wohnungsschlüssel.
Georgs Schnarchen brach schlagartig ab. Er drehte sich auf die
Seite, murmelte irgendetwas vor sich hin und Melanie erstarrte. Das
Herz schlug ihr hinauf bis zum Hals. Ihre Atmung hatte sich
beschleunigt. Aber Georg wachte nicht auf. Wahrscheinlich war er
stark betrunken gewesen, wie alle, die der Party beigewohnt
hatten.
Melanie verließ das Zimmer und begab sich in einen anderen
Raum. Da schliefen zwei Mädchen auf Matratzen, die nur auf dem
Boden lagen. Eines der Mädchen rüttelte Melanie.
»Jenny, wach auf. Jenny ...«
Die Lider des hellblonden Mädchens zuckten.
»Lass mich in Ruhe«, murmelte Jenny Wolters und drehte sich
herum, schloss die Augen und schlief sofort wieder ein.
Melanie richtete sich auf, ging in die Diele und sperrte die
Wohnungstür auf, öffnete sie, lauschte ins Treppenhaus und huschte
dann hinaus. Schnell, aber dennoch leise, lief sie die Treppe
hinunter, die Haustür ließ sich öffnen, Melanie trat hinaus auf die
Straße.
Einen Moment lang wollte sie Resignation überkommen, als sie
daran dachte, dass sie keinen Cent besaß und sie den Heroinentzug
immer krasser spürte. Sie war unruhig, angespannt und sie fühlte
körperliche Schwäche. Dazu kamen das Zittern und das
Schwitzen.
Melanie hatte keine Ahnung, was noch auf sie zukommen würde.
Sie dachte auch nicht darüber nach. Zu den Entzugssymptomen
gesellten sich die Nachwirkungen des Alkoholrausches.
Melanie gab sich einen Ruck und marschierte los. Georg
schlief. Es war alles so einfach. Sie konnte einfach davon
spazieren. Dabei war sie wie eine Gefangene gehalten worden
...
Melanie hatte keine Ahnung, wo sie sich befand. Mit weichen
Knien wankte sie dahin. Sie verspürte Übelkeit.
Fußgänger begegneten ihr und musterten sie neugierig. Alles in
ihr schrie nach einem Schuss. Seit sie aus der
Jugendhilfeeinrichtung entführt wurde, war sie – nachdem ihr das
erste Mal Rauschgift gespritzt worden war – etwa alle sechs bis
acht Stunden versorgt worden. Seit sie zum letzten Mal an der Nadel
gewesen war, waren zwölf oder noch mehr Stunden vergangen. Die
Sehnsucht nach der Wirkung der Droge wurde fast übermächtig in
ihr.
Melanie erreichte eine U-Bahnhaltestelle. Einige Leute
warteten da. Etwas abseits standen drei Jugendliche und rauchten.
Die Burschen lachten miteinander. Einer sagte laut, als wäre er
bemüht, auch die anderen Menschen an der Haltestelle an seinem
Erlebnis teilhaben zu lassen: »Dann haben mich die beiden Ladys so
richtig...«
»Gebt mir eine Zigarette«, krächzte Melanie. Ihre Nasenflügel
bebten. Der Junge hatte abgebrochen und die drei starrten das
Mädchen an.
»Eine Zigarette«, wiederholte Melanie. »Bitte.«
Einer der Jungs grinste anzüglich. »Gibt's 'ne
Gegenleistung?«
»Die sieht ziemlich fertig aus«, sagte einer der anderen
Burschen. »He, was ist los mit dir, Baby? Hast du
durchgemacht?«
Und der dritte der Kerle fügte hinzu: »Wetten, dass wir von
der für eine Zigarette alles haben können.« Er grinste schief und
fixierte Melanie mit gierigem Blick.