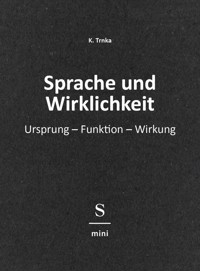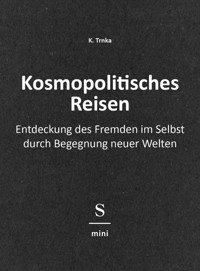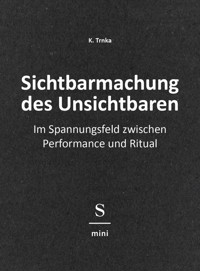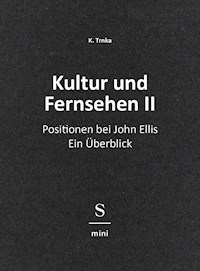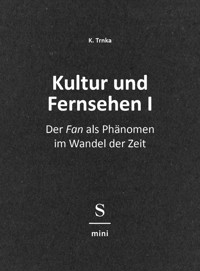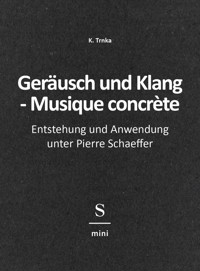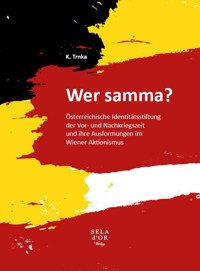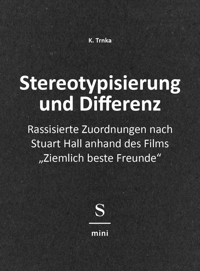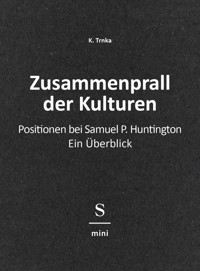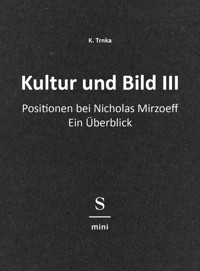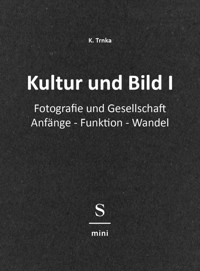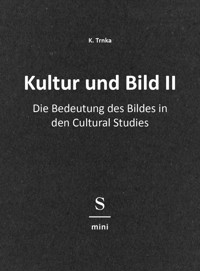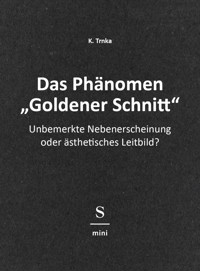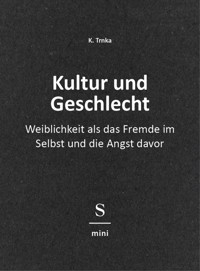
3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Frau als das personifizierte Andere eröffnet eine Thematik, die bis heute kaum an Aktualität verloren hat. Es geht um den Begriff der Weiblichkeit, welcher anhand verschiedener Positionen bei Karen Horney, Joan Riviere, Judith Butler, Julia Kristeva und Walter Hollstein diskutiert wird. Was bedeutet Weiblichkeit und was haben Verdrängung, Verleugnung und Angst vor dem Fremden damit zu tun? Dieser und noch weiteren Fragen wird in diesem Text nachgegangen. Dieses E-Book ist Teil der E-Book-Reihe "Sela d'or mini" des Sela d'or Verlags. In Sela d'or mini erscheinen wissenschaftliche Texte mit kulturwissenschaftlichen Themen. Die Reihe wird kontinuierlich erweitert und zeichnet sich aus durch ihre Kompaktheit der Texte und der thematischen Vielfalt. www.selador-verlag.at
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 26
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Kultur und Geschlecht
Weiblichkeit als das Fremde im
Selbst und die Angst davor
Die Frau als das personifizierte Andere eröffnet eine Thematik, die trotz ihrer Altbekanntheit bis heute kaum an Aktualität und Brisanz verloren hat. Unter sich ständig ändernden Rahmenbedingungen sowohl in soziokultureller als auch ökonomischer Hinsicht, verlangt es auch immer wieder nach neuen Betrachtungsperspektiven, welche den gegenwärtigen Status Quo berücksichtigen. Obwohl sich seit mehr als einem Jahrhundert eine öffentliche Debatte über die Geschlechterfrage beobachten lässt, die ab Mitte des 20. Jahrhunderts mit Simone de Bouvoirs „Das andere Geschlecht“ (1968) ihren aufkeimenden Grundstein legt und viele weitere wesentliche Frauenstimmen hervorbringt, kann heute von einem zufriedenstellenden Konsens bei Weitem nicht die Rede sein. Noch immer geht es um die grundlegende Frage, was der heute immer noch so präsenten Problematik der Geschlechterdifferenz zugrunde liegt und durch welche Regelwerke diese etabliert wird. Im Speziellen geht es um den Begriff der Weiblichkeit, der eine stark ambivalente Komponente in sich birgt und um Fragen wie: Was heisst es, weiblich / Frau zu sein? Inwieweit sind diese Begriffe miteinander gekoppelt und wie entkoppelt man sie? Welche Dynamiken werden dabei freigesetzt und wie geht Mann damit um?
Um den Antworten auf diese Fragen näher zu kommen, wird folgend anhand verschiedener Positionen der Begriff der Weiblichkeit beleuchtet und innerhalb spezifischer Einbettungen diskutiert: Einführend geht es um den mythologischen Aspekt von Weiblichkeit und seinen dichotomischen Charakter zwischen furchtbar Fremdartigem und begehrenswert Vertrautem. Den Schwerpunkt in diesem Text bilden verschiedene Positionen bei Karen Horney, Joan Riviere, Judith Butler, Julia Kristeva und Walter Hollstein, die sich allesamt auf psychoanalytische Ansätze Freuds berufen. Daraus ergeben sich weiterführende Überlegungen zu gemeinsamen Zugängen bezogen auf Weiblichkeit als das Fremde, die schließlich auf den Aspekt des Unheimlichen und die damit verbundene Angst vor der Weiblichkeit im Selbst verweisen. Abschließend werden die wesentlichen Positionen zusammenfassend gegenübergestellt, um die einleitenden Fragen nach der grundlegenden Ursache für Geschlechterdifferenz zu beantworten.
Das Ziel dieses Textes liegt darin, den dichotomischen Charakter von Weiblichkeit herauszuarbeiten und so die verborgene Ambivalenz in einem soziokulturellen Kontext offenzulegen. Es soll aufgezeigt werden, dass Verdrängung, Verleugnung und Angst vor dem Fremden / der Weiblichkeit auf unbewusste Gegebenheiten im eigenen Selbst zurückzuführen sind und diese die treibende Kraft für die noch heute präsente Geschlechterdifferenz darstellen.
I Weiblichkeit als Mythos
In diesem Kapitel geht es einführend um den Weiblichkeitsbegriff als mythologisches Artefakt. Dieser darf seine Ursprünge bereits in der griechischen Mythologie verzeichnen und scheint bei genauerer Betrachtung der Frauenrolle des anfänglichen 20. Jahrhunderts bis heute tief in bestimmten Denkschemata verankert.
Weiblichkeit als das personifizierte Böse
Hesiod als einer der wichtigsten griechischen Dichter der Antike berichtet in seiner Theogonie, eine der ältesten Schöpfungsgeschichten des Altertums, von der Entstehung der Welt und der Götter. Auffallend ist darin die beachtliche Anzahl an weiblichen Schreckgestalten, welche durchwegs mit negativen Eigenschaften wie Verderben, Angst und Tod konnotiert werden. Geschöpfe wie die neunköpfige Hydra, das nymphenähnliche Meerungeheuer Echidna, die 3-köpfige Chimaira oder die drei Gorgonenschwestern, deren Häupter aus dutzenden Schlangen bestehen, werden durch ihre anorganischen Deformierungen dem Anderen