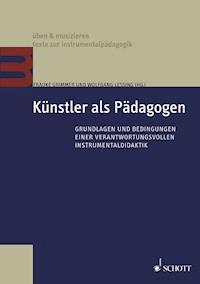
Künstler als Pädagogen E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Schott Music
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: üben & musizieren – texte zur instrumentalpädagogik
- Sprache: Deutsch
Das Vorbild von Instrumentallehrern, von Künstlern als Pädagogen, hat großen Einfluss auf die Entwicklung junger Musiker. Dialogfähigkeit und Empathie gehören zu den unverzichtbaren Tugenden erfahrener Instrumental- und Vokalpädagogen. Ihre Ausbildung findet immer noch weitgehend hinter verschlossenen Türen statt. Das hat Folgen für die Betroffenen, für die Entwicklung einer musikalischen Lernkultur und den Diskurs aller an Ausbildung Beteiligten. In dem vorliegenden Buch, das aus den Beiträgen eines internationalen Symposiums in Dresden (2006) hervorgegangen ist, wird aus der Perspektive von Musikpädagogen, Erziehungswissenschaftlern und ausübenden Künstlern ein Blick auf die Grundlagen und Bedingungen einer verantwortungsvollen Instrumentalpädagogik geworfen. Eine besondere Aufmerksamkeit wird dabei der Lehrer-Schüler-Beziehung im Kontext künstlerisch-musikalischen Lernens zuteil.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Künstler als Pädagogen
Künstler als Pädagogen
GRUNDLAGEN UND BEDINGUNGEN EINER VERANTWORTUNGSVOLLEN INSTRUMENTALDIDAKTIK
HERAUSGEGEBEN VON FRAUKE GRIMMER UND WOLFGANG LESSING
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Bestellnummer SDP 115
ISBN 978-3-7957-8664-9
© 2016 Schott Music GmbH & Co. KG, Mainz
Alle Rechte vorbehalten
Als Printausgabe erschienen unter der Bestellnummer UM 5005
© 2008 Schott Music GmbH & Co. KG, Mainz
www.schott-music.com
www.schott-buch.de
Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Nutzung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlags. Hinweis zu § 52a UrhG: Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne eine solche Einwilligung kopiert und in ein Netzwerk gestellt werden. Das gilt auch für Intranets von Schulen oder sonstigen Bildungseinrichtungen.
Inhalt
Einleitung der Herausgeber
Horst Rumpf
Die andere Aufmerksamkeit.
Über ästhetische Erziehung im Zeitalter der Weltbewältigung
Gerhard Mantel
Kunst und Pädagogik – ein Widerspruch?
Auf der Suche nach künstlerischen Kriterien
Frauke Grimmer
Ein Ton, in dem wir plötzlich die Welt entdecken...
Über das Künstlerische in der Ausbildung von Pianisten
Annette Unger
„Und manchmal Schokoladenpudding“.
Zum Verhältnis von künstlerischer und pädagogischer Praxis
Wolfgang Lessing
Musizieren als Interaktion.
Die Lehrer-Schüler-Beziehung im Spannungsfeld zwischen ästhetischer Erfahrung und alltäglicher Lebenswelt
Michael Dartsch
Hochschullehre und pädagogische Tugend.
Ethische Aspekte einer künstlerisch-pädagogischen Tätigkeit
Sibylle Cada
Resonanz und Dialog.
Systemisches Denken und Handeln in der Instrumentalpädagogik
Erna Ronca
Ein ganzheitlicher Ansatz
Supervision und Coaching von ausgebildeten PianistInnen
Reinhart von Gutzeit
Was für ein „Typ“?
Welche Art Lehrende brauchen Musikhochschulen und wie können sie gefunden werden?
Barbara Busch
Künstler oder Pädagoge?
Ein Rollenkonflikt begleitet die Professionalisierung der Instrumentalpädagogik
Ulrich Mahlert
Didaktische Polyfonie.
Kommunikationspsychologische Überlegungen zu Sprechweisen in Instrumentalschulen
Einleitung der Herausgeber
Musikhochschulen sind Orte künstlerischen Lehrens und Lernens. Sie bilden einen organisierten Erfahrungsraum, der geprägt ist durch Rahmenbedingungen, Unterrichtsatmosphäre, durch soziale, pädagogische und künstlerische Beziehungen zwischen „Meister“ und „Novizen“. Diese Dyade ist Schonraum und Abhängigkeitsverhältnis zugleich. Im besten Falle ereignet sich in ihr ein inspirierender Erfahrungsaustausch über instrumentales Lernen und Musik als Kunst, der für Lehrende und Lernende produktiv ist.
Das Vorbild von Instrumentallehrern, von Künstlern als Pädagogen, und das heißt auch: von Künstlern mit besonderer Vermittlungsqualität, hat großen Einfluss auf die Entwicklung junger Musiker. Darin stimmen alle einschlägigen Untersuchungen im Zeichen von Life-Span-Forschung,1 musikalischer Hochbegabungsforschung2 oder musikpädagogischer Biografieforschung3 überein. Dialogfähigkeit und Empathie gehören zu den unverzichtbaren „Tugenden“ erfahrener Instrumental- und Vokalpädagogen, denn junge Musiker sind dem Erfahrungsvorsprung, den handwerklichtechnischen Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie den künstlerischen Leitvorstellungen und Leistungserwartungen ihrer Lehrerinnen und Lehrer oft über Jahre hinweg ausgeliefert.
Die Ausbildung zum musikalischen Künstler findet auch im 21. Jahrhundert noch weitgehend hinter verschlossenen Türen statt. Das hat Folgen für die Betroffenen, für die Entwicklung einer musikalischen Lernkultur und den pädagogischen Diskurs aller an der Ausbildung Beteiligten. Bedeutende Lehrtraditionen, die sich im Laufe der Geschichte herausgebildet haben, manifestieren sich in den Klassen der Künstler meist als exklusives Expertenwissen. Dessen ästhetische, lerntheoretische, pädagogische und methodische Voraussetzungen bleiben damit Geheimnis. Es fehlt an empirischer Forschung, die mit einem komplexen Methodenensemble die Bedingungen und Prozesse künstlerischen Instrumentallernens untersucht, und es fehlt in den Institutionen auch oft die Bereitschaft sich intersubjektiv zu verständigen: Über das je eigene Musikverständnis von Lehrenden, über Klangvorstellungen und Fragen der Interpretation. Nicht selten gleicht die Beurteilung künstlerischer Leistungen in den Abschlussprüfungen daher einer Odyssee.
Es war ein wesentliches Anliegen des internationalen Symposiums „Künstler als Pädagogen“, jene Bedingungen, Möglichkeiten und Probleme genauer auszuloten, die sich aus der Lehrer-Schüler-Beziehung für ein künstlerisch-musikalisches Lernen ergeben. Den Anlass zu diesem Kongress bot der 75. Geburtstag des international renommierten Cellisten, Pädagogen und Buchautors Gerhard Mantel, dessen langjähriges Wirken – darin wohl kaum einem anderen Musiker vergleichbar – exakt an jener Schnittstelle zwischen Kunst, Pädagogik und Wissenschaft angesiedelt ist, die eine Auseinandersetzung mit diesem Thema zwangsläufig mit sich bringt.
Bereits in der Planungsphase des Symposiums war den Veranstaltern bewusst, dass die vielschichtigen Perspektiven dieser Beziehung sich nur durch eine Begegnung unterschiedlichster Ansätze und Disziplinen erfassen lassen. In diesem Sinne kam es zwischen dem 3. und 5. November 2006 in der Dresdner Musikhochschule zu einem intensiven und fruchtbaren Gedankenaustausch zwischen ausübenden Künstlern, Instrumentalpädagogen, Unterrichtsforschern, Erziehungswissenschaftlern und Hochschulrektoren, dessen Erträge im vorliegenden Band dokumentiert werden.
Im einleitenden Beitrag versucht Horst Rumpf einen Wahrnehmungshorizont freizulegen, vor dem sinnliche Eindrücke nicht lediglich als Fallbeispiele bereits bekannter Muster und Strukturen eingeordnet, eingeebnet und bewältigt werden. Rumpf geht es vielmehr um eine „andere Aufmerksamkeit“, die widerständige, oftmals auch irritierende Erfahrungen ermöglicht und eine dialogisch-tastende Weltaneignung eröffnet, die im Zuge leistungsorientierter Beherrschungsideologien verloren zu gehen droht. Sein Plädoyer stellt eine Herausforderung gerade für die künstlerische Ausbildung an Musikhochschulen dar, die sich fragen lassen muss, ob und inwieweit sie nicht selbst den Leistungs- und Beherrschungsideologien folgt, die die Chance ästhetischer Wahrnehmung eher behindern denn befördern.
Gerhard Mantel arbeitet in seinem Aufsatz „Kunst und Pädagogik – ein Widerspruch?“ ein zentrales Merkmal künstlerischen Lernens, das Moment der „Unsicherheit“, heraus. Dieses Moment wird in seinen Augen im institutionalisierten Ausbildungsraum Musikhochschule häufig vorschnell durch simple Gegensatzbeziehungen (falsch-richtig etc.) ersetzt, anstatt als genuines Merkmal künstlerischen Lernens anerkannt zu werden.
Mit ihrem Beitrag „Ein Ton, in dem wir plötzlich die Welt entdecken...“ gewährt Frauke Grimmer Einblick in ein von ihr durchgeführtes empirisches Projekt mit Feldforschung in der Ausbildung von Pianisten. Anhand von zwei dokumentierten Unterrichtsausschnitten an deutschen Musikhochschulen lässt sie künstlerisches Lehren und Lernen quasi nachträglich „in vivo“ miterleben. Ihre besondere Aufmerksamkeit gilt dabei den Erscheinungsformen des Künstlerischen, die sich in der je eigenen musikalischen, sprachlichen und nonverbalen Interaktion von dem erfahrenen und heranwachsenden Musiker konstituieren.
Eine verwandte Themenstellung, nun allerdings aus der Perspektive der ausübenden Künstlerin, verfolgt Annette Unger. In ihrem Beitrag „Und manchmal Schokoladenpudding“ geht die Violinpädagogin auf den viel beschworenen vermeintlichen Rollenkonflikt zwischen „Künstler“ und „Pädagogen“ ein und betont demgegenüber die Verbindungslinien zwischen künstlerischer Erfahrung und pädagogischem Handeln.
Dass die Wirklichkeit institutionalisierter Unterrichtssituationen nicht zwangsläufig mit der Wirklichkeit ästhetischer Erfahrung konvergiert, arbeitet Wolfgang Lessing heraus. Ausgehend von soziologischen Wirklichkeitstheorien umreißt sein Beitrag „Musizieren als Interaktion“ das Spannungsfeld zwischen „alltäglicher Lebenswelt“ (Alfred Schütz) und künstlerischer Sinnsphäre und leitet hieraus Konsequenzen für die Rolle des Lehrenden ab.
Auch der Beitrag Michael Dartschs zielt auf das Rollenverständnis des Lehrenden ab. Die „klassischen“ Ebenen künstlerischer, fachdidaktischer, musikpädagogischer und pädagogischer Kompetenz werden in seinem Beitrag „Hochschullehre und pädagogische Tugend“ um eine ethische Dimension ergänzt. Der Rückgriff auf eine Tugendethik als Leitfaden pädagogischen Handelns ist in seinen Augen notwendig, da wissenschaftliche Disziplinen wie Musikpädagogik und Pädagogik aus sich heraus zwar allgemeine Bedingungen für gelungenes pädagogisches Handeln formulieren, nicht aber die unmittelbare Lernsituation zwischen individuellen Lehrer- und Schülerpersönlichkeiten in den Fokus nehmen können.
Als ein konkretes Beispiel für die Entwicklung und Verbesserung der Unterrichtsinteraktion wendet sich Sibylle Cada der „Tugend“ der Kommunikation zu. In ihrem Beitrag „Resonanz und Dialog“ formuliert sie grundlegende Bedingungen für ein gelingendes „Arbeitsbündnis“ von Lehrer und Schüler. Ihre Überlegungen zur Entwicklung einer „Feedback-Kultur“ basieren auf den Erfahrungen, die sie seit mehreren Jahren im Rahmen von Seminaren zum Thema „Kommunikation im Unterricht“ an der Frankfurter Musikhochschule gewonnen hat.
Dass derartige und vergleichbare Foren eine notwendige Bedingung für die Qualitätsentwicklung von Instrumentalunterricht darstellen, zeigt Erna Ronca in ihrem Beitrag zu „Supervision und Coaching von Pianisten“, in dem sie ein Supervisionsmodell vorstellt und auswertet, das sie selbst vor einigen Jahren an der Musikhochschule Zürich maßgeblich mit entwickelt hat.
Dass die Qualitätsentwicklung eines Lehrkörpers an einer Musikhochschule auch von verlässlichen Kriterien bei den Auswahlverfahren abhängt, zeigt Reinhart von Gutzeit, der derzeitige Rektor des Mozarteum Salzburg. In seinem Beitrag „Was für ein ,Typ‘?“ beschreibt er die Vielfalt und Bandbreite dieser Kriterien und geht der Frage nach, welche Möglichkeiten eine Hochschule besitzt, geeignete Lehrpersönlichkeiten zu finden.
Die beiden letzten Beiträge des Bandes thematisieren die Lehrer-Schüler-Beziehung im Instrumentalunterricht nicht direkt, sondern in vermittelter Form. Barbara Busch analysiert das Bild des Instrumentallehrers in Literatur und Film. Die Frage, wieso Schriftsteller und Regisseure den Berufsstand vornehmlich ironisch-negativ beschreiben, wird von ihr mit dem Hinweis auf einen fundamentalen Rollenkonflikt beantwortet, dem sich der Instrumentalpädagoge seit dem 19. Jahrhundert ausgesetzt sieht. Ulrich Mahlert untersucht die nahe liegende und bislang erstaunlicherweise kaum thematisierte Frage, auf welche Weise sich die Sprache von Instrumentalschulen als zusätzliche Instanz in die Lehrer-Schüler-Beziehung einschaltet und die dialogische Beziehung von Lehrendem und Lernenden zu einer „didaktischen Polyfonie“ erweitert.
Der Kongress hätte ohne die finanzielle Unterstützung der DFG nicht stattfinden können. Ihr gilt unser besonderer Dank. Herzlich gedankt sei zudem den studentischen Hilfskräften Christoph Roßner, Therese Pflugbeil, Claudia Zobelt und Trang Nghiem, die für einen reibungslosen Verlauf der Veranstaltung sorgten. Christoph Roßner übernahm zudem die kritische Durchsicht der Manuskripte; auch dafür danken wir ihm.
Die Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) hat die vorliegende Publikation generös unterstützt. Die Herausgeber sind ihr und besonders dem Pädagogik-Ausschuss des Departements Musik zu großem Dank verpflichtet. Beteiligt an der Finanzierung der Drucklegung haben sich darüber hinaus die Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden, das Institut für Instrumental- und Gesangspädagogik e. V. Frankfurt am Main sowie das Mozarteum Salzburg. Auch diesen Förderern danken wir herzlich.
Frauke Grimmer
Wolfgang Lessing
1 Maria Manturzewska: „A biographical Study of the Life. Span Development of Professional Musicians“, in: Psychology of Music 18 (1989), S. 112-139.
2 Hans Günter Bastian: Leben für die Musik. Eine Biographie-Studie über musikalische (Hoch-) Begabungen, Mainz 1989.
3 Frauke Grimmer: Wege und Umwege zur Musik. Klavierausbildung und Lebensgeschichte, Kassel/London 1991.
Die andere Aufmerksamkeit
ÜBER ÄSTHETISCHE ERZIEHUNG IMZEITALTER DER WELTBEWÄLTIGUNG
HORST RUMPF
Bei einem Kongress der deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft vor 25 Jahren in Göttingen weigerte sich der erste Hauptredner – es war Ivan Illich –, über Erziehung im herkömmlichen Sinn nachzudenken. Er provozierte die pädagogisch eingestimmten Zuhörer: „Ich will vom Gegenteil von Erziehung und Verziehung sprechen, nämlich jenem Vorgang, in dem die Erziehung die Technik darin unterstützt, der Umwelt ihre rätselhafte Sinnlichkeit zu entziehen. Wo unverwaltete Sinnfülle auch im Industriesystem noch glimmt, will ich sie zum Flackern bringen. Noch mehr Energie – nein danke, noch mehr Erziehung, danke nein.“1 Eine starke These: Erziehung und Technik ziehen demnach am gleichen Strang, beide sind damit befasst, etwas zum Verschwinden zu bringen, „der Umwelt ihre rätselhafte Sinnlichkeit zu entziehen“ – und zwar durch strukturverwandte Maßnahmen. Was haben sie gemeinsam? Eine erste Deutung: Beide sind angetreten, die ungebärdige und vieldeutig anbrandende sinnliche Erfahrungswelt eindeutigen Regeln zu unterwerfen. Sie machen Widerfahrnisse vorhersehbar, planbar, steuerbar – mit Hilfe immer sorgfältiger durchrationalisierter Instrumente und Organisationen. Davon hatte Illich genug.
Es lohnt, sich einen Augenblick auf diese Provokation einzulassen. Was hat sie im Visier? Man mag die Alltagssprache mustern, mit der wir landauf, landab, quer durch Inhaltsbereiche und durch Schulen und Hochschulen die Vorgänge bezeichnen, die durch Belehrungen und Übungen angekurbelt werden sollen. Da ist einmal allgegenwärtig das Ziel der „Beherrschung“. Das wird von Kindern wie von Studierenden am Ende verlangt. Es wird schließlich geprüft und benotet. Stammeln, Zögern, Schweigen, ratloses sich Annähern – solches schlägt natürlich negativ zu Buche. Die so genannten „learner“ sollen die Materie ihres Lernens, Übens und Studierens am Ende „im Griff haben“. Und die Inhalte werden dabei zu „Stoffen“, die „durchzunehmen“ und zu „bewältigen“ sind.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























